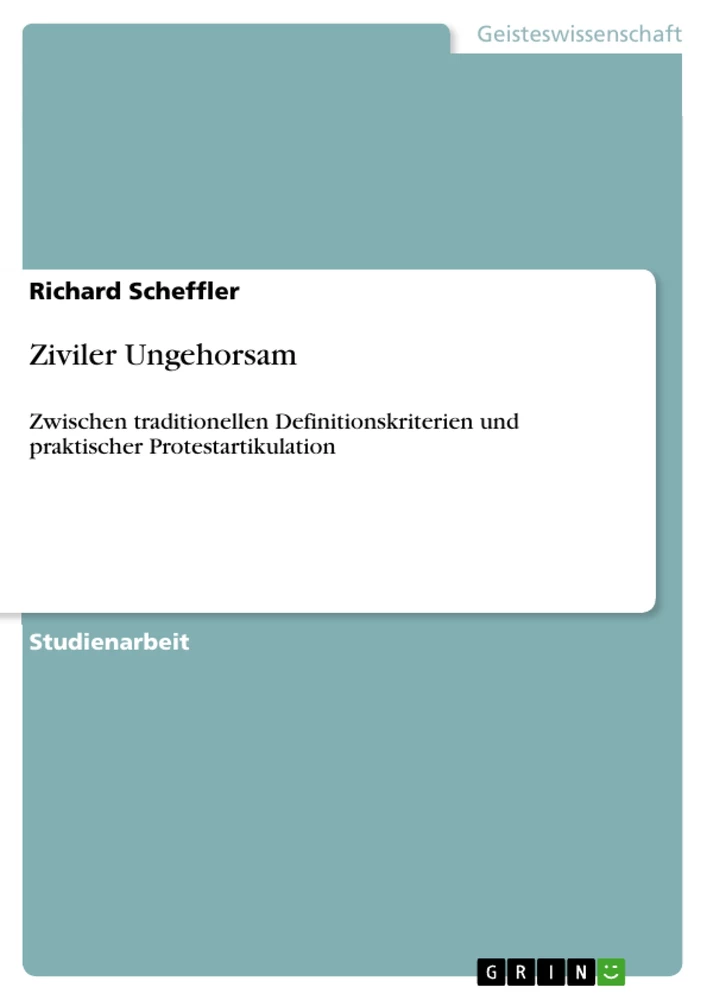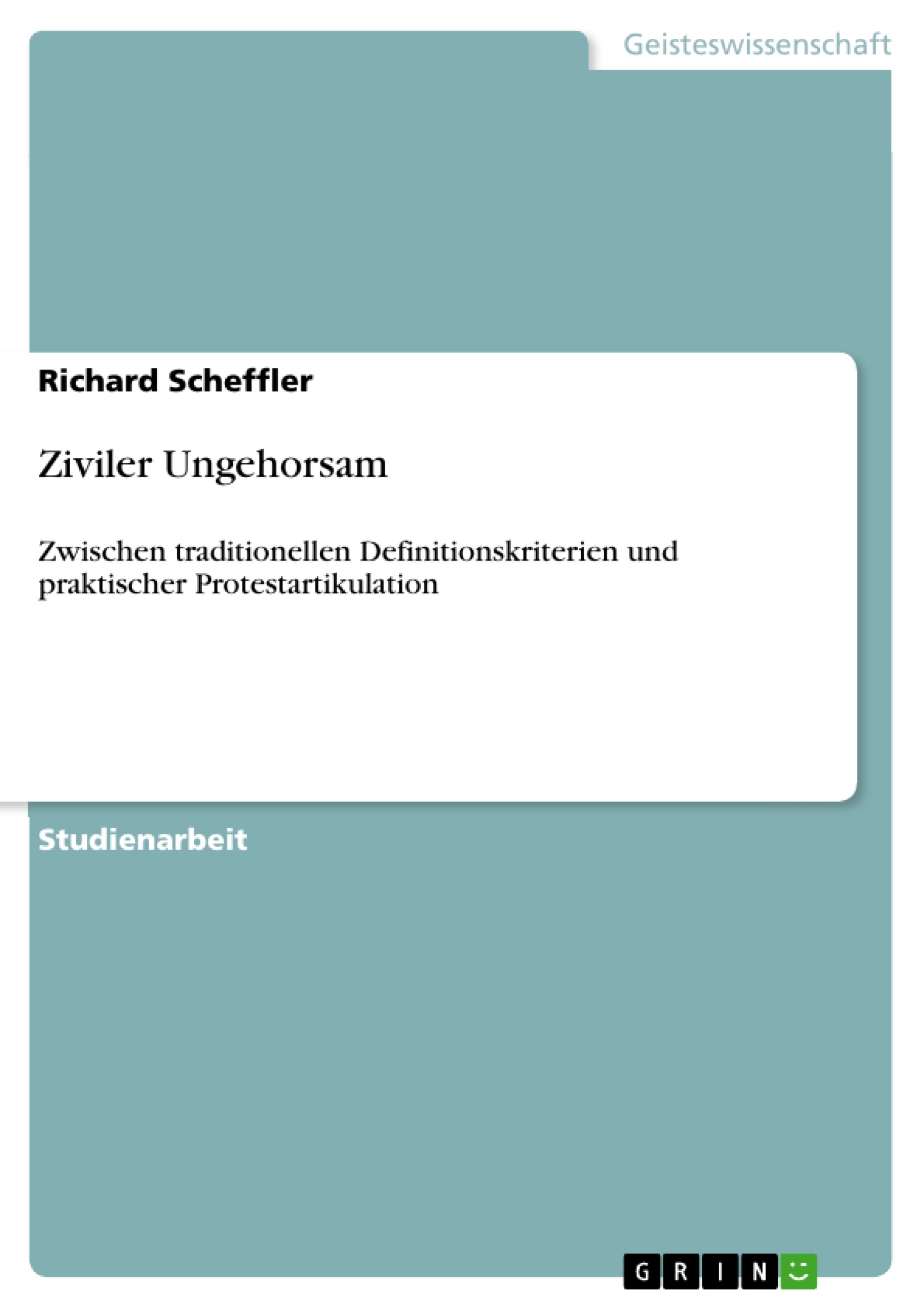Der Begriff des zivilen Ungehorsams wird in den aktuellen politischen Debatten der deutschen Medien- und Wissenschaftslandschaft immer wieder von Politologen, Aktivisten, Parlamentariern, Gewerkschaftlern, Historikern und Journalisten herangezogen, wenn es darum geht, einen moralisch begründeten Regelbruch zu beschreiben oder auch politisch zu legitimieren. Werden die dabei teils eklatant voneinander abweichenden Definitionen berücksichtigt, muss attestiert werden, dass der Begriff äußerst inflationär verwendet wird. Zu den Protestbestrebungen der jüngeren Vergangenheit, die den westlichen Medien zufolge auf das Mittel des zivilen Ungehorsams zurückgriffen, gehören beispielsweise die Anti-Atom-Bewegung der Bundesrepublik Deutschland, der Arabische Frühling oder auch die internationale Occupy-Bewegung. Der Begriff ist derart populär, dass selbst die Jugendorganisation der Gewerkschaft Verdi ein Informationsheft zum Thema herausgegeben hat. Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge erlebt die Formulierung „(…) in den vergangenen Jahren, insbesondere im deutschsprachigen Raum, eine Renaissance.“
Zu den Theoretikern, die sich um eine präzise begriffliche Verortung der Formulierung bemühten, gehören unter anderen Hannah Arendt, John Rawls, Jürgen Habermas und auch Mohandas Gandhi. Nach allgemeiner Auffassung handelt es sich beim zivilen Ungehorsam um eine Protestform, die gezielt als ungerecht empfundene Verbote oder Gesetze missachtet, wobei auf Mittel der physischen Gewaltanwendung verzichtet wird. Dieser Gesetzesbruch wird von den Akteuren zudem moralisch begründet, wobei eine Bestrafung für das entsprechende Vergehen akzeptiert wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionsannäherung
3. Bedingungen und Kriterien zivilen Ungehorsams
3.1. Gewaltlosigkeit
3.2. Akzeptanz strafrechtlicher Konsequenzen.
4. Bemühungen um juristische Legalität zivilen Ungehorsams.
5. Pflicht zum Rechtsgehorsam
6. Castor? Schottern! - Ausdruck zivilen Ungehorsams?
7. Fazit.
8. Quellenverzeichnis