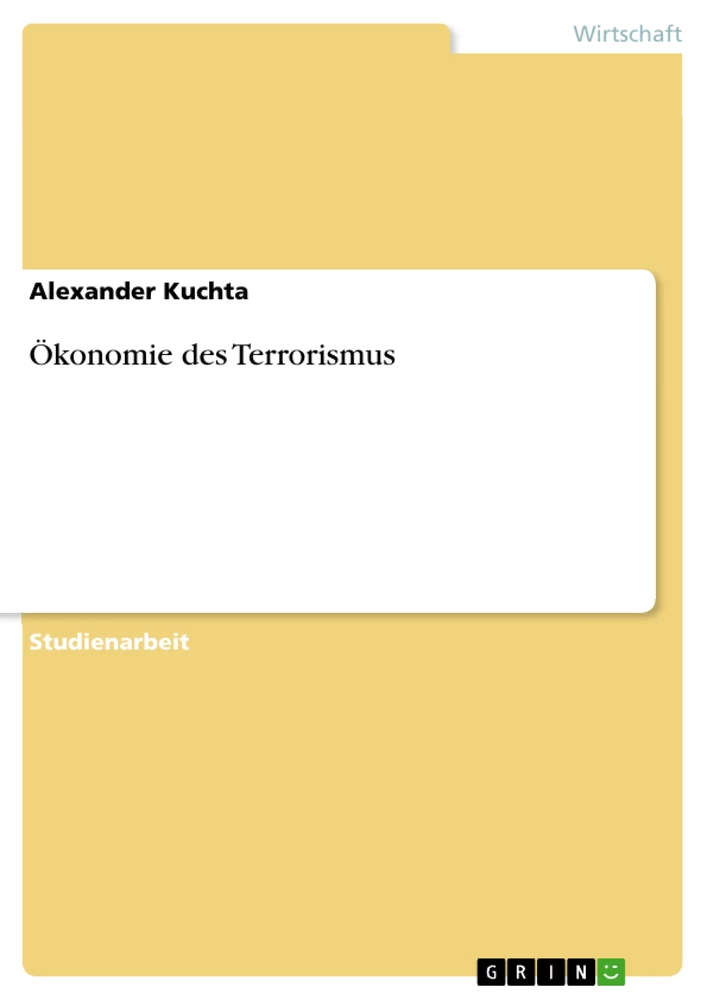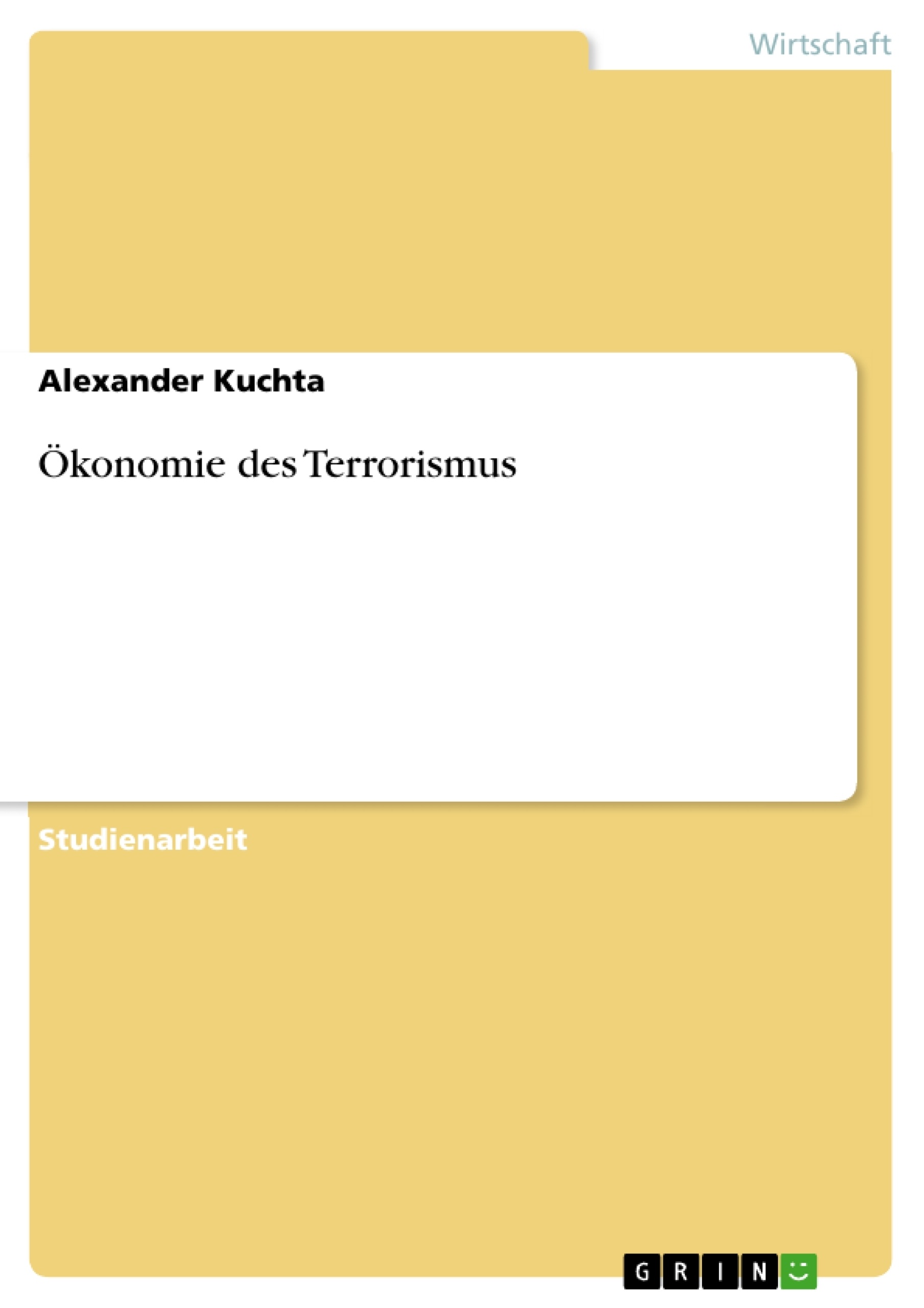Die Anschläge am 11. September auf das World Trade Center in New York und das Pentagon zeigten der Welt, dass der internationale Terrorismus eine Gefahr ist, welche einer genauen Analyse bedarf. Zum einen stellt sich die Frage nach den Gründen für Terrorismus. Terrorismus könnte aus Armut entstehen, doch wie lässt sich erklären, dass viele Selbstmordattentäter in Palästina aus eher wohlhabenden Familien stammen? Zum anderen stellt sich die Frage, warum Terroristen agieren und reagieren wie es zu beobachten ist. Der Versuch die Taten von Terroristen rational zu erklären, kann durch Mikroökonomik, mit ihrer Beschreibung des Verhaltens von Wirtschaftssubjekten, eine Antwort gegeben werden. Auch bietet sie die Möglichkeit die dynamischen Auswirkungen von Terrorismus auf das Wirtschaftsgeschehen zu beschreiben und Prognosen zu ermöglichen. Da der Kampf gegen den Terror in den letzten Jahren eher mit harten Maßnahmen bekämpft wurde, die durchschlagenden Erfolge aber ausblieben, sind insbesondere die Implikationen interessant, welche sich aus den Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften, für die Reaktion der Staaten auf Terrorismus ergeben.
Inhalt
1. Einleitung
2. Terrorismus
2.1 Gründe und Ziele des Terrorismus
2.2 Das Kalkül terroristischer Anschläge
2.3 Terroristen als rationale Akteure
3. Ansätze der Terrorismusbekämpfung
3.1 Klassische Sicherheitspolitik
3.2 Alternative Ansätze
4. Volkswirtschaftliche Kosten von Terrorismus
4.1 Direkte Kosten am Beispiel der Attacken vom 11. September
4.2 Indirekte Kosten
5. Fazit