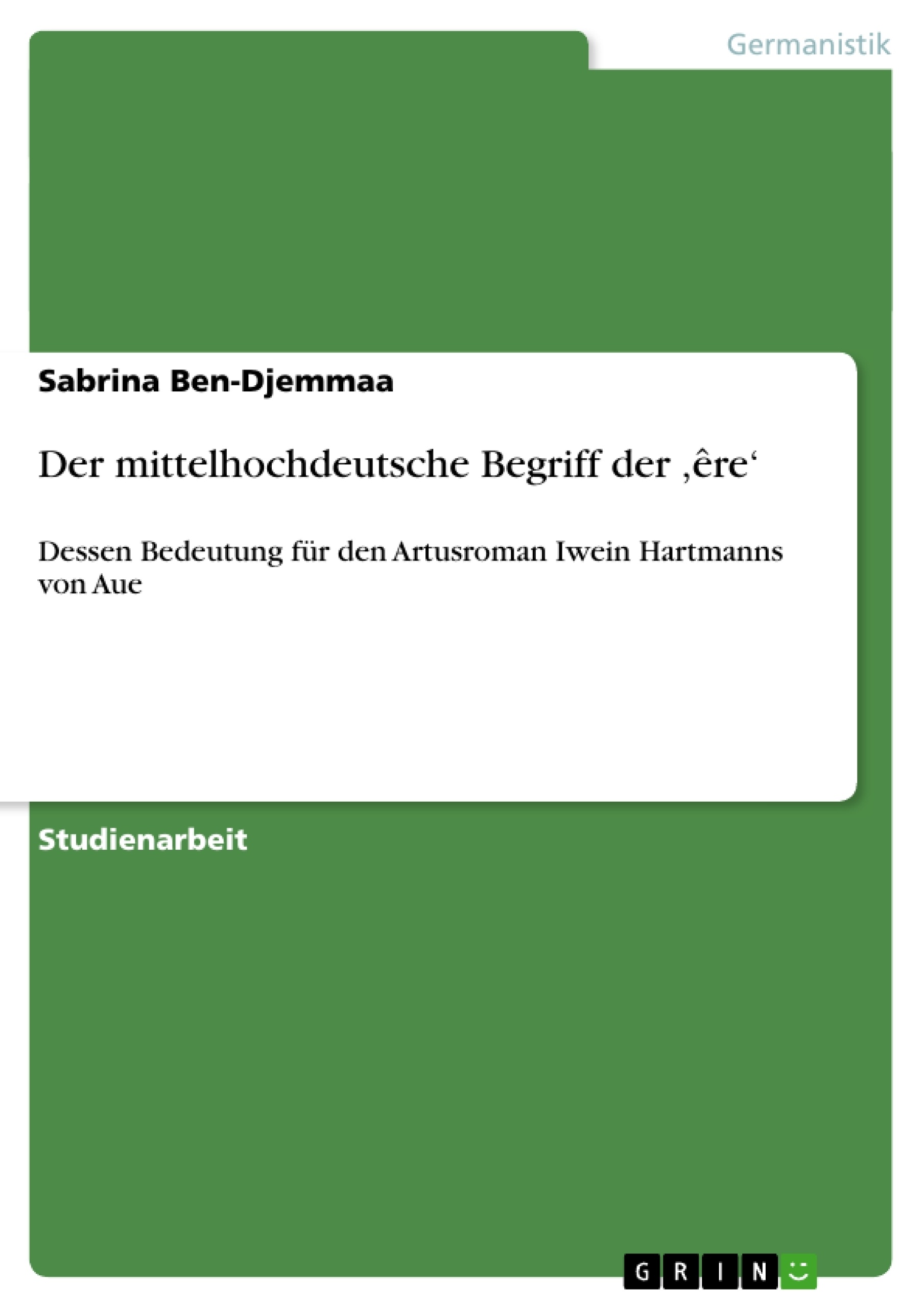Im Mittelalter war êre ein zentraler Begriff und galt in der Lebenswelt der Ritter als die wichtigste Voraussetzung ihrer Daseinsberechtigung und war somit zentral für ihre Handlungsmotivation. In der vorliegenden Hausarbeit habe ich mich mit dem mittelhochdeutschen Begriff der êre beschäftigt, seine Bedeutung für die höfische Lebenswelt der Ritter dargestellt und untersucht, welche Rolle dierser in Hartmann von Aues Artusroman 'Iwein' spielt.
Der mittelhochdeutsche Begriff der ,êre‘
Dessen Bedeutung für den Artusroman Iwein Hartmanns von Aue
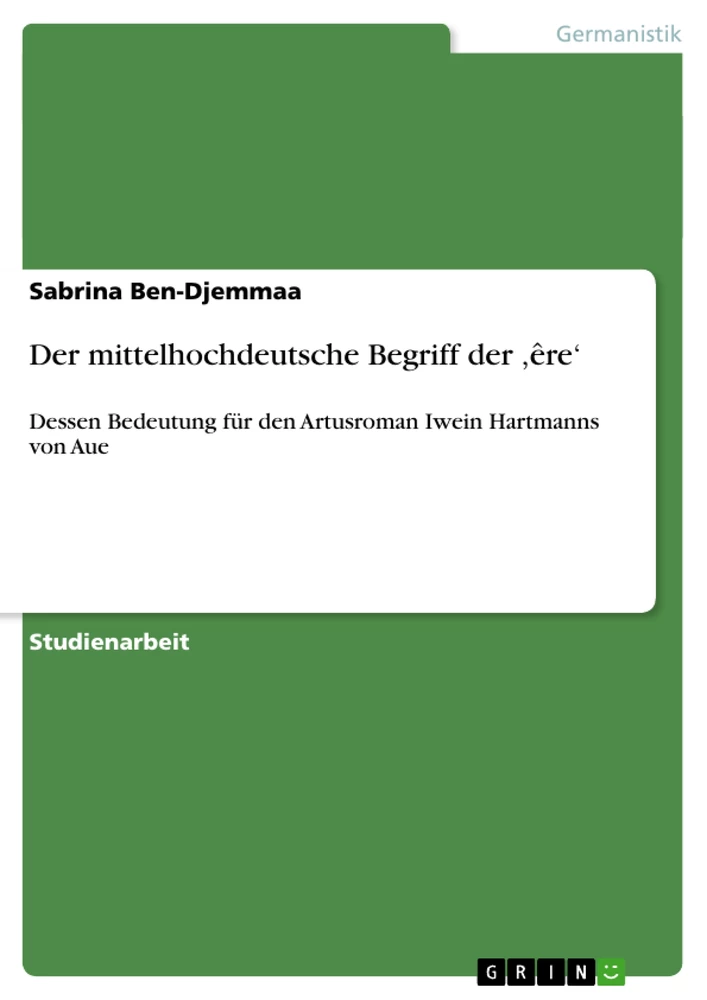
Hausarbeit , 2012 , 9 Seiten , Note: 1,7
Autor:in: Sabrina Ben-Djemmaa (Autor:in)
Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik
Leseprobe & Details Blick ins Buch