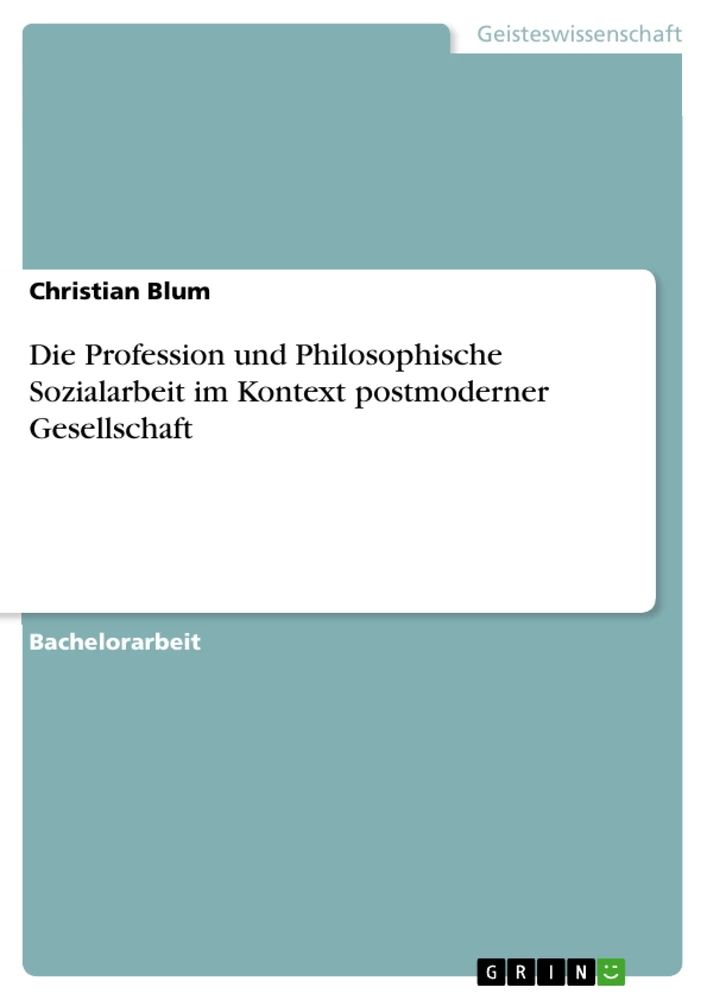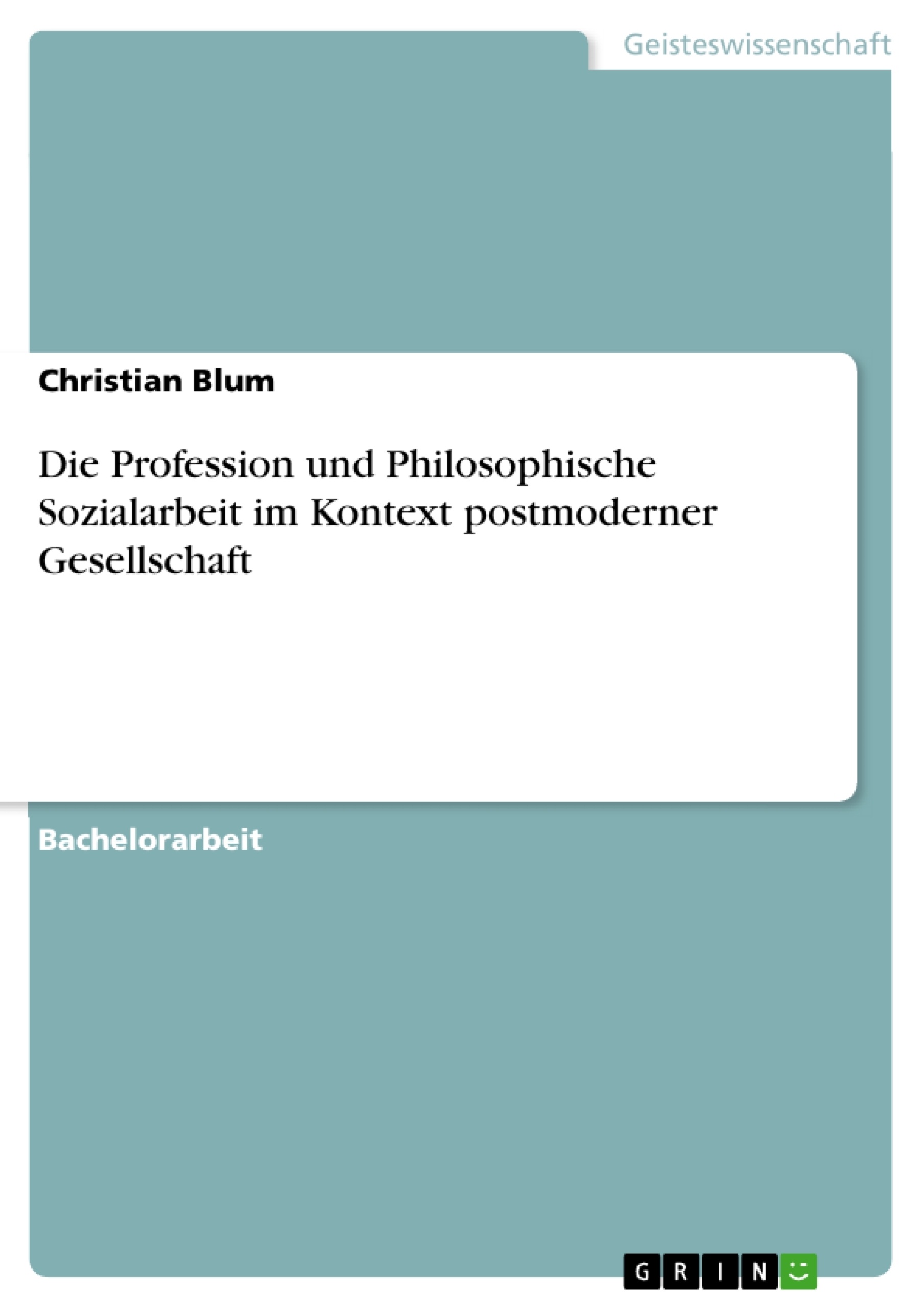In dieser Arbeit wird die Soziale Arbeit als professionelles Funktionssystem in postmodernen Gesellschaften dargestellt. Besondere Bedeutung erfährt die Entwicklung der Sozialen Arbeit zur wissenschaftlichen Profession, sowie der Einfluss der europäischen Aufklärung auf diesen Prozess. Darüberhinaus wird die Bedeutung philosophischen Denkens für gelingendes Leben erläutert. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit zwei sinnstiftenden Methoden der sozialarbeiterischen Gesprächsführung und praktischen Hinweisen zur Optimierung kommunikativer Kompetenz.
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Zentrale Fragestellung
1.2 Methodische Vorgehensweise
2 Von der Liebestätigkeit zur wissenschaftlichen Profession
2.1 Die europäische Aufklärung
2.2 Entwicklung der Sozialen Arbeit
3 Soziale Arbeit als Profession
3.1 Theorie der Postmoderne
3.2 Soziale Arbeit als postmoderne Profession nach Heiko Kleve
3.2.1 Paradoxien in der Sozialen Arbeit
3.2.2 Multifunktionalität der Sozialen Arbeit
4 Philosophische Sozialarbeit
4.1 Philosophie und Soziale Arbeit
4.1.1 Sinn wissenschaftlich betrachtet
4.1.2 „Glück und gelingendes Leben“
4.2 Philosophische Methoden in der Sozialen Arbeit
4.2.1 „Sokratische Gesprächsführung“
4.2.2 „Lösungsorientierte Beratung“
4.2.3 „MiniMax – Interventionen“
5 Schlussfolgerungen
6 Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Anhang
Eidesstattliche Erklärung