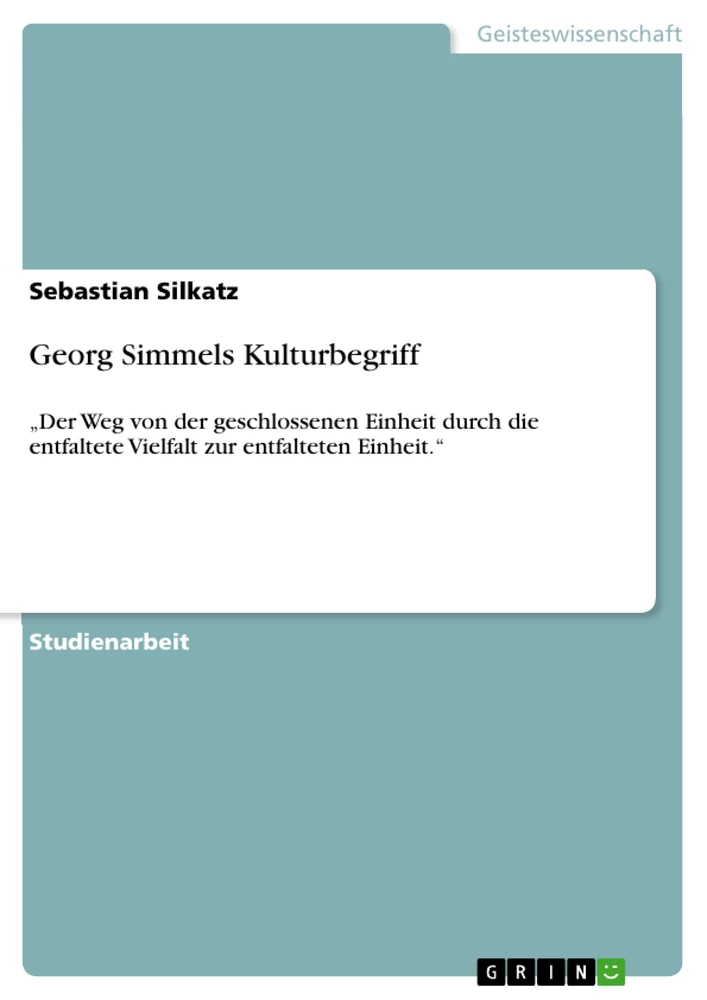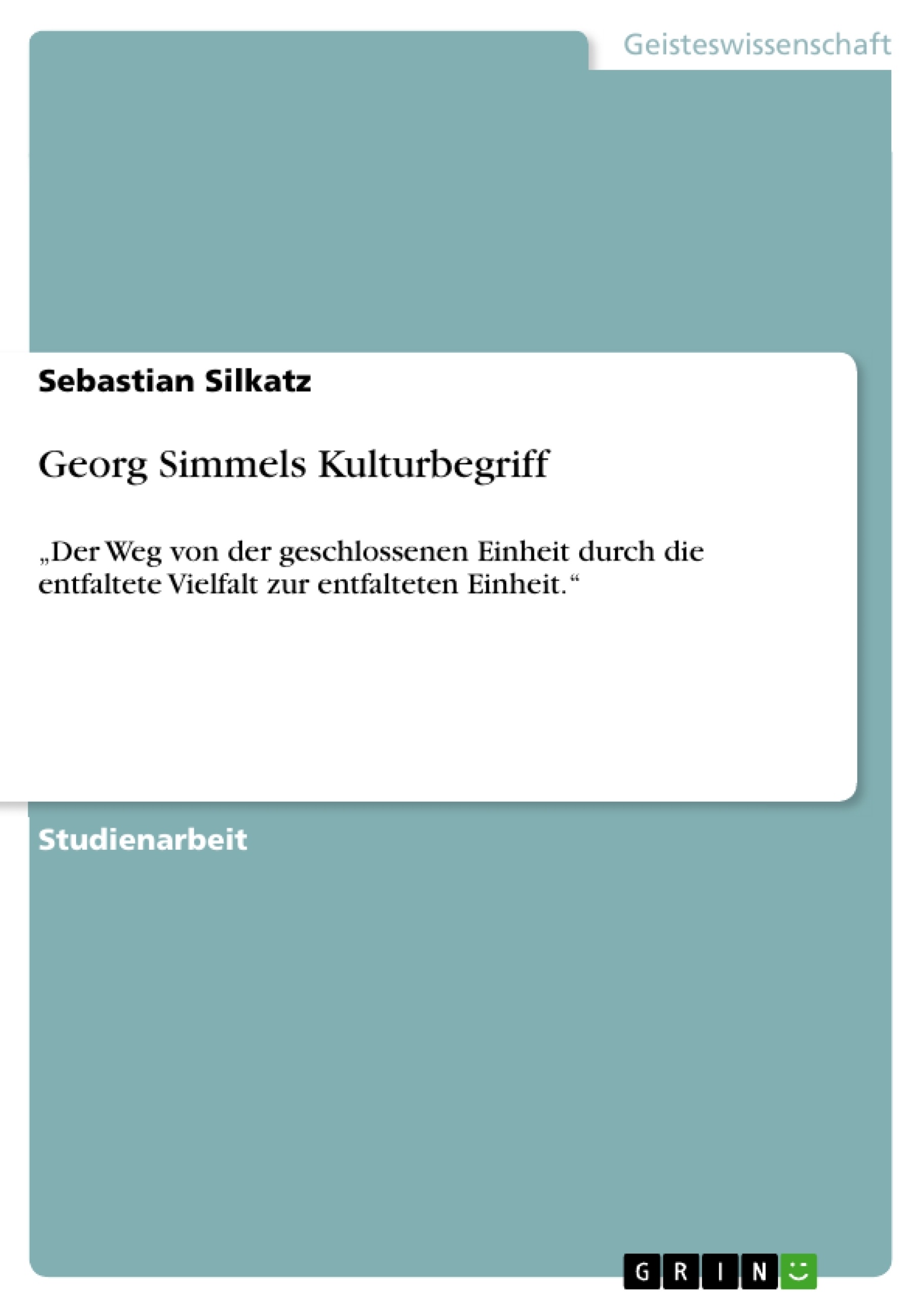Möchte man nun unter der Vielzahl von Darstellungen eine konkrete Definition von „Kultur“, so scheint die Philosophie der einzige Ausweg zu sein. Schließlich ist sie die Wissenschaft, in der das genaue Definieren von Begriffen den höchsten Stellenwert besitzt. Doch wird bei einem Blick in verschiedene philosophische Wörterbücher schnell deutlich, dass auch diese Disziplin sich schwer tut, eine eindeutige Begriffsbeschreibung zu liefern. So braucht zum Beispiel die „Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften“ zwölf Seiten um „Kultur“ zu umschreiben, ein „Historisches Wörterbuch für Philosophie“ nutzt dafür sogar fünfzehn. Lediglich das „Lexikon der philosophischen Begriffe“ begnügt sich mit zwei Seiten. Allerdings wird bei der Lektüre sehr schnell deutlich, dass damit keine umfassende Darstellung des Begriffs „Kultur“ möglich ist.
Trotz dieses anscheinenden Unvermögens eine alleingültige Definition von „Kultur“ zu liefern, gibt die Philosophie viele Möglichkeiten, sich mit dem Ausdruck auseinanderzusetzen. Zahlreiche Denker haben ihre Überlegungen und ihr Verständnis zum Begriff dargestellt.
Einer der Philosophen, die „Kultur“ definiert haben, ist Georg Simmel. Der Gelehrte hat in zahlreichen Texten sein Verständnis des Begriffes dargelegt und ihn somit zu einem Zentralbegriff seines Schaffens gemacht. Dabei beschreibt Simmel zahlreiche Aspekte von „Kultur“, stellt verschiedene Nuancen dar und stellt damit ein umfassendes Gesamtkonzept auf. Dabei besitzt bei Simmel die Darlegung seines Verständnisses des Begriffs einen ebenso hohen Stellenwert wie die Tragödie, die sich daraus ergibt. Daher sollen hier Simmels Definition von „Kultur“ sowie die daraus folgende „Tragödie der Kultur“ dargestellt werden. Dabei wird vor allem Wert darauf gelegt, das Gesamtkonzept des Philosophen deutlich werden zu lassen. Weitere Aspekte und ihre Einflüsse werden zwar zusätzlich erwähnt, können aber aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht ebenso ausführlich dargestellt werden. Im Anschluss an die Darstellung von Simmels Auffassung von „Kultur“ und deren Tragödie wird mit einem Fazit die Darstellung über Georg Simmel Kulturbegriff abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Georg Simmels Kulturbegriff
3. Die Tragödie der Kultur
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis