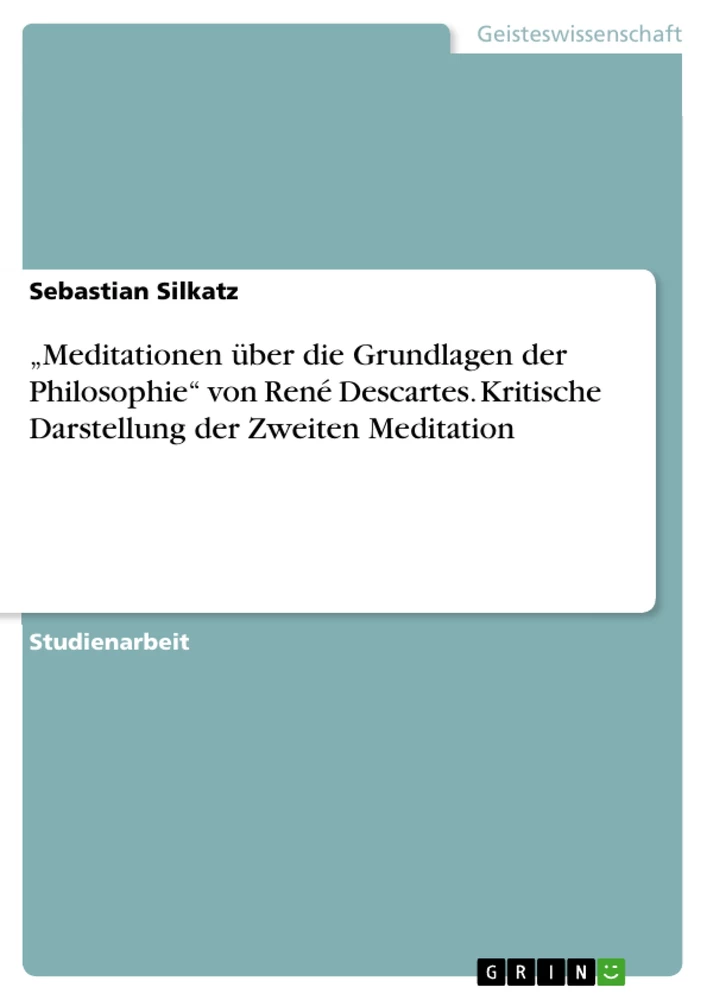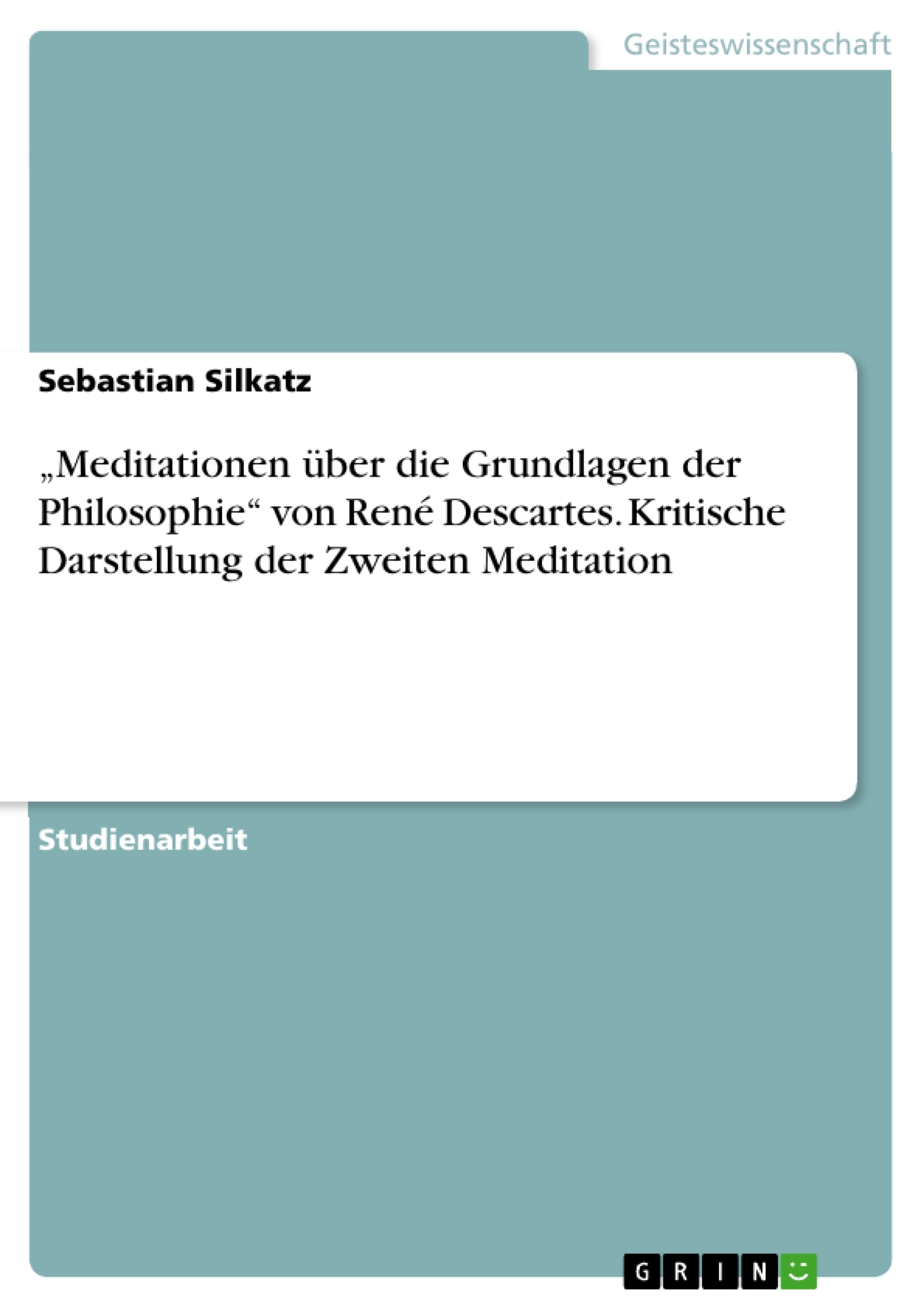Der am 31. März 1596 in La Haye/Touraine geborene René Descartes gilt als Begründer des modernen Rationalismus. Als er am 11. Februar 1650 in Stockholm stirbt, hinterlässt er zahlreiche Werke, die bis in die Gegenwart das philosophische Denken mitbestimmen. Dazu zählen unter anderem die „Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Wahrheitsforschung“, „Die Leidenschaften der Seele“ oder auch „Über den Menschen“.
Zu den bedeutendsten Schriften des großen Denkers zählen jedoch die 1641 erschienenen „Meditationen über die Grundlagen der Philosophie“. Dieses Werk ist in sechs Meditationen gegliedert und behandelt Themen der Metaphysik und der Erkenntnistheorie. Die vorliegende Arbeit möchte den Argumentationsverlauf der Zweiten Meditation kritisch darstellen. Daher zunächst eine Zusammenfassung der Ersten Meditation.
In diesem ersten Kapitel mit dem Titel „Woran man zweifeln kann“ bedient sich Descartes des Methodischen Zweifels. In drei Stufen soll dabei sicheres Wissen ermittelt werden. Zunächst untersucht Descartes seine kognitive Grundlage und erkennt, dass er alle Einsichten aufgrund der Sinne gemacht hat. Aus eigenem Erfahren gibt Descartes allerdings zu bedenken, dass die Sinne täuschen können und ihnen daher nicht immer vertraut werden darf.
Im folgenden Schritt überprüft Descartes dann den kognitiven Zustand eines Menschen und muss feststellen, dass nicht eindeutig zwischen Wachzustand und Schlaf unterschieden werden kann. Demzufolge muss bezweifelt werden, ob dann, wenn uns die Wahrnehmung suggeriert, ein Gegensand der Außenwelt sei gegeben, ein solcher auch vorhanden ist.
Als umfassendste Stufe des Zweifels untersucht Descartes die kognitive Autonomie einer Person. Laut diesen Überlegungen ist es möglich, dass ein böser Geist uns in allem täusche. Da dies zunächst nicht widerlegt wird, müssen wir alles anzweifeln, inklusive der eigenen Existenz und des eigenen Körpers.
Als Weiterführung dieser ersten Überlegungen fügt Descartes nun die Zweite Meditation an, in deren Verlauf eine Argumentation formuliert wird, die in dem wohl berühmtesten aller philosophischen Sätze zusammengefasst werden kann: „Cogito ergo sum“; ich denke, also bin ich. In der folgenden Arbeit wird der Argumentationsverlauf dieser Meditation kritisch dargestellt, um unter anderem zu erläutern, mit welchen Überlegungen Descartes zu dieser Erkenntnis gelangte und welche weiterführenden Konsequenzen sich daraus ergeben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Meditation „über die Natur des menschlichen Geistes, dass seine Erkenntnis Ursprünglicher ist als die des Körpers“
2.1 Das „cogito ergo sum“
2.2 Das Zweifelsargument
2.3 Über die Erkenntnis von Körpern
3. Zusammenfassung
4. Literaturverzeichnis