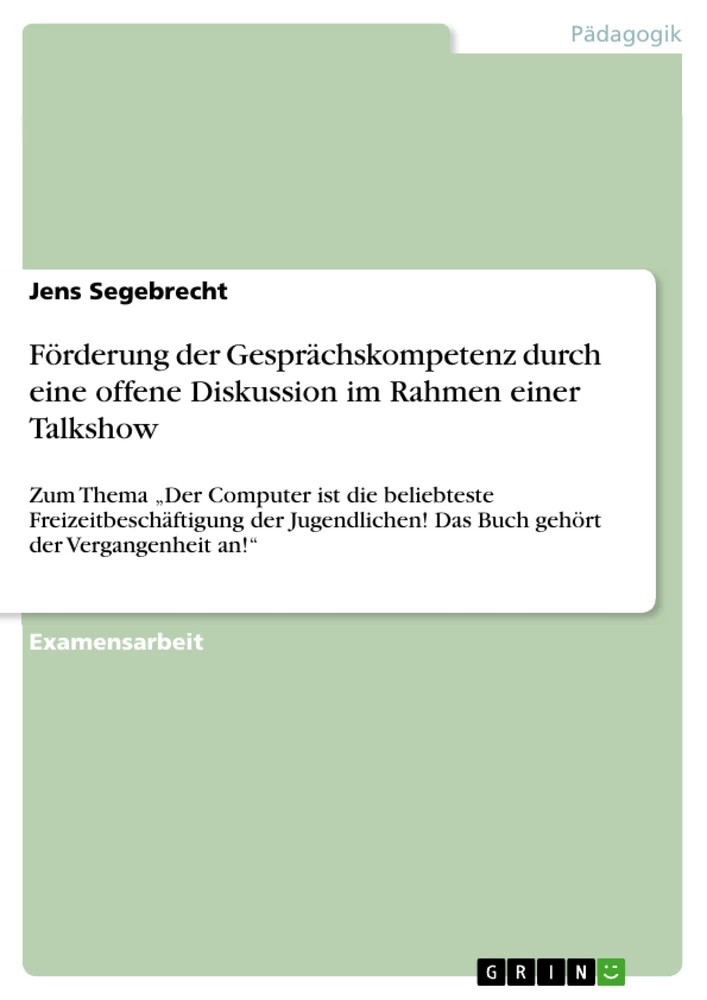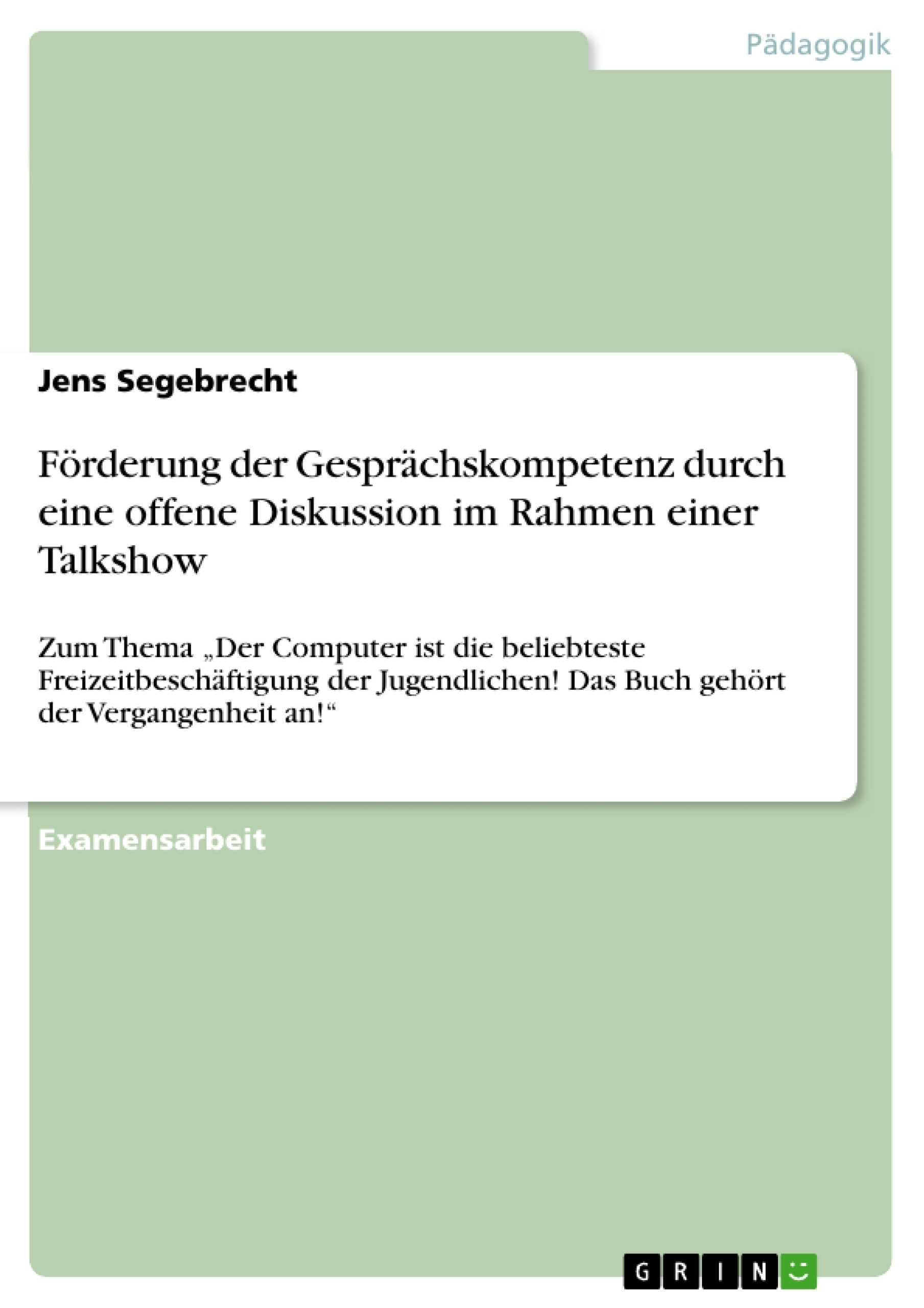Den Deutschunterricht in der Klasse 7b am xxx habe ich zu Beginn des laufenden Schuljahres
übernommen. Die Klasse setzt sich inzwischen aus 7 Schülerinnen und 10 Schülern
zusammen. Die Anzahl der Jungen überwiegt, dies hat jedoch keinen signifikanten Einfluss
auf das Klassenklima. Nach einer anfänglichen Phase des Kennenlernens, welche von einer
größeren Zurückhaltung bezüglich der Mitarbeit begleitet wurde, hat sich im Verlaufe des
Schuljahres ein angenehmes Lernklima entwickelt. Allerdings zeigen einige Schülerinnen und
Schüler ein noch nicht hinreichend ausgeprägtes Sozialverhalten auf.
In diesem Zusammenhang kommt einer entwickelten Gesprächskompetenz als
Basiskompetenz und wichtigster Teil der sozialen Kompetenz 1 eine Sonderrolle zu.
Gleichwohl ist sie bedeutsam für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler in anderen
Fächern. Hier pädagogisch einzuwirken, beispielsweise durch das Aufstellen von
Gesprächsregeln, bleibt ein grundsätzliches Anliegen, um somit dem Ziel einer positiven
Lernatmosphäre dauerhaft gerecht zu werden. Weiterhin wurden gemeinsam Formulierungen
erarbeitet, um ein besseres und variableres sprachliches Ausdrucksvermögen zu schulen.
Darüber hinaus werden auch kontinuierlich Situationen geschaffen, in denen sich die
Schülerinnen und Schüler in kontroverse Diskussionen begeben können. Eine hohe
Schüleraktivität wird dadurch hergestellt, weil die zu besprechenden Themen von den
Schülerinnen und Schüler nach demokratischen Kriterien bestimmt werden. Damit ist ein
Lebensweltbezug realisiert. Darüber hinaus gehören wöchentliche Buchpräsentationen zum
didaktisch-pädagogischen Repertoire. Geweckt werden soll mittels dieser vielgestaltigen
Herangehensweise das Interesse und die Lust am Umgang mit dem jeweiligen
Unterrichtsinhalt. Die Wahl der Methode ist aber stets lernzielorientiert. Insgesamt beteiligt sich am mündlichen Unterrichtsgeschehen das Gros der Schülerinnen und
Schüler aktiv, auch mit qualitativ guten Beiträgen. Gezielte Impulsfragen sind selten
notwendig, um dem Unterrichtsgeschehen einen ergiebigen Kommunikationsrahmen zu
geben. Dass Deutschunterricht auch von der gedanklichen Auseinandersetzung lebt, also dem
Besprechen von Texten auf einer Metaebene, wird den Schülerinnen und Schülern
zunehmend bewusst. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Bedingungsanalyse
2. Sachanalyse
3. Didaktische Analyse
3.1 Beziehungen zum Rahmenplan
3.2 Exemplarische Bedeutung
3.3 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung
3.4 Reduktion
3.5 Strukturierung der Unterrichtseinheit
4. Ziele in den Kompetenzbereichen
5. Methodische Überlegungen
Anhang