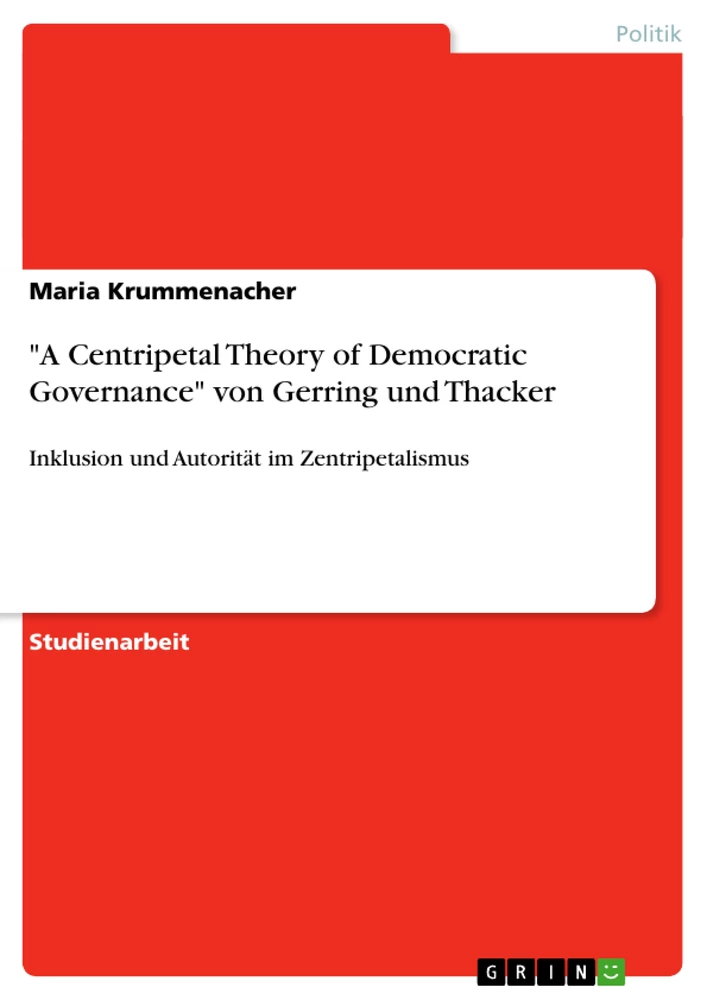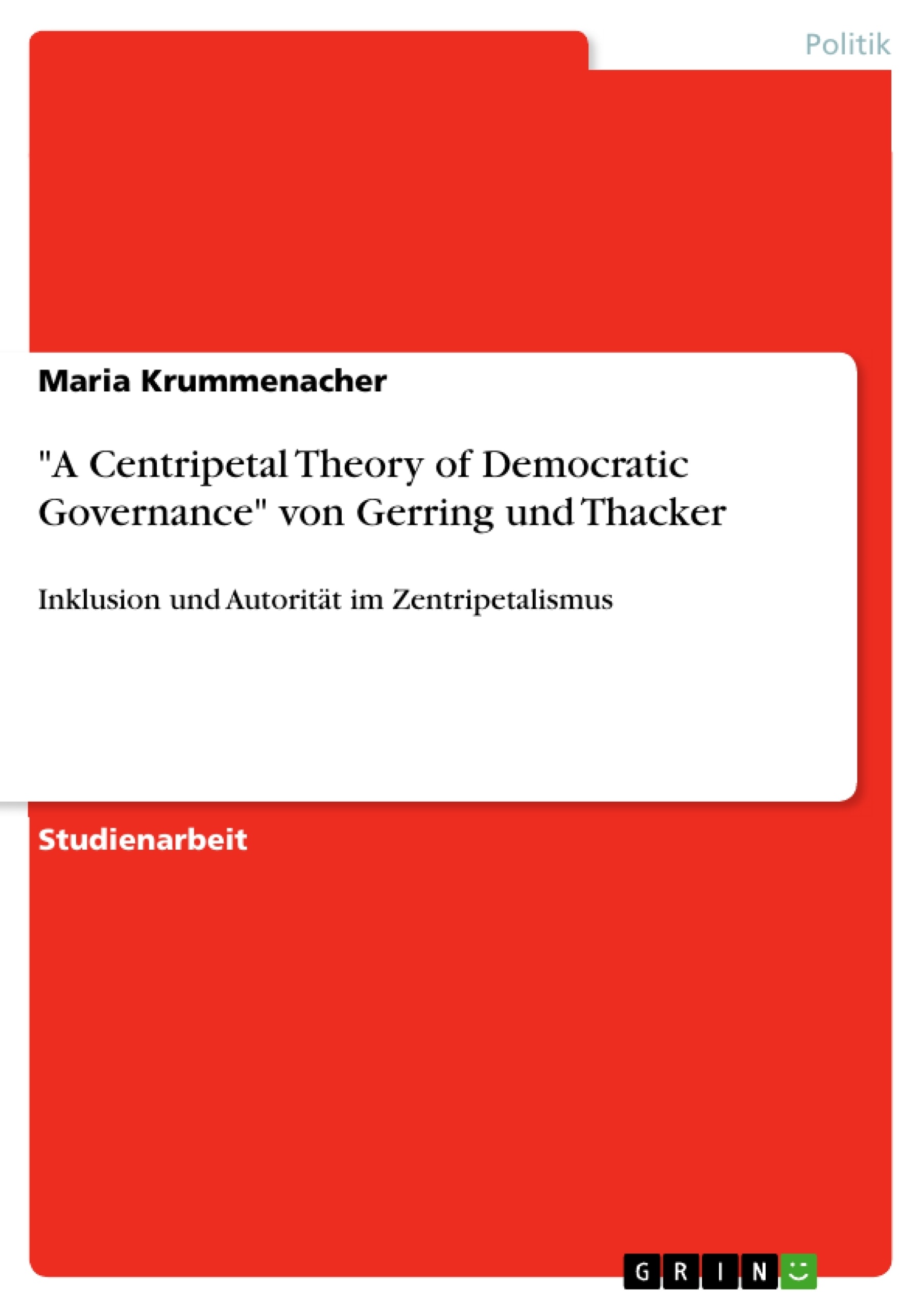Was macht eine gute Regierung aus? Worauf stützt sich der Eindruck, dass manche Länder besser regiert werden als andere? Diese Fragen stellen sich John Gerring und Strom C. Thacker in ihrem Buch „A Centripetal Theory of Democratic Governance“.
Gerring und Thacker formulieren eine Theorie, die erklärt, weshalb das Zusammenspiel verschiedener Institutionen vom gleichen Typ zu besserer bzw. schlechterer Regierungsleistung führt. Ihrer Meinung nach sind sogenannte zentripetale Institutionen am besten dazu geeignet, gute Regierungsleistung zu erzielen und sich positiv auf die Qualität einer Demokratie auszuwirken. Die Grundprinzipien des Zentripetalismus sind Inklusion und Autorität. Inklusion garantiert, dass alle gesellschaftlichen Interessen und Identitäten in den politischen Prozess eingebunden werden, während die staatliche Autorität effektive Mechanismen bereitstellt, mit denen Entscheidungen gefällt und Politiklösungen implementiert werden.
Die Fragestellung, der in dieser Hausarbeit nachgegangen werden soll, ist, ob sich im zentripetalen politischen Prozess ein Missverhältnis zwischen den zwei Prinzipien zeigt. Es wird die These aufgestellt, dass den Prinzipien Inklusion und Autorität nicht zu jeder Zeit in gleichem Masse Genüge getan werden kann. Möchte eine Regierung handlungsfähig sein, muss an einem Punkt die Inklusion zu Ende sein und die Autorität beginnen.
Es wird zuerst das Argument von Gerring und Thacker möglichst kurz und präzise zusammengefasst, daran anschließend werden die Effekte der drei zentripetalen Institutionen im Hinblick auf die Prinzipien Inklusion und Autorität analysiert und zum Schluss wird die oben genannte Fragestellung nach dem Verhältnis der beiden Prinzipien im Zentripetalismus beantwortet und diskutiert, welche Implikationen sich daraus für die Theorie ableiten lassen. Die Arbeit wird sich vor allem auf die Ausführungen in den Kapiteln zwei, drei und vier des Buches konzentrieren, in denen Gerring und Thacker ihr Kausalmodell darlegen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Argument von Gerring und Thacker
3. Inklusion und Autorität
3.1 Parteienregierung
3.2 Konfliktmediation
3.3 Politikkoordination
3.4 Verhältnis der Prinzipien
4. Fazit
5. Quellenverzeichnis
5.1 Primärquelle
5.1 Sekundärquellen
1. Einleitung
Was macht eine gute Regierung aus? Worauf stützt sich der Eindruck, dass manche Länder besser regiert werden als andere? Diese Fragen stellen sich John Gerring und Strom C. Thacker in ihrem Buch „A Centripetal Theory of Democratic Governance“ (1)[1]. Das Buch ist die Synthese mehrerer einzelner Zeitschriftenartikel und Konferenzbeiträge, die von den Autoren zwischen 2004 und 2008 veröffentlicht wurden und die auf die eine oder andere Weise das Buchthema beleuchten und die empirischen Tests vorwegnehmen.[2]
Um die Fragen nach guter Regierung zu beantworten, konzentrieren sich die Autoren auf die Rolle von politischen Institutionen für die Schaffung von „good governance“, ein normatives Konzept, das in dieser Arbeit mit guter Regierungsleistung übersetzt wird (1). Gerring und Thacker entscheiden sich für die Output-Betrachtung von Regierungsleistung und versuchen, die unterschiedliche Performanz demokratischer Staaten mit den Effekten politischer Institutionen zu erklären (2). Die Autoren beschränken sich auf die Betrachtung von Staaten, die einer Minimaldefinition von Demokratie genügen (1). Gerring und Thacker formulieren eine Theorie, die erklärt, weshalb das Zusammenspiel verschiedener Institutionen vom gleichen Typ zu besserer bzw. schlechterer Regierungsleistung führt. Ihrer Meinung nach sind sogenannte zentripetale Institutionen am besten dazu geeignet, gute Regierungsleistung zu erzielen und sich positiv auf die Qualität einer Demokratie auszuwirken. Die Grundprinzipien des Zentripetalismus sind Inklusion und Autorität. Inklusion garantiert, dass alle gesellschaftlichen Interessen und Identitäten in den politischen Prozess eingebunden werden, während die staatliche Autorität effektive Mechanismen bereitstellt, mit denen Entscheidungen gefällt und Politiklösungen implementiert werden. Damit sind Inklusion und Autorität Zwillingsziele, die maximiert werden müssen, damit zentripetale Institutionen ihre positive Wirkung auf die Regierungsleistung entfalten können (117). Die Fragestellung, der in dieser Hausarbeit nachgegangen werden soll, ist, ob sich im zentripetalen politischen Prozess ein Missverhältnis zwischen den zwei Prinzipien zeigt. Es wird die These aufgestellt, dass den Prinzipien Inklusion und Autorität nicht zu jeder Zeit in gleichem Masse Genüge getan werden kann. Möchte eine Regierung handlungsfähig sein, muss an einem Punkt die Inklusion zu Ende sein und die Autorität beginnen.
Im Folgenden wird zuerst das Argument von Gerring und Thacker möglichst kurz und präzise zusammengefasst, daran anschließend werden die Effekte der drei zentripetalen Institutionen im Hinblick auf die Prinzipien Inklusion und Autorität analysiert und zum Schluss wird die oben genannte Fragestellung nach dem Verhältnis der beiden Prinzipien im Zentripetalismus beantwortet und diskutiert, welche Implikationen sich daraus für die Theorie ableiten lassen. Die Arbeit wird sich vor allem auf die Ausführungen in den Kapiteln zwei, drei und vier des Buches konzentrieren, in denen Gerring und Thacker ihr Kausalmodell darlegen.
2. Das Argument von Gerring und Thacker
Gerring und Thacker entwickeln die Theorie des Zentripetalismus in Abgrenzung zum Dezentralismus. Die vorherrschende politikwissenschaftliche Meinung ist, dass die besten Regierungen diejenigen mit einer möglichst breiten Gewaltenteilung und möglichst dezentralisierten Institutionen sind. Je mehr unabhängige, sich gegenseitig kontrollierende und in Schach haltende politische Institutionen, desto besser (2). Viele Vetospieler führen dazu, dass dezentralistische Systeme eher auf Beständigkeit denn auf Wandel ausgerichtet sind (8). Für Gerring und Thacker ist dies ein Zeichen von Schwäche und schlechter Regierung. Ein dezentralistisches System ermöglicht es den Teilen des Politikapparates, sich gegenseitig zu blockieren. Die Anreizstrukturen der dezentralistischen Institutionen bringen die politischen Akteure dazu, ihre Partikularinteressen zu verfolgen. Gute Regierungsleistung hingegen entsteht nach Gerring und Thacker aus Institutionen, die Macht schaffen und im Zentrum konzentrieren. Zentripetale Institutionen entwickeln die politischen Fähigkeiten einer Gesellschaft und ermöglichen es ihren Mitgliedern, im Sinne der Theorie der deliberativen Demokratie, gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen und diese zu implementieren (9/19). Um die Inklusion aller gesellschaftlichen Interessen zu garantieren, sprechen sich Gerring und Thacker für das Verhältniswahlrecht zur Bestellung der nationalen Legislative aus (13-14). Die Autorität des zentripetalen Staates liegt in der Institutionalisierung gesellschaftlicher Konflikte. Die zentripetalen Institutionen aggregieren und abstrahieren die verschiedenen Interessen und Identitäten einer Gesellschaft und führen zu einer Entscheidung, die autoritär durchgesetzt wird und nicht von Minderheiteninteressen verhindert werden kann (20). Die Institutionen schaffen Strukturen und Anreize, die einerseits die politischen Akteure dazu bringen, am Entscheidungsprozess teilnehmen zu wollen und andererseits während der Teilnahme deren Interessen und Ziele im Sinne des Gemeinwohls verändern (20).
Das Kausalmodell
Gerring und Thacker betrachten in ihrer Analyse drei grundlegende Institutionen, welche die politischen Strukturen und Handlungsweisen in einem Staat maßgeblich prägen und die Grundbedingungen der Politik bestimmen. Sie stehen am Anfang der vorgestellten Kausalkette und sind somit bis zu einem gewissen Grad exogen (21). Die grundlegenden Institutionen sind der Staatsaufbau, die Regierungsstruktur und das Wahlsystem eines Staates. Die zentripetalen Ausprägungen dieser Institutionen in demokratischen Systemen sind Unitarismus, Parlamentarismus und Verhältniswahl mit geschlossenen Listen. Jede dieser drei Institutionen beeinflusst das politische System in einer solchen Weise, dass die Ziele Inklusion und Autorität erreicht werden. Es handelt sich hierbei also gerade nicht um einen Kompromiss zwischen Inklusion und Autorität. Gerring und Thacker gehen davon aus, dass die zentripetalen Institutionen mit der Regierung einen einzigen souveränen Fokussierungspunkt für die verschiedenen Interessen und Akteure in einer Gesellschaft schaffen (Gerring/Thacker 2005, 270). Die pyramidale Struktur des Politikprozesses garantiert die breite Inklusion aller Gesellschaftsteile. Die Pyramide ist an ihrer Basis weit und kann viele unterschiedliche Interessen und Akteure aufnehmen. Mit jedem Schritt in Richtung Spitze findet eine Aggregierung und Abstrahierung der Interessen statt (Gerring/Thacker 2005, 270). Die drei wichtigsten Effekte der zentripetalen Institutionen sind die Entwicklung einer demokratischen Parteienregierung mit starken Parteien, die Verbesserung der Konfliktmediation innerhalb einer Gesellschaft und die Verbesserung der Politikkoordination unter den verschiedenen politischen Akteuren und Organen (21-23). Wie diese Komponenten die Prinzipien Inklusion und Autorität sicherstellen, folgt in Kapitel 3.
[...]
[1] Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich alle in Klammern angegebenen Seitenzahlen auf dieses Buch.
[2] Vrgl. Gerring und Thacker 2004, 2005, 2007 und 2008. Genaue Quellenangaben im Quellenverzeichnis.