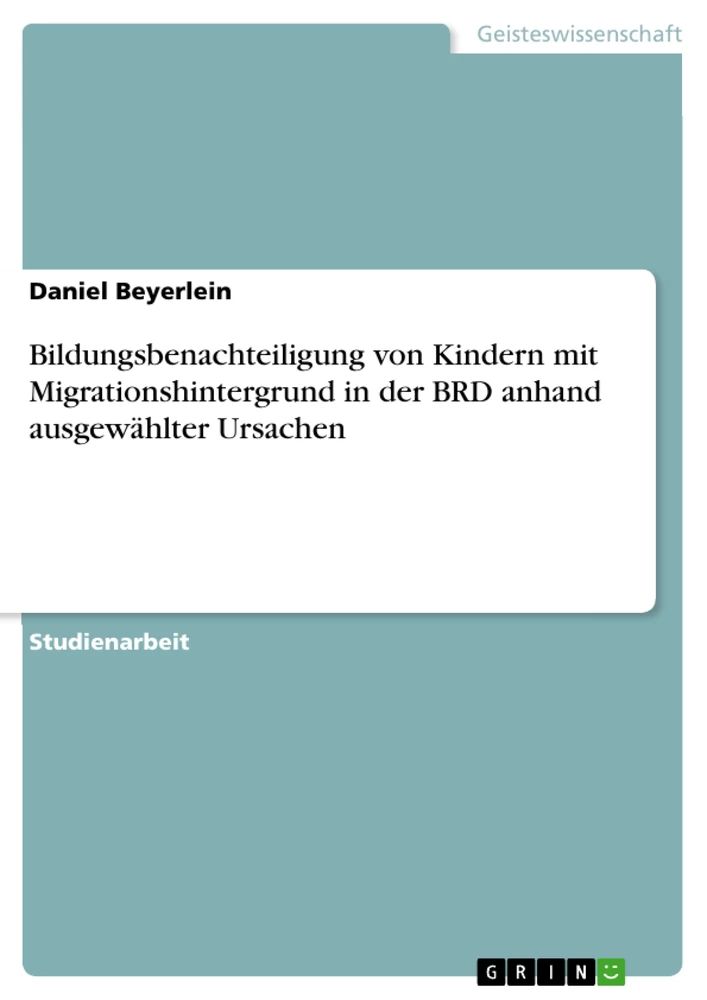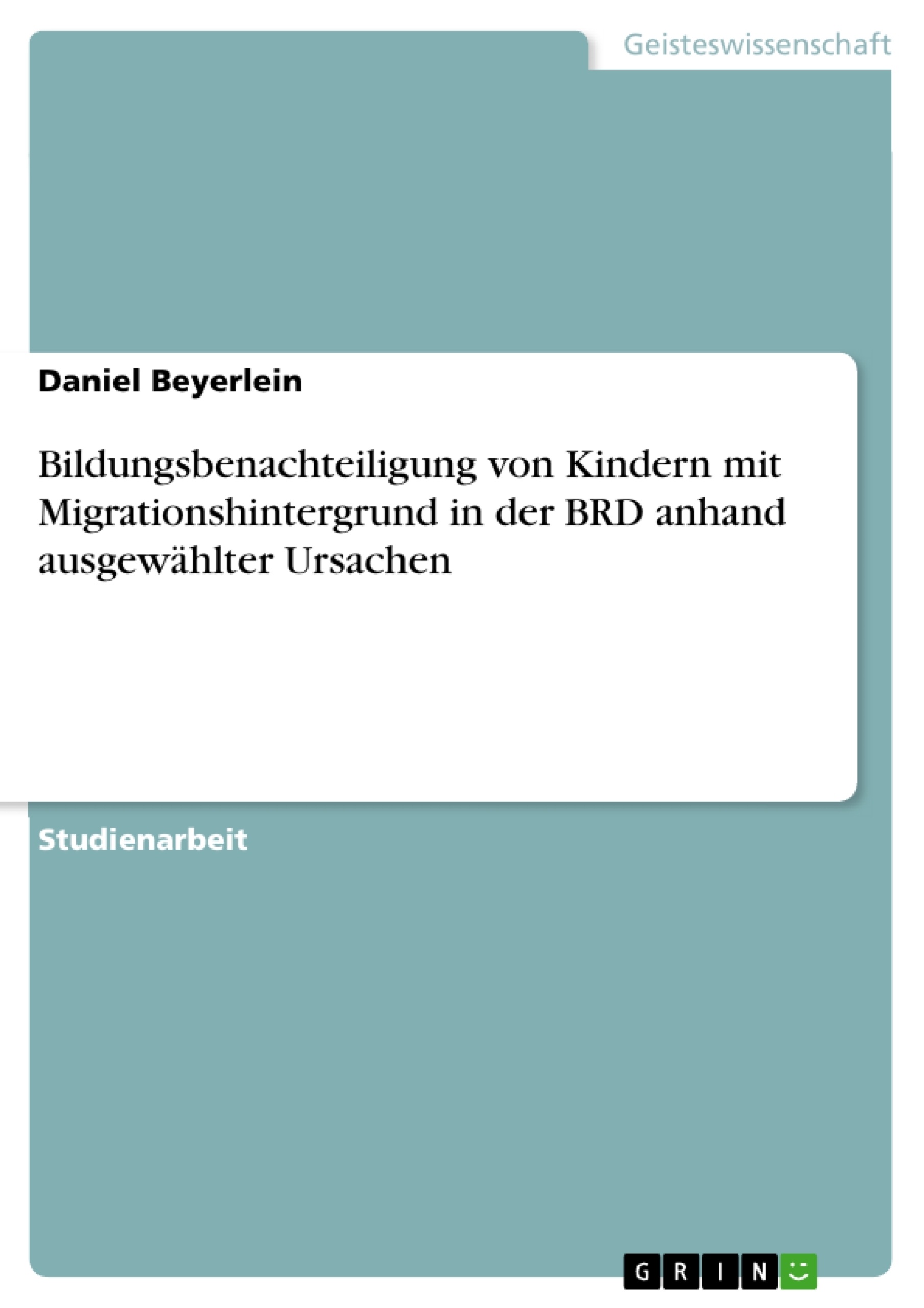Die Basis zur Erlangung des somit nötigen Bildungskapitals stellt neben den ersten Sozialisationsinstanzen Familie und Kindergarten der Schulbesuch dar. Sowohl der Schulbesuch als auch die Institution Schule an sich ist rechtlich sowie gesetzlich verankerte Grundlage und gilt somit für alle in der Bundesrepublik lebenden Menschen gleichermaßen. Daher verwundert es, dass Stimmen nach „Bildung für alle“ laut werden und Forderungen dahingehend artikuliert werden.
Der Grund für diese Forderung sind die über Jahre anhaltenden, im internationalen Vergleich nicht gerade positiven Ergebnisse im PISA-Test. An diesen Diskussionspunkt schließt sich ein weiteres, für diese Arbeit maßgebliches Problemfeld an. Die Rede ist hier von dem signifikant geringeren schulischen Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der BRD im Vergleich zu den Kindern ohne Migrationshintergrund. Diefenbach beispielsweise äußert ihre Bedenken in der Unfähigkeit des deutschen Bildungssystems, Minderheiten in gerade eben dieses erfolgreich zu integrieren. Dies mag vorerst zutreffend sein, doch darf der, in der gängigen Literatur oftmals verwendete Begriff der Minderheiten in keinster Weise unterschätzt bzw. fehlinterpretiert werden. Aus dem Grund, da laut BAMF die Zuwanderungen in die BRD seit 2010 massiv zugenommen haben. 2011 konnte sogar ein Zuwachs von einem Drittel mehr gegenüber 2010 erreicht werden mit einem Wanderungssaldo von „+302858“ Menschen in 2011 in der BRD.
Dieser Wanderungssaldo beinhaltet Entwicklungspotential für Deutschland. Entwicklungspotential, welches gefördert werden muss. Förderung allerdings wird erst dann möglich, wenn Erklärungsursachen für bestehende Nachteile für Schüler mit Migrationshintergrund ausfindig gemacht werden und auf deren Basis sinnvolle Ansätze zur Entgegenwirkung der bestehenden Nachteile entwickelt werden können, um sie anschließend auch erfolgreich umsetzen zu können. Um diese spezifische Bildungsproblematik erarbeiten zu können, bietet es sich vorerst an, einen Überblick, das deutsche Bildungssystem betreffend zu schaffen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Das deutsche Bildungssystem im Überblick
3. Bildungchancen von Kindern mit Migrationshintergrund anhand PISA
4. Ursachenklärung der Bildungsungleichheiten anhand ausgewählter Bereiche
4.1 Institutionelle Diskriminierung im deutschen Bildungssystem
4.2 Die defizitäre Schlüsselrolle Sprache
5. Förderungsansätze für Kinder mit Migrationshintergrund
6. Fazit