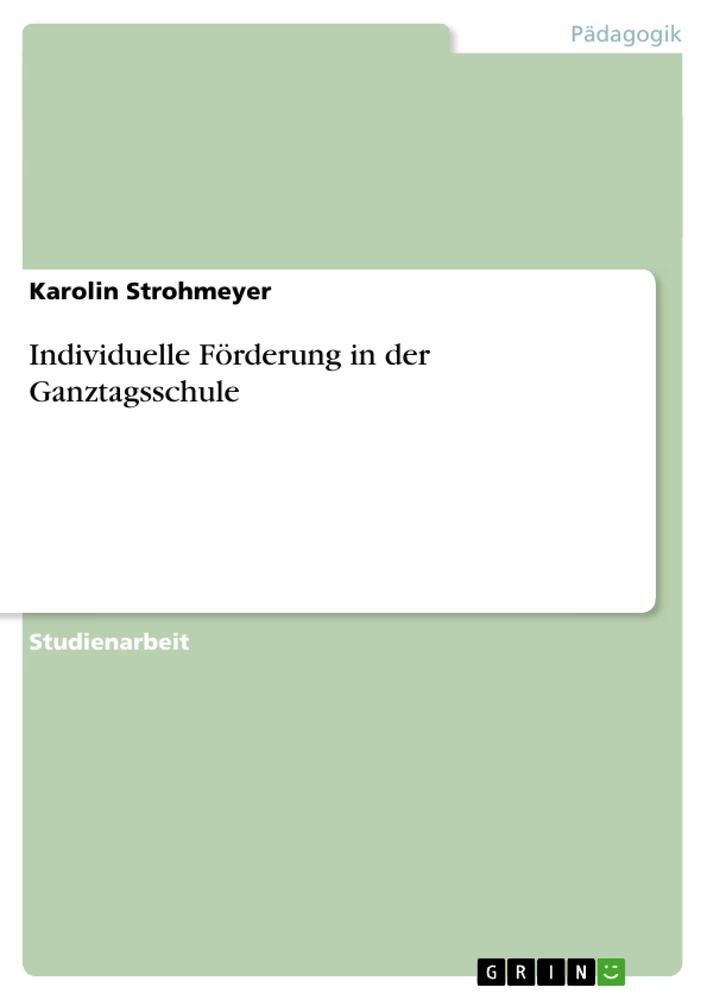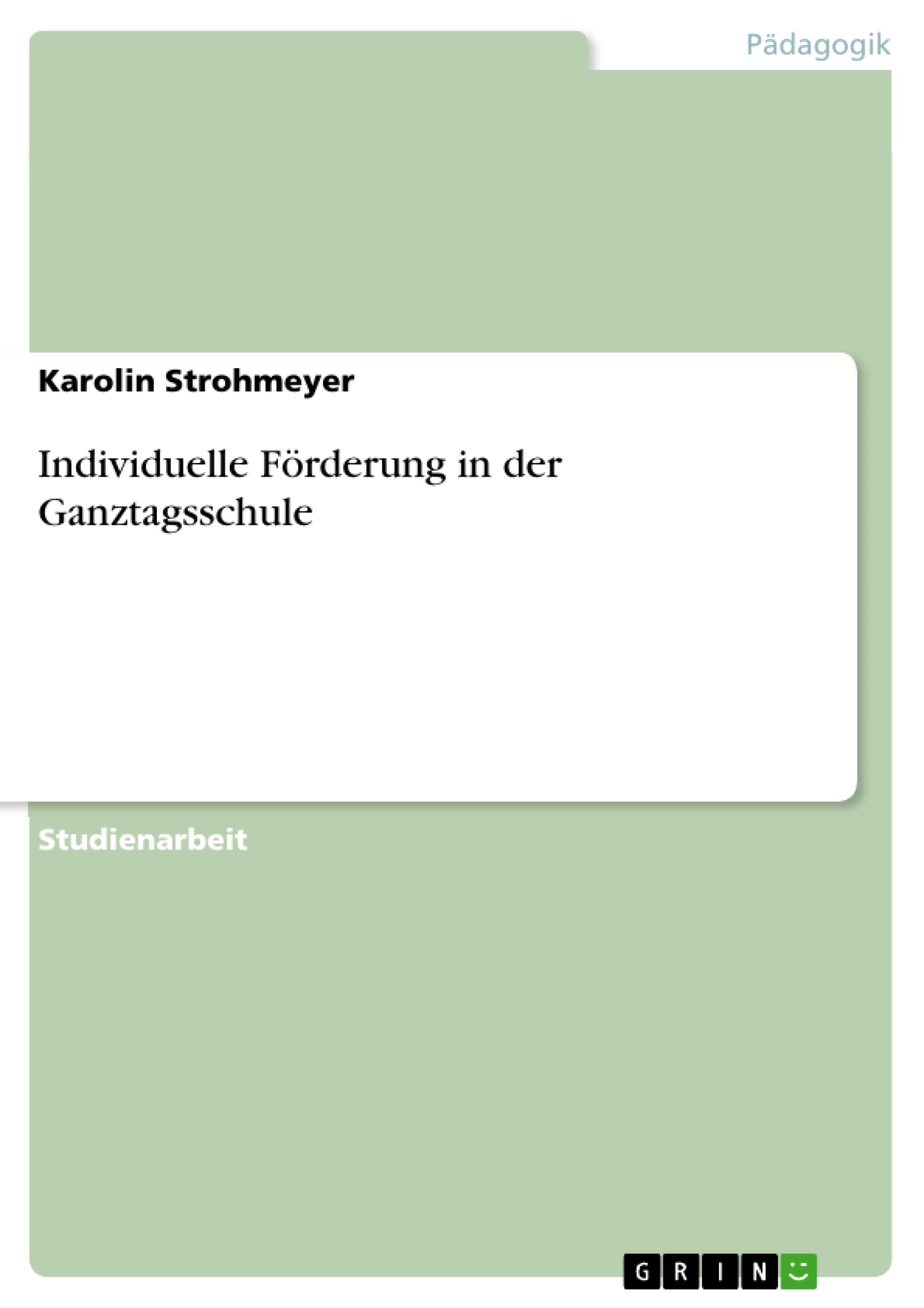Veränderte Bedingungen in Deutschland lassen Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit anders aufwachsen. Die Forderung nach neuen Bildungs- und Erziehungsaufträgen der Schule wird immer lauter – insbesondere durch das eher mittelmäßige bis schlechte Abschneiden der Schüler in den letzten Jahren bei der international vergleichenden PISA-Studie. Gründe wurden im Halbtagsschulsystem gesucht, das eher schwachen Schülern und besonders Kindern und Jugendlichen aus sozialen und familiären Brennpunkten keine Chance eröffnet, ihre schulischen Defizite selber abzuarbeiten. Vor allem der Aspekt der individuellen Förderung in neuen Ganztagsschulen scheint immer wichtiger zu werden. Die Bedingungen für individuelle Förderung sind klar: „neben personenbezogenen Merkmalen wie Empathie und Engagement sind […] insbesondere fachbezogene Kompetenzen wie Methoden-, Diagnose und Kommunikationskompetenz sowie fachbezogenes und handlungsleitendes Metawissen unerlässlich.“ Welche besonderen Chancen bietet die Ganztagsschule für die individuelle Förderung? Dieser Frage möchte die vorliegende Arbeit auf den Grund gehen. Dabei wird zunächst die individuelle Förderung mit den Schwerpunkten Selbstkompetenzentwicklung, ganzheitliches Lernen, Heterogenität und Integration in den Blick genommen. Auf die Vorstellung der Definition von Ganztagsschule folgt dann die Schilderung der Aspekte für eine effektive Ganztagsschule unter besonderer Herausarbeitung der Möglichkeiten, die sich auch durch Kooperation mit externen Mitarbeitern für die individuelle Förderung ergeben können. Abschließend werden einige Studien und Erfahrungsberichte für die Erstellung eines Fazits herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Individuelle Förderung
2.1 Der ganze Mensch – Selbstkompetenz
2.2. Heterogenität
2.3 Das ganzheitliche Lernen
2.4 Integration
3. Die Ganztagsschule
3.1 Forderungen nach Ganztagsschulen
3.2 Aspekte für eine effektive Ganztagsschule
3.3. Kooperation
3.4 Förderkonzepte in Ganztagsschulen
4. Studien und Erfahrungsberichte
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
Veränderte Bedingungen in Deutschland lassen Kinder und Jugendliche in der heutigen Zeit anders aufwachsen. Die Forderung nach neuen Bildungs- und Erziehungsaufträgen der Schule wird immer lauter – insbesondere durch das eher mittelmäßige bis schlechte Abschneiden der Schüler in den letzten Jahren bei der international vergleichenden PISA-Studie. Gründe wurden im Halbtagsschulsystem gesucht, das eher schwachen Schülern und besonders Kindern und Jugendlichen aus sozialen und familiären Brennpunkten keine Chance eröffnet, ihre schulischen Defizite selber abzuarbeiten. Schülerinnen und Schüler[1] sollen von Anfang an gleiche Chancen auf gute Bildung bekommen, sowie schulische Betreuung, einen guten Abschluss, Zuwendung, Engagement u.v.m. Vor allem der Aspekt der individuellen Förderung in neuen Ganztagsschulen scheint immer wichtiger zu werden. Die Bedingungen für individuelle Förderung sind klar: „neben personenbezogenen Merkmalen wie Empathie und Engagement sind […] insbesondere fachbezogene Kompetenzen wie Methoden-, Diagnose und Kommunikationskompetenz sowie fachbezogenes und handlungsleitendes Metawissen unerlässlich.“[2] Welche besonderen Chancen bietet die Ganztagsschule für die individuelle Förderung? Dieser Frage möchte die vorliegende Arbeit auf den Grund gehen. Dabei wird zunächst die individuelle Förderung mit den Schwerpunkten Selbstkompetenzentwicklung, ganzheitliches Lernen, Heterogenität und Integration in den Blick genommen. Auf die Vorstellung der Definition von Ganztagsschule folgt dann die Schilderung der Aspekte für eine effektive Ganztagsschule unter besonderer Herausarbeitung der Möglichkeiten, die sich auch durch Kooperation mit externen Mitarbeitern für die individuelle Förderung ergeben können. Abschließend werden einige Studien und Erfahrungsberichte für die Erstellung eines Fazits herangezogen.
2. Individuelle Förderung
Lernen im Unterricht und in der Schule sind letztlich immer individuelle Prozesse, die einer individuellen Förderung bedürfen. „Individuelle Förderung muss garantiertes Grundrecht eines jeden jungen Menschen sein“[3], so Marianne Demmer. Jede Schule hat die Aufgabe, jeden einzelnen Schüler zu fördern. Darunter verstehen wir „alle pädagogischen Handlungen, die mit der Intention erfolgen, die Begabungsentwicklung und das Lernen jedes einzelnen Kindes zu unterstützen, unter Aufdeckung und Berücksichtigung seines je spezifischen Potenzials, seiner je spezifischen (Lern-)Voraussetzung, (Lern-)Bedürfnisse, (Lern-)Wege, (Lern-)Ziele und (Lern-)Möglichkeiten."[4] Förderung im Allgemeinen bezieht sich somit auf mehrere Bereiche und verfolgt diverse Ziele, es werden unterschiedliche Gruppen angesprochen und die Förderung erfolgt auf abwechslungsvolle Weise mit Abdeckung unterschiedlicher Ebenen. Häufig wird der Begriff auf „unterrichtsbezogene Lernleistungen fokussiert“[5] und damit eingeschränkt. Individuelle Förderung geht jedoch von einem ganzheitlichen Lernverständnis aus, dass alle Schüler eine individuelle Förderung benötigen und erhalten, sodass sie ihre Fähigkeiten voll entfalten können und nicht zuletzt bessere Schulleistungen erzielen. Individuelle Förderung verspricht, „dass die immer schon verschiedenen Lernbedürfnisse und Lernwege der Einzelnen respektiert werden."[6] Dabei wird diese als eine 'Bildung für alle' konstituiert, die als ein Qualitätsindikator von Bildungsreformen verstanden wird. Schüler sollten Vertrauen zu sich und ihren Fähigkeiten (Selbstkompetenz, siehe auch Kapitel 2.1) gewinnen und befähigt werden, sich großen Herausforderungen zielführend zu stellen.
Gemäß dem ‚Recht auf Bildung, Schule, Berufsausbildung‘ mit den Artikeln 28 und 29 gilt „die Verpflichtung auf Verfügbarmachung und Zugänglichkeit von Bildung, aber eben auch die Forderung eine Art von Bildung anzubieten, die den unterschiedlichen Bildungsbedürfnissen von Kindern gerecht wird, sei es aufgrund von Migration, unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten, Behinderungen oder auch ganz allgemein durch die Individualität von Lernzugängen und Begabungen."[7] (Siehe dazu auch Kapitel 2.2 und 2.4.) Natürlich steht auch die individuelle Begabungsförderung im Mittelpunkt, d.h. die Entfaltung jeglicher Aspekte, die eine Begabung fördern können.
Aber auch wenn er gar nicht, weniger oder hoch begabt ist, sollte jeder Schüler das Recht auf eine individuelle Förderung „in den verschiedenen Lern- und Entwicklungsbereichen entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzungen haben."[8]
Darüber hinaus kommt es nicht nur auf Förderung als Einzelmaßnahme, sondern vielmehr auch auf „das gemeinsame Bearbeiten von Problemen in flexibel zusammengesetzten Gruppen“[9] an. Das Prinzip individuelle Förderung stellt jedoch auch eine zentrale Herausforderung für die Institution Schule und die Lehrer dar. Die meisten Lehrer sind der Ansicht, sie würden bereits individuell fördern durch differenzierte Lernangebote und individuelle Unterstützung, wie u.a. Leistungsdifferenzierung, Neigungsdifferenzierung und auch Angebote für unterschiedliche Schülergruppen (z.B. Kinder mit Migrationshintergrund oder geschlechtsspezifische Förderung). Dies beruht jedoch nur auf einer Annahme. Die individuelle Förderung beruft sich meist nur auf ein subjektives Verständnis jedes einzelnen Lehrers, welcher die Qualität je nach Zeit, Gegebenheiten und der Institution Schule auswählt. „Dabei geraten oftmals wichtige Faktoren der Begabungsentfaltung wie die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung von Selbstkompetenz in den Hintergrund"[10].
Freilich können diese Anforderungen nicht nur alleine von der Schule getragen werden – es werden institutionsübergreifende Kooperationspartner benötigt, die zusätzlich zur Schule und Familie ebenfalls „den Lebensalltag sowie Erfahrungs- und Bildungsräume der Kinder und Jugendlichen“[11] aufgreifen. Einzelne Bausteine für ein Förderkonzept bestehen schon lange, so sind Aspekte wie AG-Angebote, musisch-künstlerische Förderung, Kompetenztraining, Hausaufgabenbetreuung, Lernbüros, Sprachförderung, Berufsberatung und Profilklassen gegeben.[12] Eine direkte und individuelle Förderung besteht jedoch in Hinsicht auf die oben angeführten Aspekte in kaum einer Schule. Bietet die Ganztagsschule hier Chancen? Die wichtigsten Einflussfaktoren auf individuelle Förderung sollen zunächst stärker in den Blick genommen werden.
2.1 Der ganze Mensch – Selbstkompetenz
Schule hat mit vielen ganz unterschiedlichen Individuen zu tun. Der Schüler ist ein soziales und emotionales Wesen und in seinem Lernen und Leben auf die Mithilfe der Menschen und des ganzen sozialen Umfeldes angewiesen. Die Schule ist vormittags für das Lernen im Klassenverband zuständig, nachmittags müssen die Familien Unterstützung leisten. Infolgedessen bestehen bereits hier Leistungsunterschiede, denn individuelle Förderung am Nachmittag kann nur vom Geldbeutel und/oder den Kompetenzen der Familienmitglieder abhängig sein. In der individuellen Förderung ist auch immer eine Förderung der Selbstkompetenz eingeschlossen. Selbstkompetenz wird in der Pädagogik als eine von vier Kompetenzen (neben Sachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz)[13] beschrieben. Das eigene Handeln in verschiedenen Situationen wird durch die kognitive Repräsentation der eigenen Stärken und Schwächen beeinflusst. Im wissenschaftlichen Diskurs wird das Selbstkonzept als Wahrnehmung und Wissen der eigenen Person, d.h. „Merkmale, Fähigkeiten und Eigenschaften, [aber auch wie Stärken und Schwächen bewertet werden – die meisten Autoren unterscheiden diese Selbstbewertung/den Selbstwert vom eigentlichen Selbstkonzept], die sich eine Person zuschreibt und über die sie sich definiert, verstanden."[14] Als wichtige pädagogische Forderung an den Bildungsauftrag der Schule ergibt sich also das Erkennen eigener Stärken und Schwächen um überhaupt individuell fördern zu können. Besonders die Herausbildung eines stabilen Selbstkonzeptes jedes Kindes fördert gezielt die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Dazu zählen „die Ausbildung eines positiven Selbstkonzeptes, die Anbahnung von Kompetenzbewusstsein, ebenso wie ein möglichst produktiver Umgang mit eigenen Erfolgen und Misserfolgen auf der einen Seite und die Entwicklung selbstwertdienlicher Attribuierungen auf der anderen Seite."[15] Weiter nimmt das Selbstkonzept auch Einfluss auf viele intra- (z.B. Informationsprozesse und Motivation) und interpersonelle (z.B. Aufsuchen bestimmter Situationen) Prozesse. Es wird davon ausgegangen, dass Individuen über Kognitionen und deren Bewertungen über sich selbst verfügen. Unterschieden wird zwischen dispositionalen und situationalen Anteilen. Zu den dispositionalen Anteilen des Selbstkonzeptes zählen die verfügbaren Kognitionen über eigene Stärken und Schwächen. Die situationalen Anteile sind geprägt von der Möglichkeit, Kognitionen in den verschiedenen Situationen zu aktivieren und von den jeweiligen Herausforderungen oder Erfordernissen, die an das Individuum herangetragen werden oder denen es sich ausgesetzt fühlt. Um diese Aspekte weiterhin zu unterstützen, sollte Lernen nicht nur auf die Hauptfächer und auf Kognitives reduziert werden sondern weiter gefasst werden, um mehr Schüler mit einzuschließen und zu begeistern für Schule und Lernen. Denn „neben der Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz kommt der Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz und damit einer komplexen Handlungskompetenz eine entscheidende Rolle zu.“[16] Genau diese Erweiterung könnte in Ganztagsschulen realisiert werden (siehe Kapitel 3.2 und 3.4).
2.2 Heterogenität
Heterogenität als einzelner Aspekt bildet die Voraussetzung für eine Bildung, welche die individuellen Lernvorgänge berücksichtigt. „Die existierenden Unterschiede [sind] nicht eine Abweichung, sondern die Normalität.“[17] Die Schule muss dabei auf die ‚Vielfalt ihrer Schüler‘ reagieren, d.h. ihre Schüler auch gemäß ihrer Stärken und Schwächen fördern. Dabei dürfen nicht nur die besonders leistungsbegabten oder schwachen Schüler unterstützt werden, sondern alle Lernenden. Heutzutage erfahren Kinder schon sehr früh, was es heißt ‚nicht zum Durchschnitt zu gehören', sitzen zu bleiben oder eine Förderschulüberweisung zu bekommen. Bereits in den Grundschuljahren muss gemäß Statistiken ein Kind pro Klasse das Schuljahr wiederholen, am Ende werden sogar 4% (ca. 400.000) an die Förderschule übermittelt.[18] Der Zwiespalt für Lehrer, die ihre Schüler zum einen gleichermaßen auf ein Leistungsniveau der weiterführenden Schulen vorbereiten sollen und zum anderen aber auch ihre individuellen Bedürfnisse und Verschiedenheiten im Blick behalten und fördern sollen, stellt ein Spannungsverhältnis dar. Das Ausbalancieren von „Gleichbehandlung einerseits, Anerkennung von Differenzen andererseits ist die Basisherausforderung jeglicher Form von individueller Förderung im schulischen Kontext.“[19] Die meisten Leistungsunterschiede entstehen durch unterschiedliches Vorwissen bzw. Kenntnisse, Intelligenz, Lern- und Problemlösestrategien, strukturelle Merkmale wie z.B. soziale Herkunft (vor allem in Bezug auf Vorwissen/bisherige Kenntnisse) und nicht zu vergessen Faktoren wie Motivation, Anstrengungsbereitschaft oder auch dem Fähigkeitsselbstkonzept. Durch eine individuelle Förderung und Unterstützung der Schüler in Ganztagsschulen kann gegen diese Unterschiede vorgegangen werden. Der Begriff der Heterogenität steht dabei immer im Zusammenhang mit Differenzierung. Denn für eine individuelle heterogene Förderung werden differenzierte unterschiedliche, für jeden Schüler ansprechende Konzepte gebraucht, die nur durch eine Vielzahl an differenzierten Angeboten an der Schule gewährleistet werden können. Hier könnte die Ganztagsschule neue Wege und Möglichkeiten eröffnen (siehe Kapitel 3.3 und 3.4).
2.3 Das ganzheitliche Lernen
Unter ganzheitlichen Lernen versteht man das Lernen mit Kopf, Herz und Hand nach Johann Heinrich Pestalozzi[20]. Ganz wichtig beim ganzheitlichen Lernen ist, dass man eigene Erfahrungen macht. Denn erst durch eigene Erfahrungen werden Motivation, Individualität und Lernwillen gefördert. Der Schüler ist Akteur seiner selbst. Er möchte aktiv am Geschehen teilnehmen, welches jedoch nur durch eine ihm offenstehende Umgebung, die „ausreichend Raum zur Gestaltung seiner Kräfte [lässt]"[21], geschehen kann. Das heißt, Lernen muss von Seiten der Schüler von der Schule als lebensnah und anregend gestaltet werden, „wo Kinder und Jugendliche vielfältige Anreize und Herausforderungen finden, wo Lernen individuell bedeutsam werden kann, wo es sich mit Freude und Ansporn, mit Anstrengung und auch mit Stolz auf das Erreichte verbindet und wo die Einzelnen die Hilfe finden, die sie brauchen."[22] Schüler müssen demnach selber Erfahrungen machen, quasi zu ‚Erfindern‘ und ‚Forschern‘ werden. Jedes Lernen verläuft individuell ab. Aufgabe für den Lehrer ist es die weitere individuelle Entwicklung jedes Schülers zu unterstützen, sodass Schüler ihr eigenes Lernen zunehmend effektiver sehen, selbstständig planen und reflektieren sowie auch voneinander lernen. Für den Begriff des Lernens als aktive Erweiterung entwickelte Klaus Holzkamp den Begriff des expansiven Lernens. Dieser besagt, dass sich das lernende Subjekt der Eigenenergie bedient. Denn vom Schüler gehen die Lernimpulse aus, die in Wechselwirkung mit z.B. Texten, Bildern und Gegenständen treten. Dabei bedingen sich das Lehren und das Lernen als Lehr-Lern-Kurzschluss gegenseitig.[23] Die beste Motivation für Schüler ist dabei, dass sie im Unterricht gar nicht merken, welches Lernpensum sie im Laufe des Tages durch verschiedene Methoden aufnehmen und wie ganzheitlich (kognitiv, sozial, emotional, praktisch und ästhetisch) ihr Lernen ist. Auch hier kann die Chance der Ganztagsschule gesehen werden, die Lebenswelt der Schüler zu erweitern, den Schülern mehr Zeit einzuräumen, „den eigenen Lerngründen auf die Spur zu kommen“.[24]
[...]
[1] Aus Gründen des besseren Leseflusses wird im Folgenden grundsätzlich Schülerinnen und Schüler in der maskulinen Form Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im Maskulin Lehrer verwendet.
[2] Böttcher, Wolfgang und Liesegang, Timm: Chancen und Problematiken individueller Förderung in Ganztagsschulen. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kooperation-an-ganztagsschulen.de%2F%3Fdownload%3DAbstract%2520Boettcher%2520Liesegang.pdf&ei=tIBuUcq-HMGJtAanzIDICg&usg=AFQjCNGxSwxWUsLfXr6kNf0jGaFm1S2cGg&bvm=bv.45368065,d.Yms, S. 3.
[3] Demmer, Marianne: http://www.abc-der-ganztagsschule.de/Foerderung_individuelle.html
[4] Behrensen, Birgit und Solzbacher, Claudia: Individuelle Förderung in KiTa und Grundschule. Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung, Themenheft Nr. 5., S. 5.
[5] Arnoldt, Bettina: Der Beitrag von Kooperationspartnern zur individuellen Förderung an Ganztagsschulen. In: Stecher, Ludwig; Allemann-Ghionda, Cristina; Helsper, Werner und Klieme, Eckhard (Hrsg.): Ganztägige Bildung und Betreuung. Zeitschrift für Pädagogik, 54. Beiheft Juli 2009. Weinheim und Basel 2009, S. 64.
[6] Behrensen, Birgit; Sauerhering, Meike und Solzbacher, Claudia: Ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Studie zu Sichtweisen und Erfahrungen von Grundschullehrkräften zu individueller Förderung. In: Solzbacher, Claudia; Müller-Using, Susanne und Doll, Inga: Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln 2012, S. 3.
[7] Müller-Using, Susanne: Individuelle Förderung und die Umsetzung des Rechts auf Bildung in der Grundschule: Überlegungen zur pädagogischen Professionalisierung von Lehrkräften. In: Solzbacher, Claudia; Müller-Using, Susanne und Doll, Inga: Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln 2012, S. 322.
[8] Solzbacher, Claudia; Schwer, Christina und Doll, Inga: Individuelle Förderung als Begabungsförderung. In: Solzbacher, Claudia; Müller-Using, Susanne und Doll, Inga: Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln 2012, S. 24.
[9] Prüß, Franz; Kortas, Susanne und Schöpa, Matthias: Zur Gestaltung der Ganztagsschule. Ergebnisse einer Befragung von Schulleitern und Schulleiterinnen zum Stand der Ganztagsschulentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. In: Kahl, Heike und Knauer, Sabine (Hrsg.): Bildungschancen in der neuen Ganztagsschule. Lernmöglichkeiten verwirklichen. Weinheim und Basel 2007, S. 144.
[10] Solzbacher, Claudia; Schwer, Christina und Doll, Inga: Individuelle Förderung als Begabungsförderung. In: Solzbacher, Claudia; Müller-Using, Susanne und Doll, Inga: Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln 2012, S. 25.
[11] Arnoldt, Bettina: Der Beitrag von Kooperationspartnern zur individuellen Förderung an Ganztagsschulen. In: Stecher, Ludwig; Allemann-Ghionda, Cristina; Helsper, Werner und Klieme, Eckhard (Hrsg.): Ganztägige Bildung und Betreuung. Zeitschrift für Pädagogik, 54. Beiheft Juli 2009. Weinheim und Basel 2009, S. 65.
[12] vgl.: Wischer, Beate: Individuelle Förderung als Herausforderung für Schulentwicklung – Schultheoretische Perspektiven zu Konzepten und Fallstricken. In: Solzbacher, Claudia; Müller-Using, Susanne und Doll, Inga: Ressourcen stärken! Individuelle Förderung als Herausforderung für die Grundschule. Köln 2012, S. 59.
[13] vgl.: Czerwanski, Annette; Solzbacher, Claudia und Vollstädt, Witlof: Förderung von Lernkompetenz in der Schule. Band 2: Praxisbeispiele und Materialien. Gütersloh 2004.
[14] Hellmich, Frank (Hrsg.): Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle – empirische Ergebnisse – pädagogische Konsequenzen. Stuttgart 2011, S. 11.
[15] Valtin, Renate: Grundschule – die Schule der Nation. Überlegungen zum Bildungsauftrag der Grundschule: In: Hellmich, Frank (Hrsg.): Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle – empirische Ergebnisse – pädagogische Konsequenzen. Stuttgart 2011, S. 11.
[16] Prüß, Franz; Kortas, Susanne und Schöpa, Matthias: Zur Gestaltung der Ganztagsschule. Ergebnisse einer Befragung von Schulleitern und Schulleiterinnen zum Stand der Ganztagsschulentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. In: Kahl, Heike und Knauer, Sabine (Hrsg.): Bildungschancen in der neuen Ganztagsschule. Lernmöglichkeiten verwirklichen. Weinheim und Basel 2007, S. 145.
[17] Lehmann, Tobias: Individuelle Förderung. Möglichkeiten und Grenzen der Förderung in Ganztagsschulen. In: Gängler, Hans und Markert, Thomas (Hrsg.): Vision und Alltag der Ganztagsschule. Die Ganztagsschulbewegung als bildungspolitische Kampagne und regionale Praxis. Weinheim u.a. 2011, S.242.
[18] vgl. Schmidt, Annekathrin: Die Verschiedenheiten der Köpfe. Oder: Wie Heterogenität zur Chance von Schulentwicklung werden kann. In: Kahl, Heike und Knauer, Sabine (Hrsg.): Bildungschancen in der neuen Ganztagsschule. Lernmöglichkeiten verwirklichen. Weinheim und Basel 2007, S. 213.
[19] Schraml, Petra: DJI-Studie ‚Individuelle Förderung in der Grundschule‘. http://www.ganztagsschulen.org/de/3734.php, 2009.
[20] Johann Heinrich Pestalozzi war ein bedeutender Pädagoge, Philosoph und Politiker. Er lebte von 1746 bis 1827. In dieser Zeit setzte er sich dafür ein, dass man den Menschen zur Selbsthilfe erzieht. Das Lernen mit Kopf, Herz und Hand bezieht sich darauf, dass der Mensch erst zum Menschen wird, wenn er sein Herz, seine handwerklichen Fähigkeiten und seinen Geist bildet. Diese drei Aspekte sollten dann wiederum den Menschen schließlich befähigen, sich selbst zu helfen.
[21] Kerber-Ganse, Waltraut: Kindern gerecht werden - die Rechte des Kindes würdigen. Eine besondere Chance der Ganztagsschule? In: Kahl, Heike und Knauer, Sabine (Hrsg.): Bildungschancen in der neuen Ganztagsschule. Lernmöglichkeiten verwirklichen. Weinheim und Basel 2007, S. 20.
[22] Groeben, Annemarie von der: Individuelle Förderung in der Ganztagsschule: mehr als Hausaufgabenhilfe am Nachmittag. http://ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/sicht_ad_kind/pdf/BS_2/BEB_6.Materialien.3.3.1.Gute_GTS_von_der_Groeben.pdf, S. 4.
[23] vgl.: Kerber-Ganse, Waltraut: Kindern gerecht werden - die Rechte des Kindes würdigen. Eine besondere Chance der Ganztagsschule? In: Kahl, Heike und Knauer, Sabine (Hrsg.): Bildungschancen in der neuen Ganztagsschule. Lernmöglichkeiten verwirklichen. Weinheim und Basel 2007, S. 21.
[24] ebd. S. 29.