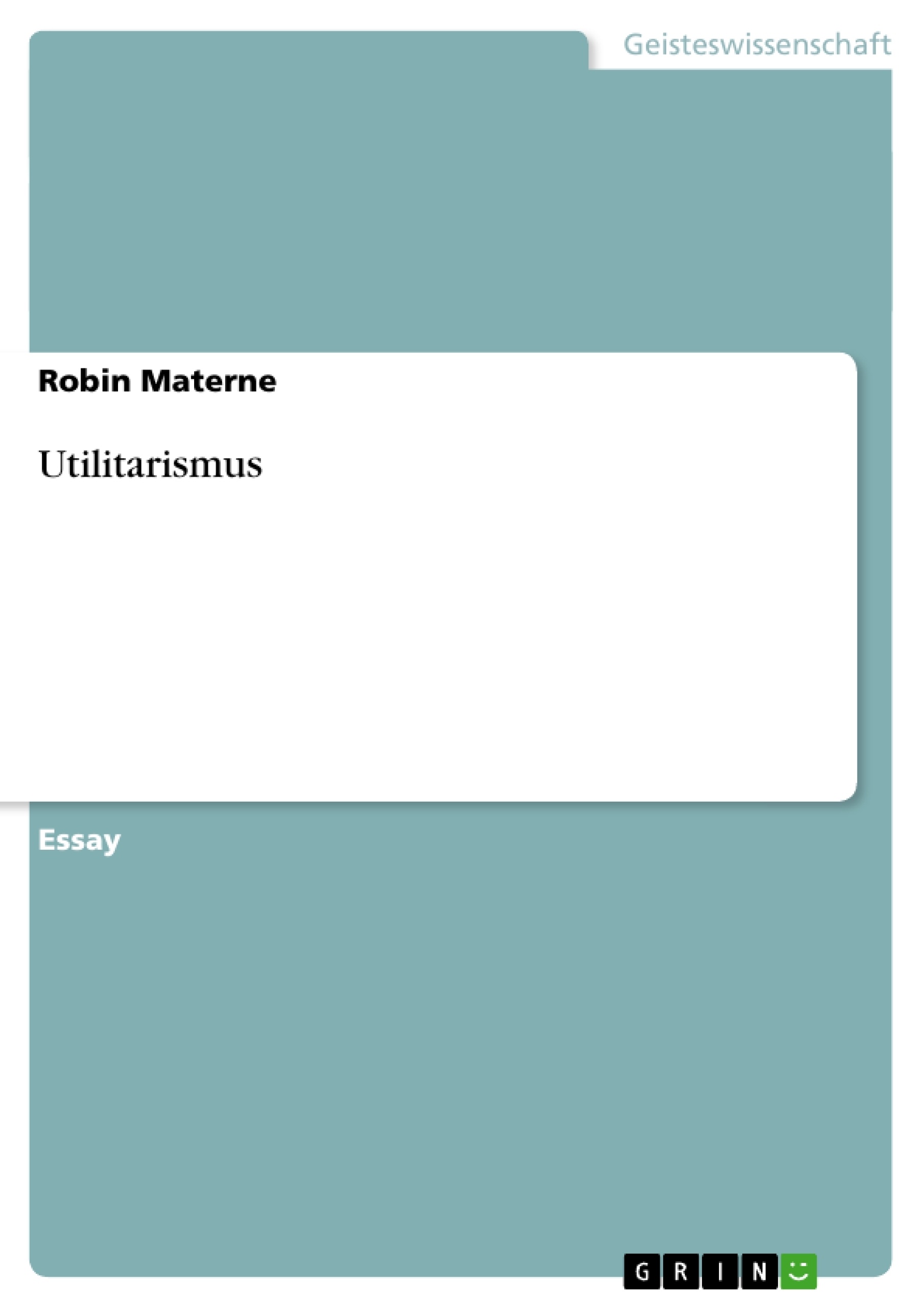Der Utilitarismus selbst beurteilt Handlung, im Gegensatz zur Kant’schen Ethik, nach den Folgen der Selbigen und nicht nur durch die bloße Handlung selbst. Eine Handlung gelte dann als gut, wenn sie das größtmögliche Glück, für die größtmögliche Zahl der Menschen bringt.
Utilitarismus
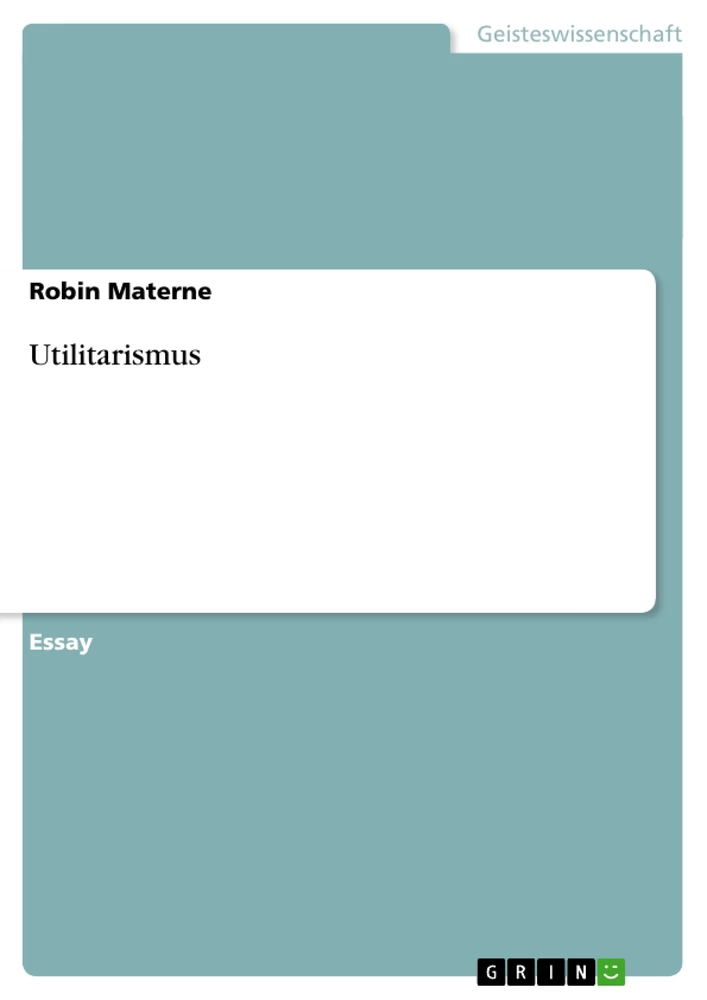
Essay , 2012 , 4 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Robin Materne (Autor:in)
Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...)
Leseprobe & Details Blick ins Buch