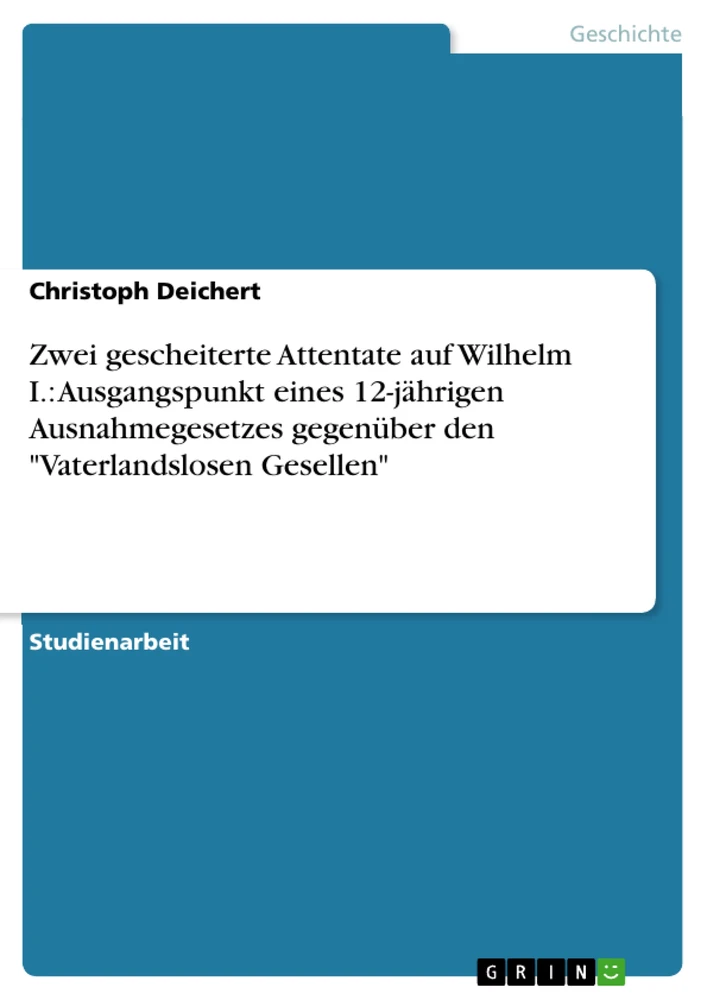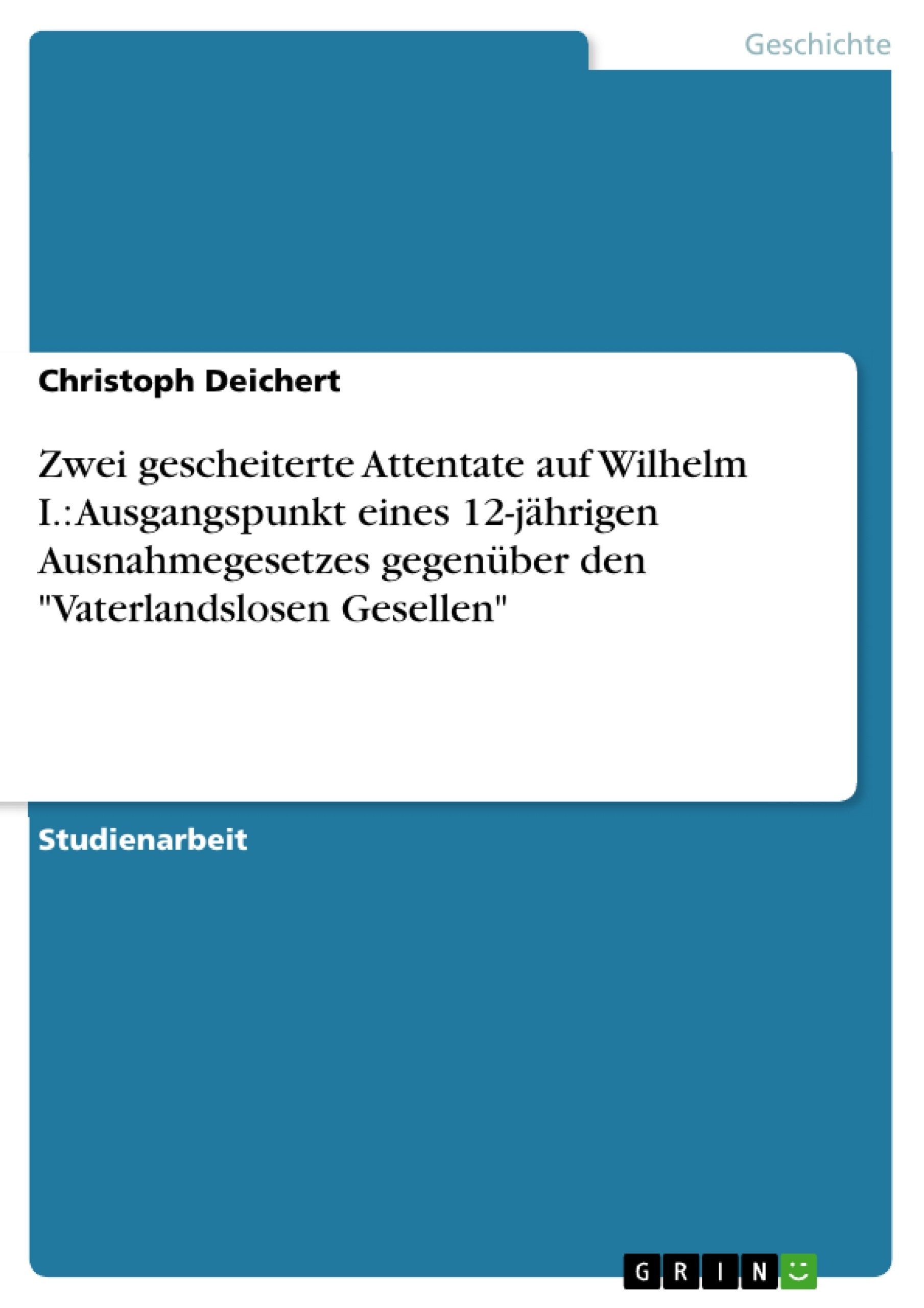1872 wurde mit dem Leipziger Hochverratsprozess eine Epoche der allgemeinen Verfolgung der Sozialdemokratie eingeleitet. Über den Hochverrat hinaus, ließ sich auf der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung nutzen, um einen Sozialdemokraten hinter Gittern zu bringen. Besonders vielfältige Möglichkeiten lieferte der Klassenkampfparagraf des Strafgesetzbuches. Als immer mehr Sozialdemokraten freigesprochen wurden, forderte der Reichskanzler Otto von Bismarck eine deutliche Verschärfung zu Ungunsten von Beschuldigten. Doch die Verschärfung scheiterte 1876 an der liberalen Reichstagsmehrheit....
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
I.1 Forschungsstand
I.2 Fragestellung
I.3 Methode
I.4 Literaturdiskussion
II. Begriffsdefinition „politisches Delikt“
II. Crimen laesea maiestatis im Strafgesetzbuch von 1871
II.1 Die „liberale Ära“ zwischen 1867 und 1878
III. Attentat vom 11. Mai 1878 auf Wilhelm I
III.1 Der Täter und seine Motive
III.2 Verhaftung, Untersuchungshaft und Prozess
IV. Attentat vom 2. Juni auf Wilhelm I
IV.1 Der Täter und seine Motive
V. Öffentliche Begleitung der Taten
VI. Unmittelbare rechtliche Folgen
VII. Politische Reaktion der Obrigkeit
VIII. Sozialistengesetz
IX. Justizielle Folgen
IX.1 Polizeiliche Methoden
X. Auslaufen des Sozialistengesetzes
XI. Bilanz des Sozialistengesetzes
XII. Schlussfolgerungen
XIII. Fazit
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bildquellenverzeichnis
I. Einleitung
1872 wurde mit dem Leipziger Hochverratsprozess eine Epoche der allgemeinen Verfolgung der Sozialdemokratie eingeleitet. Über den Hochverrat hinaus, ließ sich auch der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung nutzen, um einen Sozialdemokraten hinter Gitter zu bringen. Besonders vielfältige Möglichkeiten lieferte der Klassenkampfparagraf des Strafgesetzbuches. Als immer mehr Sozialdemokraten freigesprochen wurden, forderte der Reichskanzler Otto von Bismarck eine deutliche Verschärfung zu Ungunsten von Beschuldigten. Doch die Verschärfung scheiterte 1876 an der liberalen Reichtagsmehrheit. Durch den Kampf gegen die reaktionäre Staatsgewalt und durch gemeinsame Aktion gegen Unternehmer, haben sich die verfeindeten Arbeiterparteien 1875 zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ zusammengeschlossen.[1] Die Einigung wurde zum Teil getragen von ADAV, welcher sich stark auf die marxistische Theorie bezog.[2] „Das Manifest der Kommunistischen Partei“, von Karl Marx und Friedrich Engels, bezeichnet bereits zu Beginn, die Herrschaftsordnung nach dem Wiener Kongress als Ziel der Veränderung.[3] Diese ablehnende Haltung und das preußische Verbot aller sozialdemokratischen Vereine und Gewerkschaften, dürfte bereits vor dem Sozialistengesetz dazu beigetragen haben, dass sich die Sozialdemokratie organisatorisch auf ein gegen sie gerichtetes Gesetz vorbereiten konnte.[4]
I.1 Forschungsstand
Da die Forschung zum Thema politische Verbrechen und zur Sozialistengesetzgebung mehrere Forschungsstränge gebildet hat, können an dieser Stelle aus arbeitstechnischen Gründen nur einige kurz angerissen werden. Zum Thema Attentäter forschte Sven Kellerhoff.[5] Werner Saerbeck forschte über die Presse der Sozialdemokratie während der Zeit des Sozialistengesetzes.[6]Die staatlichen Repressionsmittel untersuchten Klaus Lantermann und Karl-Ludwig Günsche in ihrem Buch, „Verbieten, Aussperren, Diffamieren“.[7] In weiteren Büchern wird allgemein die Politik des Reichs dargestellt und meistens nimmt die Sozialistengesetzgebung ein oder mehrere Kapitel ein.[8]
I.2 Fragestellung
Handelte es sich bei der Sozialistengesetzgebung um ein adäquates Mittel gegen Bestrebungen gegen den Staat oder diente es dazu eine politische Minderheit zu unterdrücken? Diese Fragestellung liegt nahe, wenn man berücksichtigt, dass bereits unmittelbar nach Inkrafttreten am 21. Oktober 1878 die polizeilichen Maßnahmen begannen.[9] Ein weiterer Anknüpfungspunkt für diese Fragestellung liegt in der Einleitung und dem staatlichen Vorgehen gegen Sozialdemokraten vor dem Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie.
Im weiteren Verlauf der Arbeit soll die These überprüft werden, die Regierung nutzte ihre Stellung, um unter einem Vorwand repressive Maßnahmen gegen die sozialdemokratische Minderheit einzusetzen.
I.3 Methode
Innerhalb dieser Arbeit werden strukturgeschichtliche Untersuchungen angestellt, zu dem Komplex der beiden Attentate 1878 auf Wilhelm I. und ihrer rechtlichen Folge, dem Sozialistengesetz. Auf politische Folgen wird nur im Rahmen der Reaktion des Staates bzw. der Obrigkeit eingegangen werden. Zu Beginn wird rudimentär dargelegt, was politische Delikte und ihre Elemente sind. Im Anschluss hieran wird auf die Majestätsverbrechen im deutschen Kaiserreich und die „liberale Ära“ in der Zeit nach den „Einigungskriegen“ eingegangen. Danach werden in chronologischer Reihenfolge die beiden Taten und die Täter sowie ihre Motive beschrieben. Bei Max Hödel wird zusätzlich noch auf die Gefangennahme und den Haft- und Prozessverlauf eingegangen. Die nächsten Teile dieser Hausarbeit erfolgen allesamt thematisch gegliedert. Zunächst werden die öffentliche Begleitung der Taten und die unmittelbaren juristischen Folgen behandelt. Im direkten Anschluss wird die politische Reaktion der Staatsführung beleuchtet und danach das Sozialistengesetz dargestellt. Hieran folgt ein Einblick in die justiziellen Folgen und die polizeilichen Methoden während des Ausnahmegesetzes. Danach werden das Auslaufen des Sozialistengesetzes und die Folgen des selbigen dargestellt. Vor dem abschließenden Fazit werden Schlussfolgerungen gezogen.
1.4 Literaturdiskussion
Für die vorliegende Hausarbeit wird in diesem Punkt nur auf die hauptsächlich verwendete Literatur eingegangen. Nun zum ersten Buch „Verbieten, Ausperren, Diffamieren“, dieses beginnt mit einem Vorwort des SPD Politikers Hans Koschnick, dieser kritisiert Franz-Josef Strauß und die deutsche politisch konservative Klasse, diese Kritik an CDU und CSU verläuft wie ein „roter Faden“ durch das gesamte Buch. Ein weiteres Werk ist, „Das Sozialistengesetz. Illustrierte Geschichte des Kampfes der Arbeiterklasse gegen das Ausnahmegesetz“, zum einen hat dieses Buch, welches bereits im Einband auf das Zentralinstitut für Geschichte an der Akademie der Wissenschaft der DDR verweist, auch das Ziel den eigenen Staat vor allem gegenüber der Bundesrepublik zu legitimieren. Ein weiterer Kritikpunkt ist zum Beispiel die Schilderung auf Seite 45, dort wird behauptet man hätte Hödel nicht den Verteidiger seiner Wahl gestattet.[10] Diese Aussage steht im Widerspruch zu einer Darstellung von Carola Dietze, in der darlegt wird, dass der Wunschverteidiger Hödel nicht vertreten wollte.[11] Carola Dietzes Aufsatz mit dem Titel, „Terrorismus im 19. Jahrhundert: Politische Attentate, rechtliche Reaktionen, Polizeistrategien und öffentlicher Diskurs in Europa und den Vereinigten Staaten“, wird auch mehrfach verwendet, dieser versucht möglichst wertneutral die Ereignisse des Jahres 1878 und ihre Folgen zu schildern, wobei es ihr gelingt einige gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Rein von der justiziellen Seite betrachtet aber ebenso wertneutral, werden die Auswirkungen des Sozialistengesetzes bei Uwe Wilhelm, in seiner Monographie, „Das Deutsche Kaiserreich und seine Justiz“.
II. Begriffsdefinition „politisches Delikt“
Die Gesamtheit der Verhaltensweisen, welche sozialen und rechtlichen Kontrollinstanzen als Normverstöße aufnehmen, wird als kriminell bezeichnet. Polizeistrategien und öffentlicher Diskurs in Europa und den Vereinigten Staaten, in: Härter, Karl u. de Graaf, Beatrice (Hgg.): Vom Majestätsverbrechen zum Terrorismus, Frankfurt 2012, S. 184. Kriminalität wird heute als Summe des strafrechtlich geahndeten definiert.[12] Politische Straftaten haben einen anderen Motivationsgrund als die Verletzung des Rechtsguts des Individuums. Wie bei alltäglichen Verbrechen wie Mord oder Diebstahl, wird die politische Straftat ebenfalls sanktioniert. Wenn man die staatlichen Schutznormen des Strafrechts beachtet, gewinnt der Begriff der politischen Kriminalität an Trennschärfe.[13] Politische Vergehen richten sich gegen den Herrscher oder den Staat und bilden ein eigenes Deliktfeld, dass der Majestätsverbrechen(crimen laesea maiestatis).[14]
In der geschichtswissenschaftlichen Theorie, lassen sich folgende Elemente von politischen Delikten identifizieren:
- Täter/Dissidenten, die meisten in einer Gruppe/Vereinigung agierten Politische Motive
- Individuelle oder kollektive Gewalt
- Kommunikative und symbolische Handlung
- Die Reaktionen des Herrschafts- bzw. Rechtssystems[15]
II.1 Crimen laesea maiestatis im Strafgesetzbuch von 1871
Im Folgenden werden die Majestätsverbrechen aus dem Strafgesetzbuch von 1871 in der Fassung vom 1876 dargestellt, diese befinden sich im Zweiten Teil, vom ersten bis vierten Abschnitt. Der für diese Arbeit wesentliche Paragraf 80, stellte den Mordversuch und den Mord an dem Kaiser und den Landesherren unter Todesstrafe. Als Mord ist gemäß Legaldefinition aus Paragraf 211, das vorsätzliche Töten eines Menschen, wenn die Tat mit Überlegung begangen wurde. Der strafbare Versuch war geregelt in Paragraf 43 und setzt den Anfang einer Tat voraus, welche aber letztendlich misslang. Im Anschluss wurde in Paragraf 44 geregelt, dass der Versuch geringer zu bestrafen ist, als eine vollendete Tat. Die restlichen Paragrafen des ersten Abschnitts im vierten Teil, widmeten sich der Akzeptanz der Regierungen und Herrscher, desweiteren wurde Hochverrat sowie seine Strafandrohung dargestellt. Der zweite Abschnitt ist der Herrscherbeleidigung gewidmet. Diese Beleidigung konnte als Tätlichkeit oder in Form einer Beleidigung gegen den Kaiser oder den eigenen Landesherren erfolgen. Der dritte Abschnitt beinhaltete ähnliche Gesetze wie im vorangegangenen, allerdings muss sich die Beleidigung nicht gegen den Kaiser oder eigenen Landesherren richten, sondern gegen einen Bundesfürsten. Die Paragrafen 102 bis 104 im vierten Abschnitt drohten Strafe für feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten, insbesondere für deren Herrscher und Hoheitszeichen, an.[16]
II.2 Die „liberale Ära“ zwischen 1867 und 1878
Durch grundlegende Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft stand das Jahrzehnt zwischen 1867 und 1878 innenpolitisch im Zeichen der „liberalen Ära“, diese zeichnete sich besonders durch die Vereinheitlichung des Rechts aus. In dieser Zeit wurden die Fundamente der Staatsbürgergesellschaft und der bürgerlichen Wirtschaftsgesellschaft gelegt.[17] Die Freizügigkeit wurde im Gesetz vom November 1867 geregelt und erlaubte es jedem Bundesstaatsangehörigen sich im ganzen Reichsgebiet niederzulassen und Gewerbe treiben zu dürfen. Nicht nur dieses Gesetz, sondern auch das Passgesetz von 1867 führte zu einem Abbau der Mobilitätshemmnisse, weder Ausländer noch Inländer waren verpflichtet ein Reisedokument mit sich zu tragen. Desweiteren wurde die Armenfürsorge neugeregelt und sie ging von den Heimatgemeinden auf die Wohnsitzgemeinden nach 2 Jahren über, was weitere Abschiebungen, wie in der Zeit zuvor üblich, im Falle von Armut ausschloss. Ein weiterer reformierter Teilbereich stellte die Gewerbeordnung von 1869 dar, durch sie wurden die letzten Reste einer zünftigen Wirtschaftsordnung liberalisiert. So wurden Befähigungsnachweise für die meisten Gewerbe abgeschafft und Innungen wurden zu Vereinen mit freiwilliger Mitgliedschaft. Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil bestand im harmonisieren der Maß- und Gewichtseinheiten und des Zahlungsmittels. Aber nicht alle Lebensbereiche wurden liberalisiert, hierzu zählen die Presse- und Vereinigungsfreiheit. Die Polizei konnte Presseerzeugnisse nach wie vor ohne richterliche Genehmigung beschlagnahmen.[18]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] Vgl.: Günsche, Karl-Ludwig u. Lantermann, Klaus: Verbieten, Aussperren, Diffamieren. Hundert Jahre Sozialistengesetz und verwandte Praktiken, Frankfurt 1978, S. 26 - 27.
[2] Vgl.: Potthoff, Heinrich u. Miller, Susanne: Kleine Geschichte der SPD. 1848 - 2002, S. 42.
[3] Vgl.: Fetscher, Iring (Hg.): Manifest der Kommunistischen Partei. Grundsätze des Kommunismus, Stuttgart 1999, S. 19.
[4] Vgl.: Verbieten, Aussperren, Diffamieren. Frankfurt 1978, S. 28.
[5] Vgl.: Kellerhoff, Sven F.: Attentäter. Wahnsinnige, Verführte, Kriminelle, Köln 2003.
[6] Vgl.: Saerbeck, Werner: Die Presse der deutschen Sozialdemokratie unter dem Sozialistengesetz. Pfaffenweiler 1986.
[7] Vgl.: Verbieten, Aussperren, Diffamieren. Frankfurt 1978.
[8] Vgl.: Althammer, Beate: Das Bismarckreich. 1871 - 1890, Paderborn 2009.
[9] Vgl.: Albrecht, Willy: Ende der Illegalität. Das Auslaufen des Sozialistengesetzes und die deutsche Sozialdemokratie im Jahre 1890, Heidelberg 1990, S. 9.
[10] Vgl.: Bartel, Horst u. Schröder, Wolfgang u. Seeber, Gustav: Das Sozialistengesetz. Illustrierte des Kampfes der Arbeiterklasse gegen das Ausnahmegesetz, Berlin 1980.
[11] Vgl.: Dietze, Carola: Terrorismus im 19. Jahrhundert: Politische Attentate, rechtliche Reaktionen,
[12] Vgl.: Schwerhoff, Gerd: Kriminalität, in: Jaeger, Friedrich (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart 2008, S. 206.
[13] Vgl.: Blasius, Dirk: Geschichte der politischen Kriminalität in Deutschland (1800 - 1980). Eine Studie zu Justiz und Staatsverbrechen, Frankfurt 1983, S. 12.
[14] Vgl.: Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart 2008, S. 221.
[15] Vgl.: Härter, Karl u. de Graaf, Beatrice: Vom Majestätsverbrechen zum Terrorismus. Politische
[16] Vgl.: Deutsche Reichsgesetzblatt, Nr. 6 veröffentlicht auf : Wikisource,
http://de.wikisource.org/wiki/Strafgesetzbuch_f%C3%BCr_das_Deutsche_Reich_%281876%29, 27.04.2012.
[17] Vgl.: Wilhelm, Udo: Das Deutsche Kaiserreich und seine Justiz. Justizkritik - politische Strafrechtssprechung - Justizpolitik, Berlin 2010, S. 108.
[18] Vgl.: Das Bismarckreich. Paderborn 2009, S. 66 - 69.