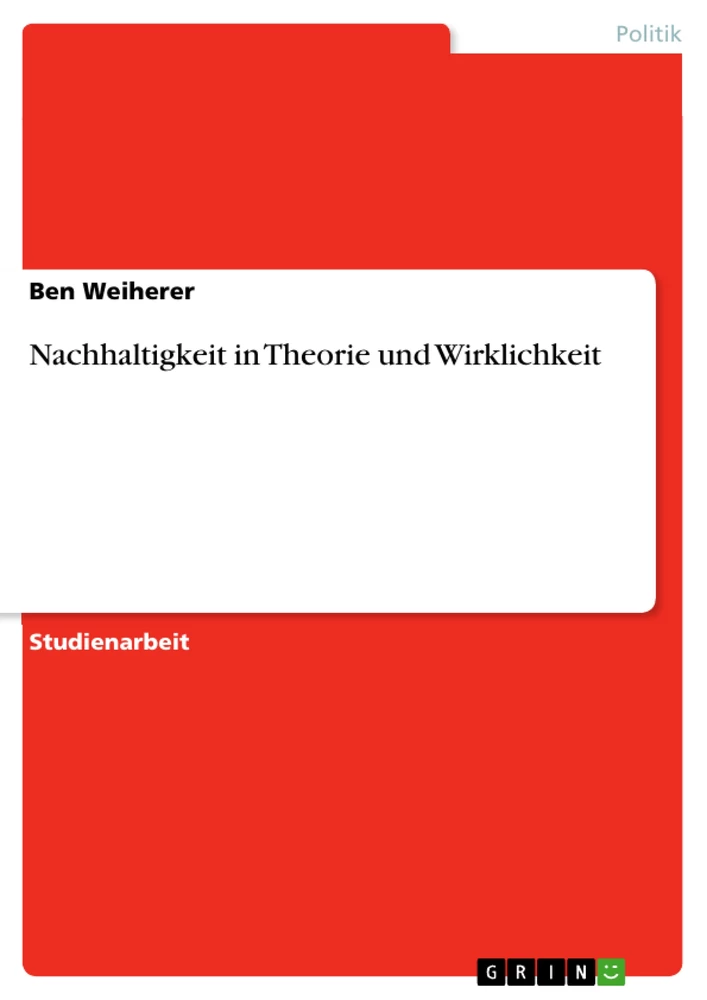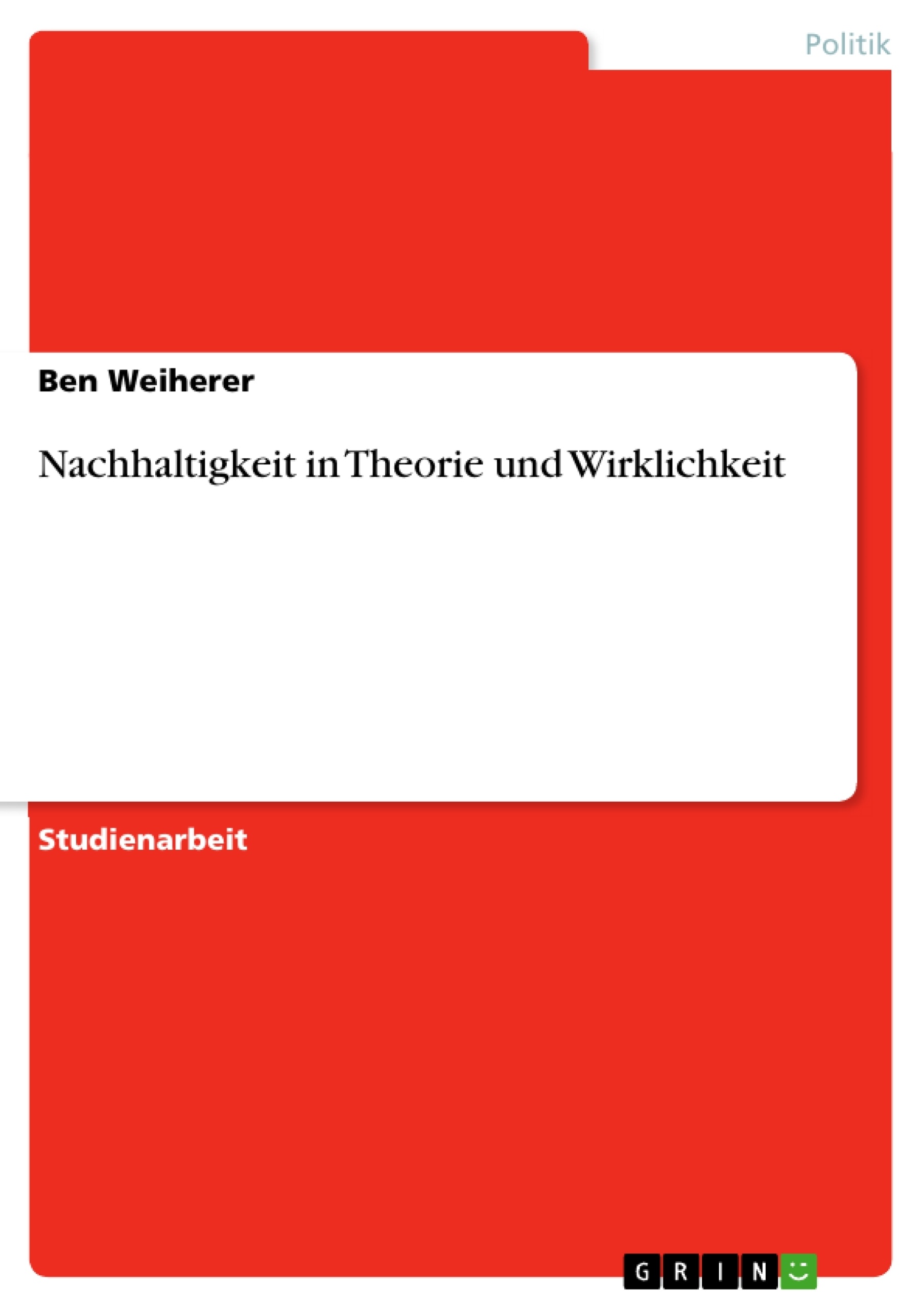Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist keine „Erfindung“ des 21. Jahrhunderts. Bereits im 18. Jahrhundert kamen vereinzelte Ideenimpulse zu diesem Thema auf. Einer der Pioniere auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit war der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz. In seinem im Jahr 1713 erschienenen Werk „Sylvicultura oeconomica“ spielte bei seinen Überlegungen in erster Linie die Forstwirtschaft eine Rolle. Die einfache und doch einleuchtende These von Carlowitz besagte, dass nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie tatsächlich auch nachwachsen kann. Das Prinzip der Nachhaltigkeit war geboren.
Etwas aktueller ist die Auseinandersetzung mit dem Thema der Nachhaltigkeit im Zuge des Brundtland-Berichts. Im Jahre 1987 beschäftigte sich die World Commision on Environment and Development (WCED) unter dem Vorsitz der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland mit der Thematik der nachhaltigen Entwicklung. Ziel dieses Berichts war es, erstmalig ein Leitbild zu nachhaltiger Entwicklung zu entwickeln. Ergänzt und zum globalen Leitbild ernannt wurde der Brundtland-Bericht im Zuge der Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro im Jahre 1992. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beschreibt die Notwendigkeit einer globalen Aufmerksamkeit für nachhaltige Entwicklung wie folgt: „Dahinter stand die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gleichwertige überlebenswichtige Interessen sind, die sich gegenseitige ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriff der Nachhaltigkeit
3 Ernährung und Nachhaltigkeit
3.1 Nutzung von Ressourcen
3.2 Produktion
3.3 Logistik
3.4 Verbrauch beim Endkonsumenten
4 Gesellschaftlicher Wandel: Eine Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Onlineverzeichnis