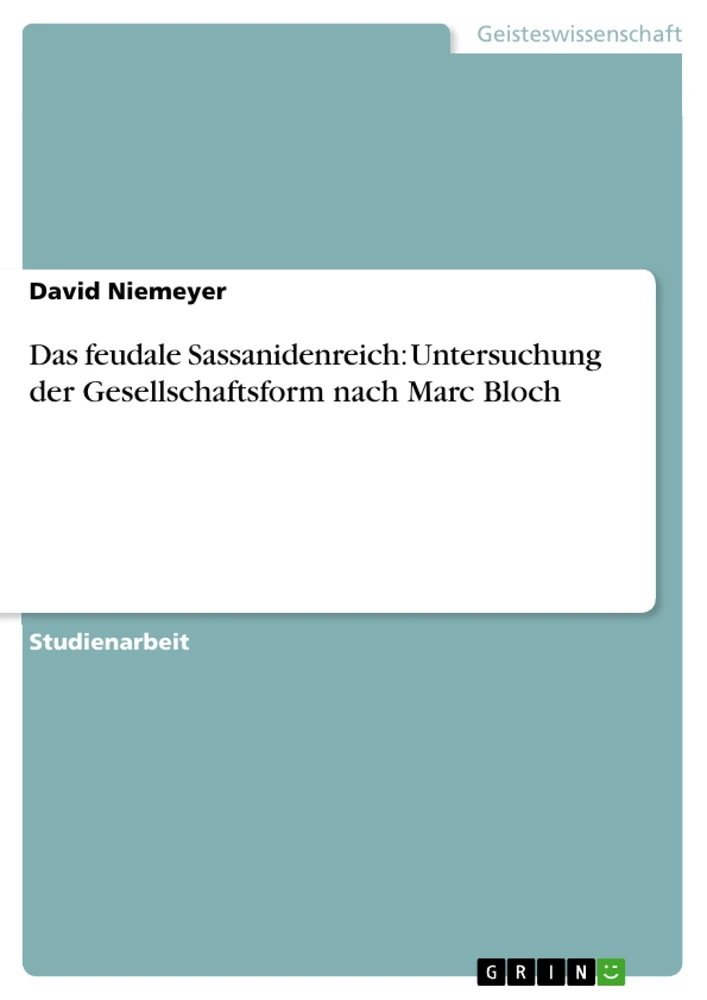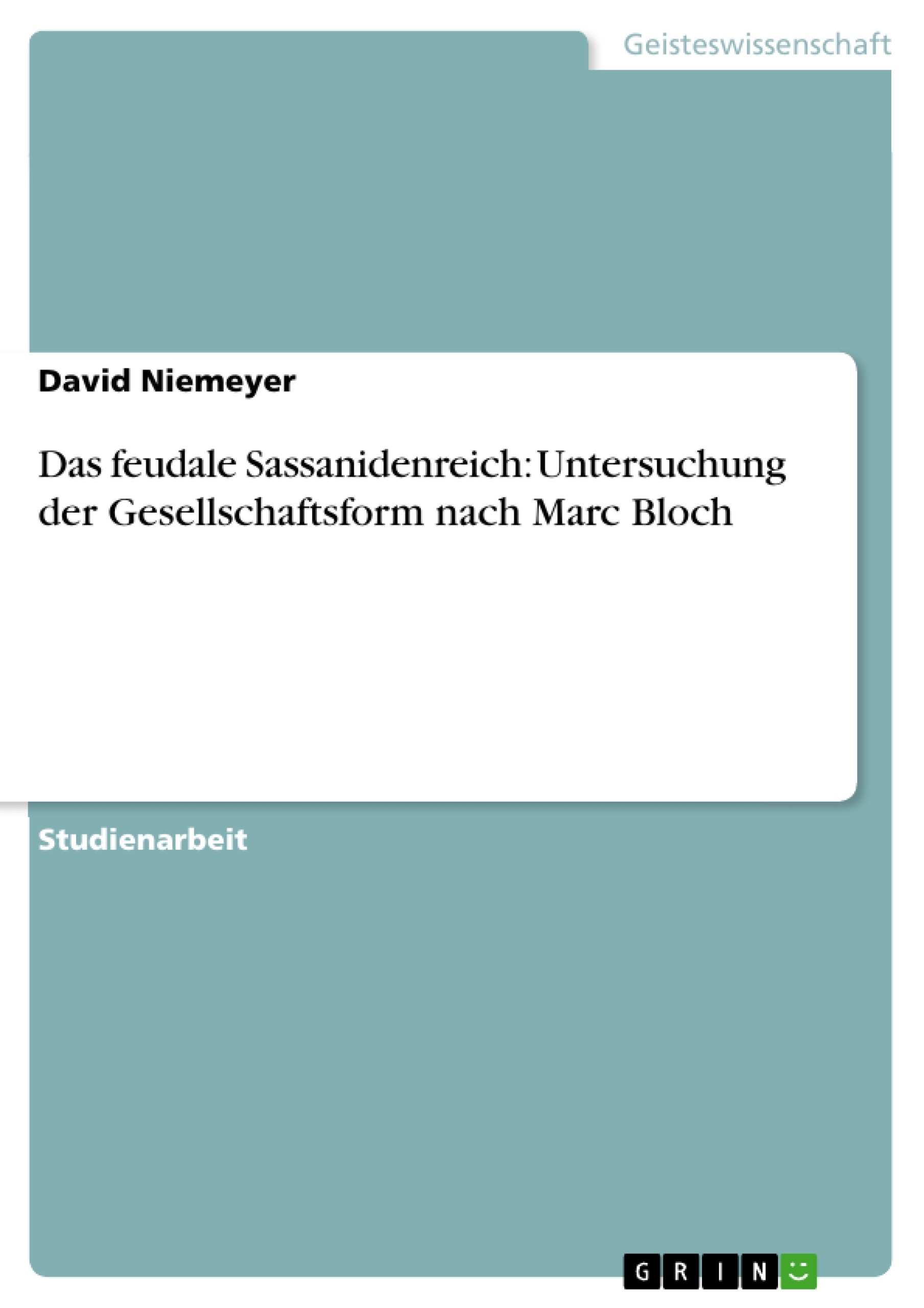Dass das Sassanidenreich ein feudaler Staat war, ist eine Auffassung, die viele Histori-ker teilen. So schreibt Schippmann „Ich […] gehe davon aus, dass man [beim Sassanidenreich] von einem wirklichen Feudalstaat sprechen kann, egal welche Definition man dabei zugrunde legt“. Dieser Meinung schließen sich ebenfalls A. Christensen, F. Altheim und weitere an.
Es wird dabei aber oft außer acht gelassen, dass der Begriff Feudalismus in vieler Weise konnotiert ist und auf unterschiedlichsten Argumentationsfundament basiert. Feudalismus ist keine definierte Staats- oder Gesellschaftsform. Im Gegensatz zur Republik oder Autokratie ist der Feudalismus immer gewachsen und nie initial herbeigeführt. Auch wird er, selbst in feudalen Epochen, nicht als Konzeption unter diesem Begriff erkannt, sondern eine Epoche wird von späteren Beobachtern in dieses Begriffsspektrum klassifiziert. Hinzu kommt, dass dieser Begriff nahezu untrennbar mit der mittelalterlichen europäischen Geschichte verwoben ist. Zwar je nach Definition mit unterschiedlichem Fokus, jedoch immer regional, kulturell und/oder sozialstrukturell mit dieser Epoche Europas verbunden. Wird dieser Begriff also einer allgemeingültig definierten Staats-, Wirtschafts- oder Gesellschaftsform gleichgesetzt (so wie bei Schippmann), entstehen aufgrund der undefinierten Herleitung des Gesamtbegriffes schnell Unschärfen, die zu Trugschlüssen führen können. Insbesondere ist dies der Fall, wenn dieser regional aufgeladene Begriff bei außereuropäischen Gesellschaften seine Anwendung findet. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist deshalb die Frage, ob das Sassanidenreich ein Feudalstaat war oder nicht.
Um also zu untersuchen inwieweit das Sassanidenreich feudalistisch war bedarf es einer klar definierten und vor allem nicht eurozentristischen Methode. Hierzu wird basierend auf Marc Blochs „Die Feudalgesellschaft“ ein Kriteriendarstellung entwickelt und auf das Sassanidenreich angewendet.
Bloch definiert den Feudalismus nicht nur auf der herrschenden Ebene, sondern er bin-det soziale, religiöse und wirtschaftliche Aspekte mit in seine Typisierung ein und erfasst so die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge wesentlich umfassender als andere Definitionen. [...]
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Feudalismus nach Marc Bloch
3 Schematische Untersuchung der Gesellschaft
3.1 Die Ständegesellschaft
3.2 Die Dezentralisierung der Macht
3.3 Die Kriegerkaste und die Bindung durch das Feudum
3.4 Die Ökonomie
3.5 Die Religion
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Dass das Sassanidenreich ein feudaler Staat war, ist eine Auffassung, die viele Historiker teilen. So schreibt Schippmann „ Ich […] gehe davon aus, dass man [beim Sassanidenreich] von einem wirklichen Feudalstaat sprechen kann, egal welche Definition man dabei zugrunde legt “.[1] Dieser Meinung schließen sich ebenfalls A. Christensen[2], F. Altheim[3] und weitere an.
Es wird dabei aber oft außer acht gelassen, dass der Begriff Feudalismus in vieler Weise konnotiert ist und auf unterschiedlichsten Argumentationsfundament basiert. Feudalismus ist keine definierte Staats- oder Gesellschaftsform. Im Gegensatz zur Republik oder Autokratie ist der Feudalismus immer gewachsen und nie initial herbeigeführt. Auch wird er, selbst in feudalen Epochen, nicht als Konzeption unter diesem Begriff erkannt, sondern eine Epoche wird von späteren Beobachtern in dieses Begriffsspektrum klassifiziert. Hinzu kommt, dass dieser Begriff nahezu untrennbar mit der mittelalterlichen europäischen Geschichte verwoben ist. Zwar je nach Definition mit unterschiedlichem Fokus, jedoch immer regional, kulturell und/oder sozialstrukturell mit dieser Epoche Europas verbunden. Wird dieser Begriff also einer allgemeingültig definierten Staats-, Wirtschafts- oder Gesellschaftsform gleichgesetzt (so wie bei Schippmann[4] ), entstehen aufgrund der undefinierten Herleitung des Gesamtbegriffes schnell Unschärfen, die zu Trugschlüssen führen können. Insbesondere ist dies der Fall, wenn dieser regional aufgeladene Begriff bei außereuropäischen Gesellschaften seine Anwendung findet. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist deshalb die Frage, ob das Sassanidenreich ein Feudalstaat war oder nicht.
Um also zu untersuchen inwieweit das Sassanidenreich feudalistisch war bedarf es einer klar definierten und vor allem nicht eurozentristischen Methode. Hierzu wird basierend auf Marc Blochs „Die Feudalgesellschaft“ ein Kriteriendarstellung entwickelt und auf das Sassanidenreich angewendet.
Bloch definiert den Feudalismus nicht nur auf der herrschenden Ebene, sondern er bindet soziale, religiöse und wirtschaftliche Aspekte mit in seine Typisierung ein und erfasst so die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge wesentlich umfassender als andere Definitionen. Seine Forschung zum Thema Feudalismus ist für dies Aufgabe besonders geeignet, da Bloch zwar seine Erläuterungen aus dem europäischen Kontext herleitet, aber selbst seine Erkenntnisse auf die japanische Feudalepoche übertragt und so die multikulturelle Anwendbarkeit seiner Überlegungen demonstriert.
2 Feudalismus nach Marc Bloch
Wichtig für die Erörterung der Forschungsfrage ist zunächst eine Zusammenfassung der umfangreichen Erläuterungen Marc Blochs zum Thema Feudalismus. Nach Bloch definiert sich die Feudalgesellschaft über folgende Faktoren. Zentrales Kennzeichen einer feudalen Gessellschaft ist eine immobile, durch Geburt definierten Ständegesellschaft. In dieser ist die absolute bäuerliche Hörigkeit, anstelle der allgemeinen Lohnarbeit, von zentraler Bedeutung.[5] Diese kann sich neben der obligatorischen Versorgung der Lehnsherren bis in die Leibeigenschaft steigern.
Des weiteren gibt es eine Vormachtstellung einer spezialisierten Kriegerklasse, welche durch ein (oft erbliches) Lehen an weitere Lehnsgeber (die auch wieder Lehnsnehmer sind) gebunden sind. Dieser Stand Verpflichtet sich zum Kriegsdienst für seinen Lehnsgeber und im Gegenzug erhält er ein Beneficium (ein Stück Land oder eine andere Einnahmequelle) sowie Schutz durch den Lehnsherren.[6]
Diese Bindung geschieht durch eine Gehorsams- und Schutzbande (auch Vasallität), die die Menschen untereinander über die Verpflichtung eines Eides vor Gott aneinander bindet. Diese Bande verbindet die gesamte pyramidisch aufgebaute Gesellschaft in Wechselwirkung im Hinblick auf Schutz (Lehnsgeber) und Beistand (Lehnsnehmer) miteinander. An der Spitze dieses Konstruktes steht der König, der jedoch Gottes Vasall ist.[7]
Neben den Bauern und den Kriegern, stehen als dritte Säule der Ständegesellschaft. die Priester. Diese sind zwar nominell nicht in die beschriebene Gehorsams- und Schutzbande eingebunden, de facto wurden sie jedoch ebenfalls in das Lehenssystem integriert. Die Aufgabe dieses Standes ist es zu allererste für das Seelenheil der Menschen insbesondere der Krieger zu bitten.[8]
Hieran lässt sich auch die immense Bedeutung der christlichen Kirche als Fundament des gesamten gesellschaftlichen Zusammenlebens illustrieren. Auf den Lehren der christlichen Kirche bauen alle sozialen Zusammenhänge auf und die bedingungslose Devotion aller Macht unter die Macht Gottes ist Fundament und Legitimation alles Herrschens.[9]
Trotz des eigentlich pyramidalen Aufbaus ist die feudale Gesellschaft durch eine schwache zentrale Führung gekennzeichnet. Insbesondere das System der Lehnstreue durch überlassen eines erblichen Feudums, welches durchaus zu mehreren Lehnsherren, also auch mehreren Treueschwüren führen konnte, führt zu einer Zersplitterung der Macht.[10] Aufgrund derer dann ein nahezu chaotischer Zustand der Gewaltenausübung mit fluktuierenden Kräfteverhältnissen entsteht.[11]
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die wirtschaftliche Aufstellung der Gesellschaft. Durch die genannte Zersplitterung der Macht entstehen konkurrierende Interessensphären.[12] So ist der überregionale, durch Fertigungscluster gekennzeichnete Handel, wie er z.B. im Römischen Reich der Fall war, gegenüber dem regionalen agrargestützten Wirtschaften im Nachteil. Als Folge dessen kennzeichnet eine feudale Gesellschaft eine Fokussierung auf die Landwirtschaft, da diese direkt zum Erwerb des Lehnsgebers beiträgt.[13] Der Lehnsgeber kann an einem überregionalen Handel, der möglicherweise noch in einem anderen Lehen seine Abgaben leisten muss nur bedingtes Interesse haben. Auch überregionale Infrastruktur[14], wie z.B. große Handelsstraßen, verlieren innerhalb einer regionalen, landwirtschaftlich geprägten Ökonomie an Bedeutung.[15] Hinzu kommt die Bindung des Lehnsnehmers , insbesondere der hörigen Bauern, an ein Stück Land (Scholle). Dies erschwert zusätzlich den Verschub von Arbeitskräften und Know-How und verhindert die Entwicklung eines Lohnsystems, welches für die geldwerte Bewertung von Arbeit und damit von produzierten Waren ausschlaggebend ist.[16]
Zusammenfassend kann man also die von Bloch definierten Kriterien auf folgende Faktoren reduzieren. Existenz einer immobilen Ständegesellschaft welche durch Gehorsams- und Schutzbande miteinander verwoben ist, Existenz einer privilegierten Kriegerkaste, Zersplitterung der zentralen Macht, Regionalisierung und Agrarisierung der Ökonomie, umfassende Dominanz einer Religion unter anderem mit der Funktion der Legitimation des Gesellschaftsvertrages.
Im folgenden werden nun diese Kriterien auf das Sassanidenreich projiziert.
3 Schematische Untersuchung der Gesellschaft
3.1 Die Ständegesellschaft
Hinsichtlich der Stande im Sassanidenreich herrscht eine gewisse Uneinigkeit in der Forschung. So geht Christensen von vier Standen aus. Nämlich an erster Stelle den Priestern, gefolgt von den Kriegern und dann an dritter Stelle die Verwaltung, also die Schreiber, welchen der Stand des Volkes nachfolgt.[17] Widengren setzt die Grossvassalen, den Adel und die Krieger an erster Stelle, die Schreiber und Priester an die zweite und dritte. Der Stand des Volkes, also der Bauern fehlt.[18]
Im Gegensatz dazu steht Perikhanian. Dieser stellt fest, dass es eine Einteilung in Stande, wie sie das Awesta kennt, für die erste Hälfte der sassanidischen Periode überhaupt nicht nachzuweisen sei. Erst ab dem 5. Jahrhundert habe es eine Einteilung in der Reihenfolge Priester und Richter, gefolgt von dem Stand der Krieger und der Schreiber und an vierter Stelle die Bauern und Handwerker gegeben.[19] Obwohl in den Städten Händler und Handwerker eine große Rolle spielten, war die Mehrheit der Bevölkerung als Bauern auf dem Land tätig; sie profitierten auch von den Reformen Chosroes I nach dem Mazdakitenaufstand, da sie nun ihr Land selbstständig bearbeiten durften und in einem geringeren Maße vom Adel abhängig waren als vorher.[20] Auf Grund dieser Maßnahmen Chosroes wurde ein großer Teil der Landbevölkerung zumindest formell frei und unterstanden jetzt der Krone und nicht mehr dem Adel. Durch eine Steuerreform[21] waren nun nicht mehr die Großgrundbesitzer für den Einzug der Steuern verantwortlich, sondern die Bauern mussten ihre Abgaben direkt an die königliche Steuerverwaltung abführen.[22] Dies steht im Gegensatz zur Hörigkeit der feudalen Bauern im europäischen Mittelalter, welche für das feudale System von entscheidender Bedeutung war. Nur durch diese Hörigkeit konnte konstante Versorgung der Lehnsnehmer und somit deren Treue zu Ihren Lehnsgebern sichergestellt werden.
Eine bedeutende Rolle im Sassanidenreich spielten die zoroastrischen Priester (Mobads), die zugleich auch eine Richterfunktion ausübten und als Rechtsgelehrte wirkten.
[...]
[1] Schippmann S. 85
[2] Christensen S. 101, 206, 259
[3] Altheim Stiehl S. 156, 168, 174, 253
[4] Schippmann S. 85
[5] Bloch S. 576, 105
[6] Bloch S. 577
[7] Bloch S. 578
[8] Bloch S. 577
[9] Bloch S. 124, 130
[10] Bloch S. 578
[11] Bloch S. 580, 575
[12] Bloch S. 537
[13] Bloch S. 102
[14] Bloch S. 96, 97
[15] Bloch S. 102
[16] Bloch S. 103
[17] Christensen S. 98
[18] Widengren S. 246
[19] Perikhanian S. 632
[20] Schippmann S. 106
[21] Siehe Kapitel 3.4
[22] Altheim Stiehl S. 171/172