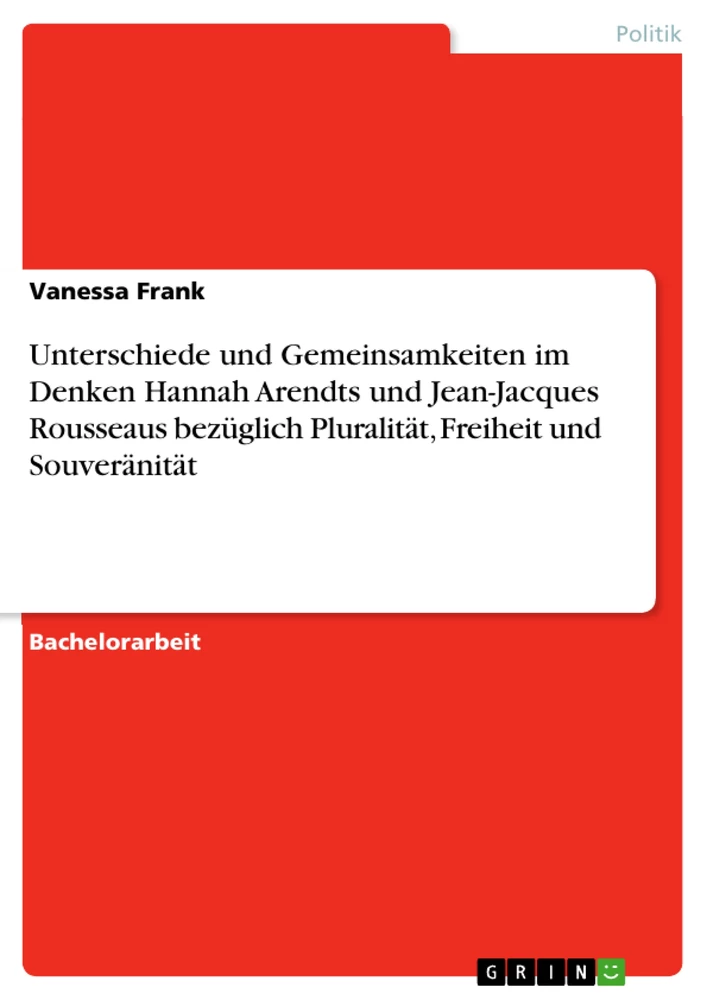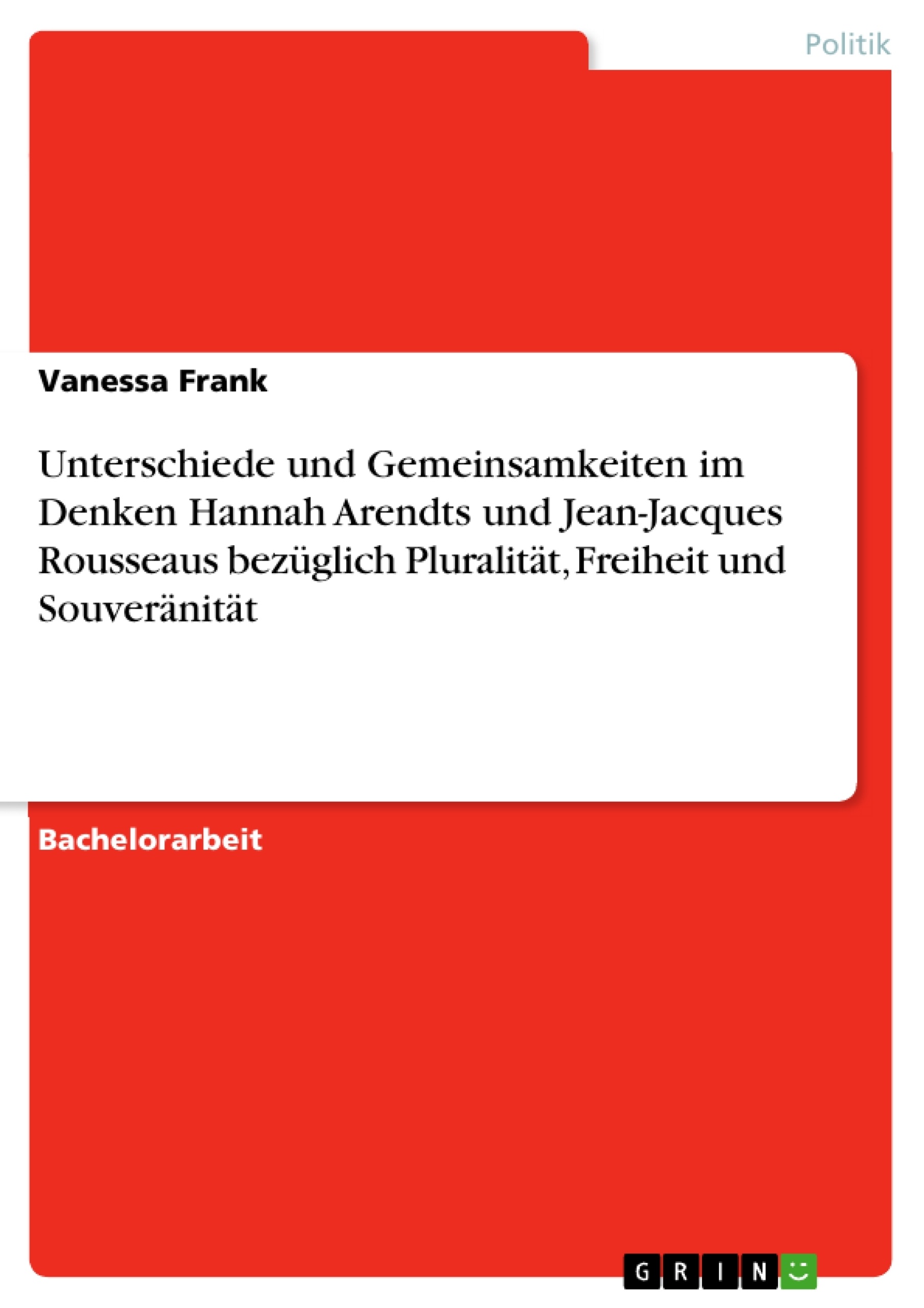In der vorliegenden Bachelorarbeit der Politischen Theorie werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im politiktheoretischen Denken
von Hannah Arendt und Jean-Jacques Rousseau im Bezug auf die Hauptthemen
Pluralität, Freiheit und Souveränität erläutert.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Unterschiedliche historische Gegebenheiten und Kritik der Gesellschaft
i. Ideengeschichtliche Orientierung an der Antike
III. Pluralität
ii. Menschenbild bei Jean-Jacques Rousseau
iii. Die Idee des volonté générale bei Jean-Jacques Rousseau
iv. Hannah Arendts Position erläutert anhand ihrer Rousseau-Kritik
IV. Freiheit
v. Einschub: Idee des Vertragsschlusses
V. Souveränität
VI. Schlussbetrachtungen
VII. Literaturverzeichnis