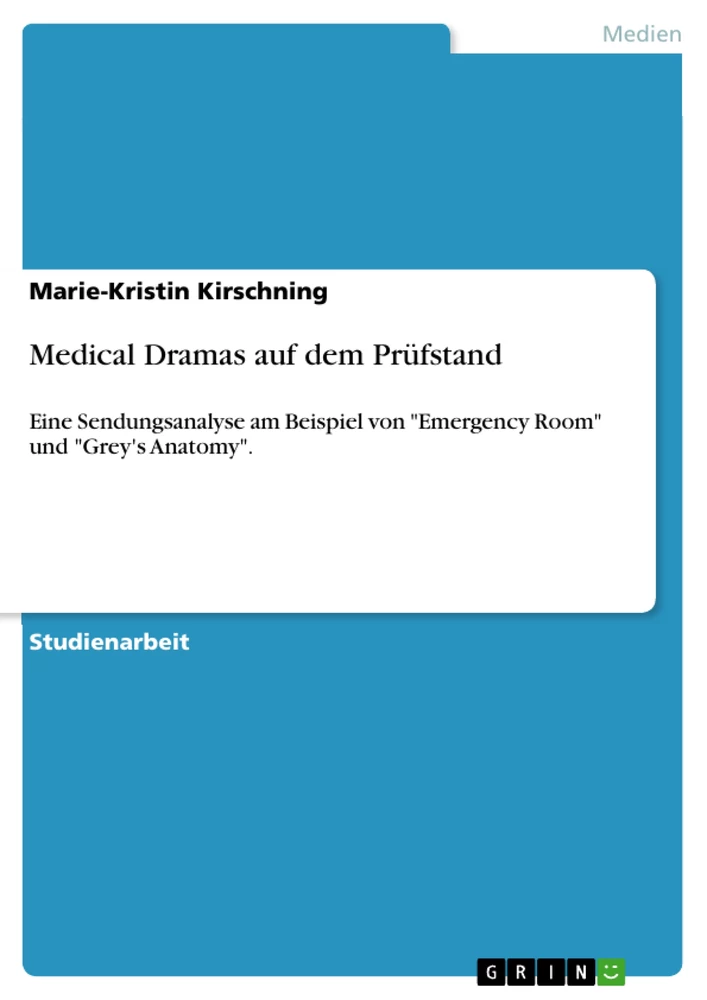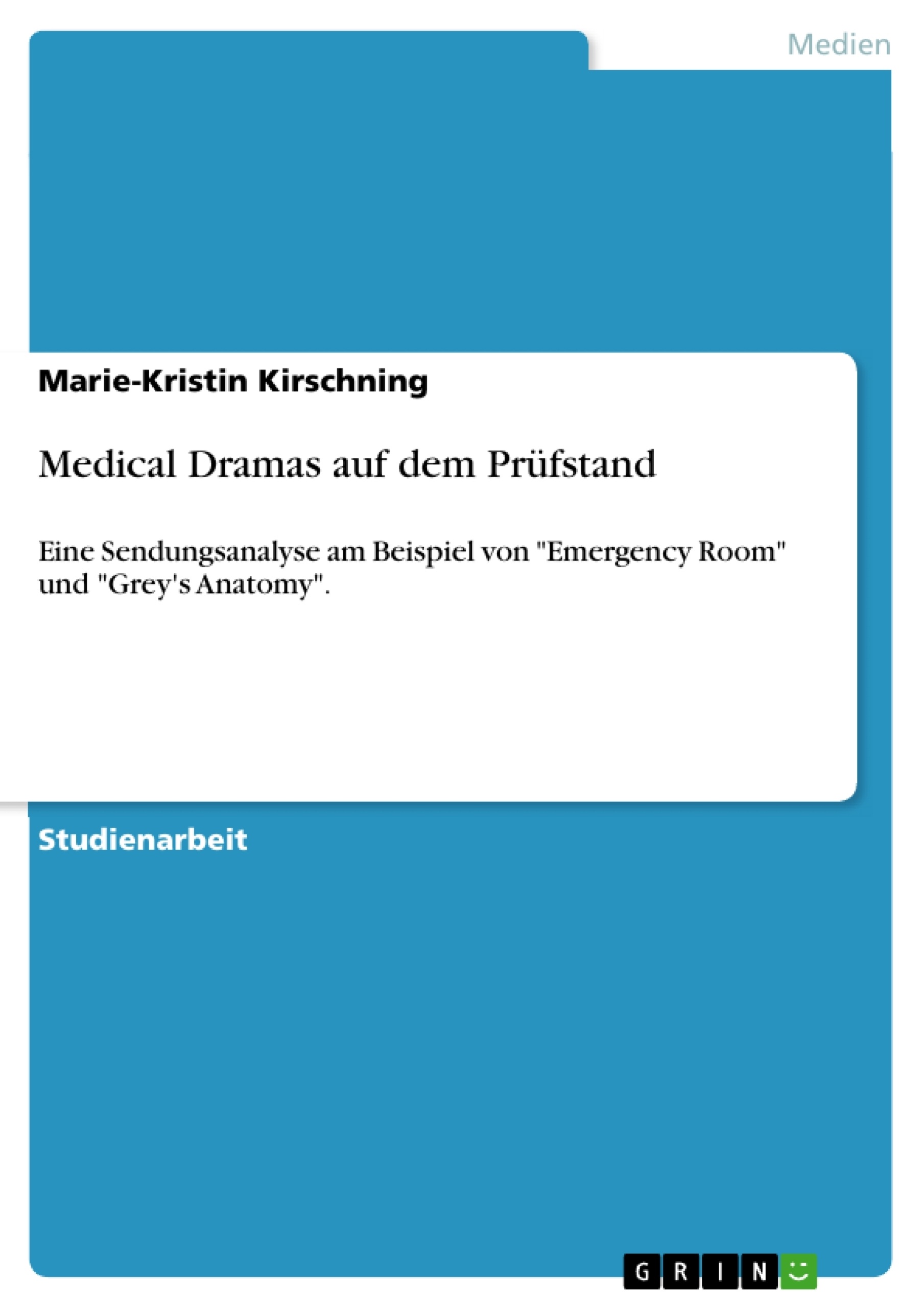In dieser Hausarbeit wurde eine vergleichende Analyse zwischen den Fernsehserien Emergency Room und Grey's Anatomy durchgeführt sowie die theoretischen Grundlagen zum medical drama allgemein geklärt.
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 DAS MEDICAL DRAMA
2.1 BESONDERHEITEN
2.2 KRITIK AM GENRE
3 VORSTELLUNG DER SERIEN
3.1 „EMERGENCY ROOM - DIE NOTAUFNAHME“
3.1.1 Entstehungskontext
3.1.2 Inhalt
3.1.3 Charaktere
3.2 „GREY’S ANATOMY - DIE JUNGEN ÄRZTE“
3.2.1 Entstehungskontext
3.2.2 Inhalt
3.2.3 Charaktere
4 FERNSEHSERIENANALYSE ANHAND AUSGEWÄHLTER EPISODEN
4.1 VORGEHEN BEI DER AUSWAHL DER EPISODEN
4.2 INHALTLICHE SENDUNGSANALYSE
4.2.1 Emergency Room - „Barmherzige Lügen“
4.2.2 Grey’s Anatomy - „Lügen”
4.3 VERGLEICH DER EPISODEN
5 ZUSAMMENFASSUNG
6 QUELLENVERZEICHNIS
7 ANHANG