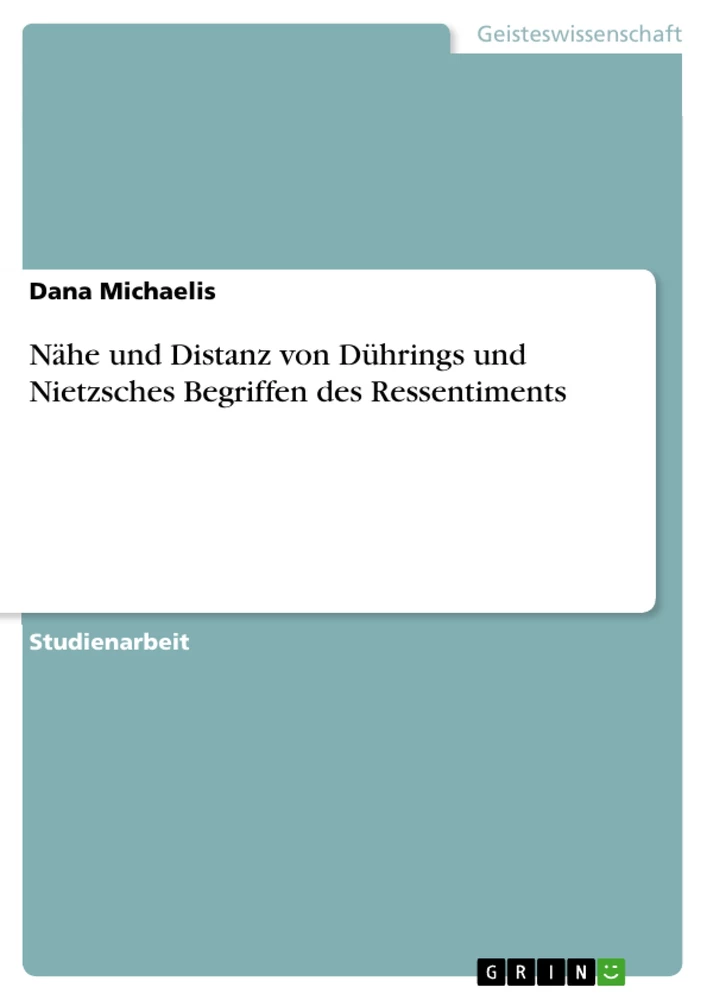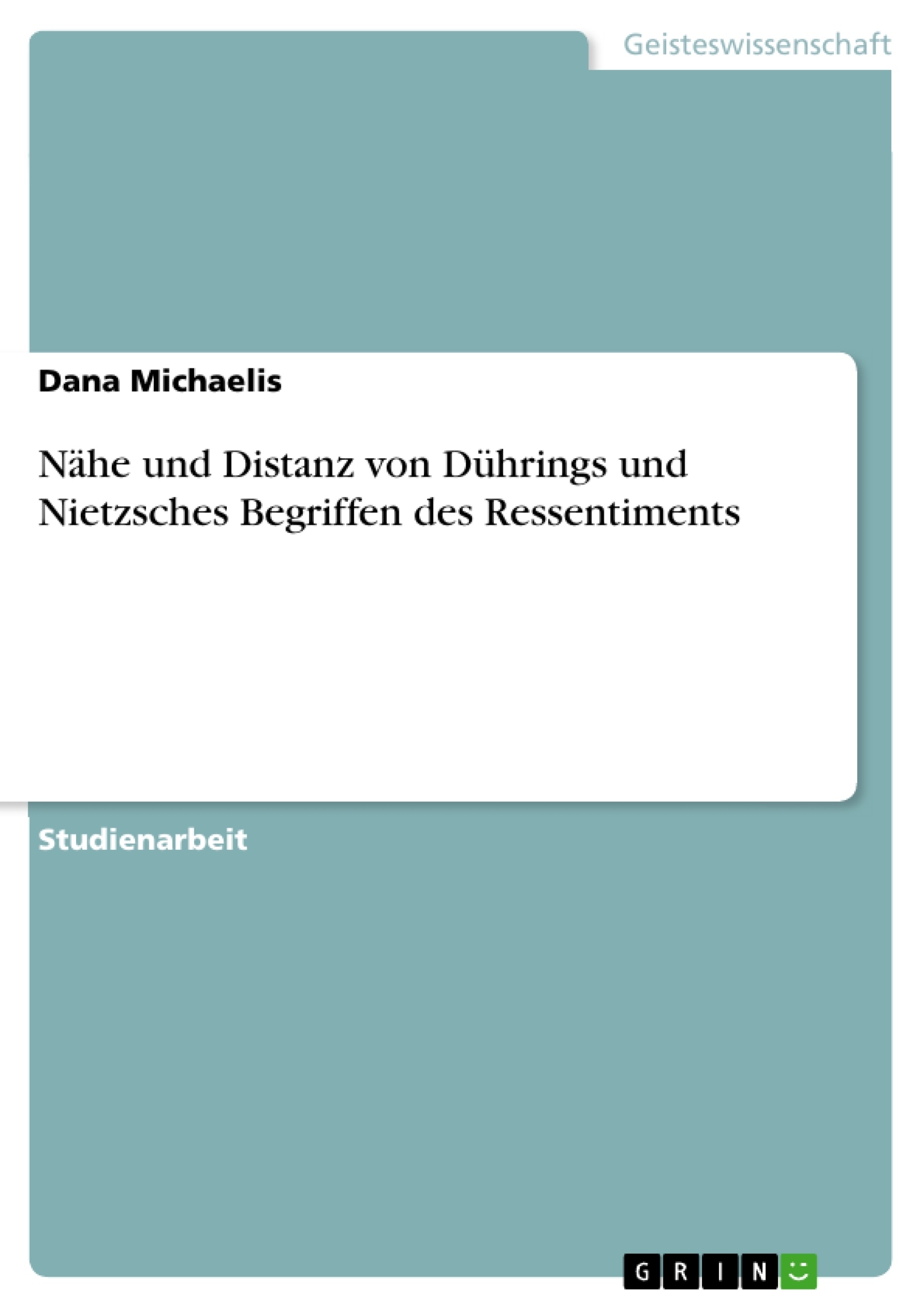In Bezug auf den Titel werde ich mich zu Beginn dieser Hausarbeit den beiden Philosophen Karl Eugen Dühring und Friedrich Nietzsche widmen und Prägnantes zu ihrem Wirken ausführen. Eine besondere Beachtung werden dabei die Werke „Werth des Lebens“ von Dühring und „Zur Genealogie der Moral“ von Nietzsche erfahren.
Im Folgenden werde ich näher erläutern, warum diese beiden Philosophen überhaupt für eine Gegenüberstellung geeignet sind und wo es zu Anknüpfungspunkten oder Gegensätzen kommt. Wie kam es beispielsweise zur Begegnung zwischen Nietzsche und Dühring? Welche Rolle spielte dabei Schopenhauer und der Begriff des „Ressentiments“?
Daran anknüpfend werde ich mich im Hauptteil meiner Hausarbeit intensiv mit dem Begriff des „Ressentiments“ auseinandersetzen. Zunächst soll dabei geklärt werden, was der Begriff beinhaltet, wo der begriffliche Ursprung festgemacht werden kann und welche unterschiedlichen Konnotationen der Begriff durchlaufen hat. Außerdem wird kurz darauf hingewiesen, welche Rolle der Essay „Feigheit- Mutter der Grausamkeit“ von Montaigne dabei spielt. Des Weiteren werde ich klären, welche Bedeutung ihm vor seinem Aufkommen in den Werken von Dühring und Nietzsche zukam und womit Dühring und Nietzsche das „Ressentiment“ in Verbindung gebracht haben. In diesem Abschnitt wird es mir dann auch um die Annäherungen zwischen Nietzsche und Dühring und um die Kritik von Nietzsche an Dühring gehen.
Außerdem werde ich im Kontext der Auseinandersetzung mit dem „Ressentiment“ auch die Begriffe „Herren- und Sklavenmoral“, „Gerechtigkeit“ sowie „Stärke“ und „Schwäche“ näher erläutern. Dabei wird es mir ebenso stets um Annäherungen und Unterschiede zwischen Nietzsche und Dühring gehen.
Im Schlussteil werde ich die Leitgedanken dieser Hausarbeit zusammenfassen, die Annäherungs- und Ablehnungspunkte zwischen...
Inhaltsangabe:
1. Einleitung
2. Das Wirken von Karl Eugen Dühring und Friedrich Nietzsche
2.1 Karl Eugen Dühring
2.2 Friedrich Nietzsche
2.3 Die Begegnung Nietzsches mit Dühring
3. Der Begriff „Ressentiment“ und seine Bedeutungen
3.1 Der Begriff Ressentiment vor Nietzsche und Dühring
3.2 Der Begriff „Ressentiment“ bei Nietzsche und Dühring
3.2.1 Annäherungen (S.12-13)
3.2.2 Unterschiede (S.13-15)
3.3 Herren- und Sklaven
3.4 Gerechtigkeit und Ressentiment
3.5 Stärke und Schwäche
4. Zusammenfassung
5. Anhang
5.1 Literaturverzeichnis