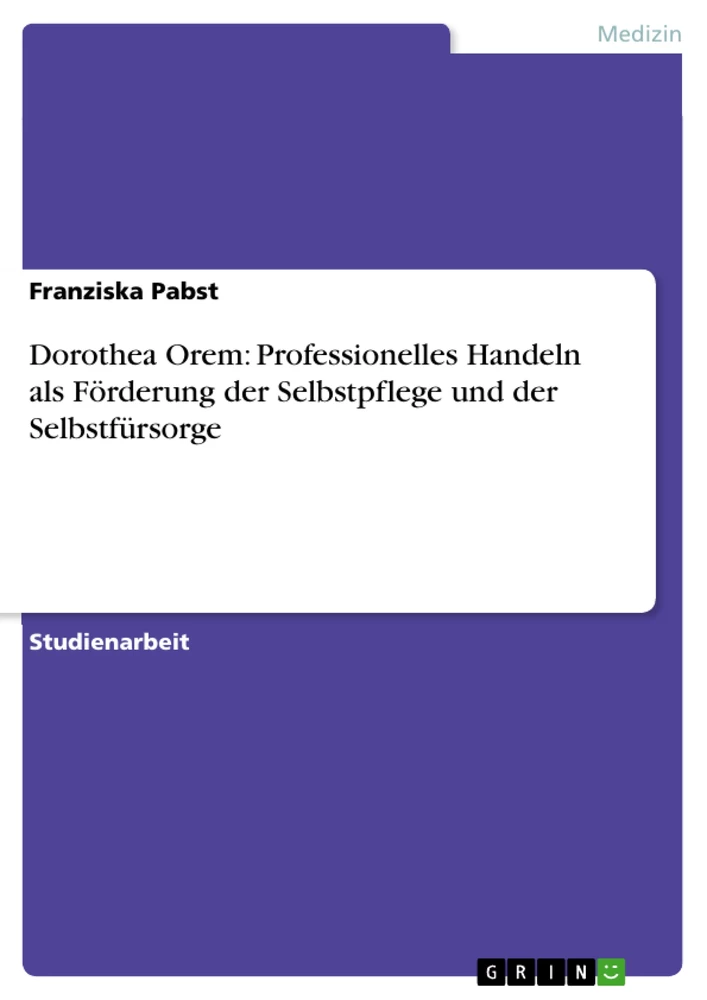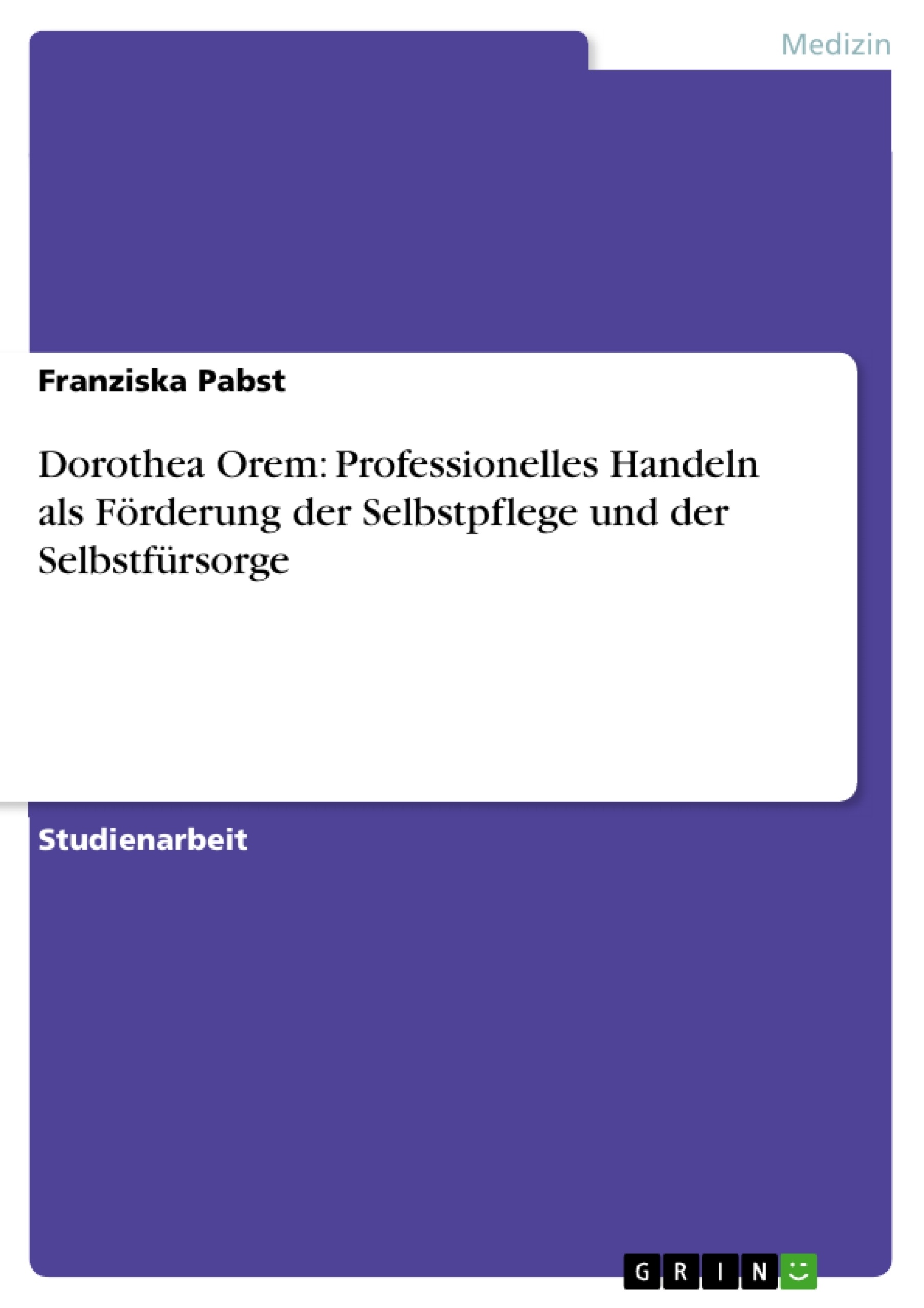Dorothea Orem entwickelte ein umfassendes Pflegekonzept, eine bedürfnisorientierte Theorie großer Reichweite. Der Patient als aktiv handelnder und bewusst denkender Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen steht dabei im Mittelpunkt. Hilfe und Unterstützung zur Kompensation von Defiziten und Stärkung von Fähigkeiten, angepasst auf Lebenssituation, Bedürfnisse und Ziele des Patienten, werden sowohl von einem interdisziplinären Team als auch vom unmittelbaren Lebensumfeld des Betroffenen gewährleistet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Allgemeine Angaben
2.1. Biografie Orems und Hintergründe zur Entstehung ihrer Theorie
2.2. Grundlagen der Theorieentwicklung Orems
3. Zentrale Konzepte und Hauptaussagen
3.1. Entwicklung des bewussten Handelns
3.2. Fallbeispiel zur Grundlage des Verstehens von Orems Theorie
3.3. Begriffsdefinitionen
3.4. Zusammenfassung des Modells
4. Metaparadigma
5. Anwendbarkeit
6. Kritik
7. Literaturverzeichnis