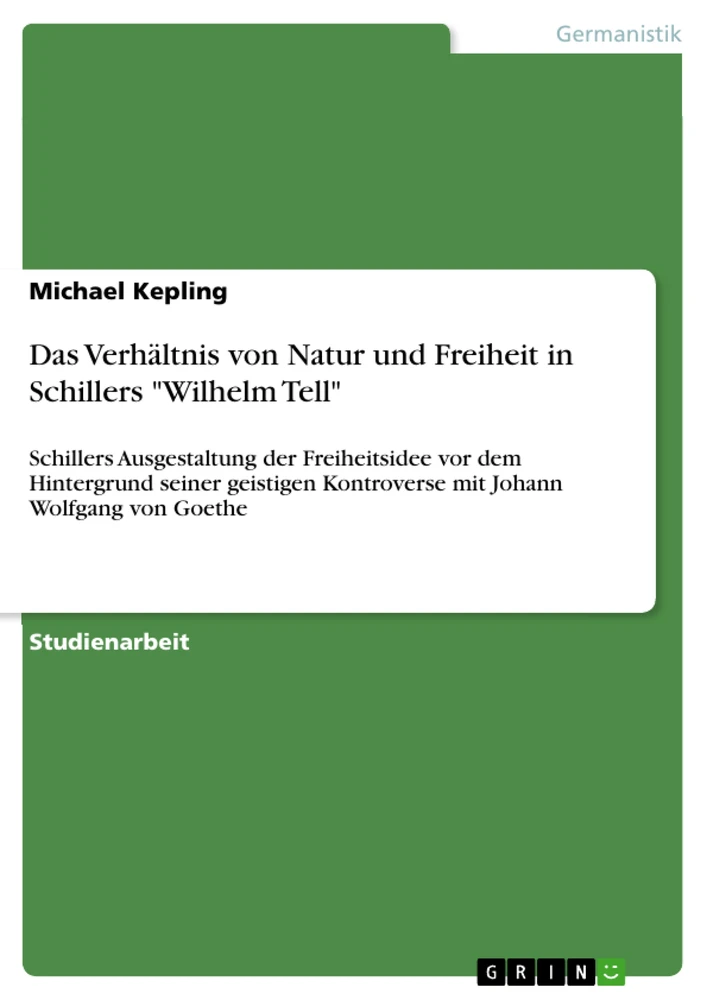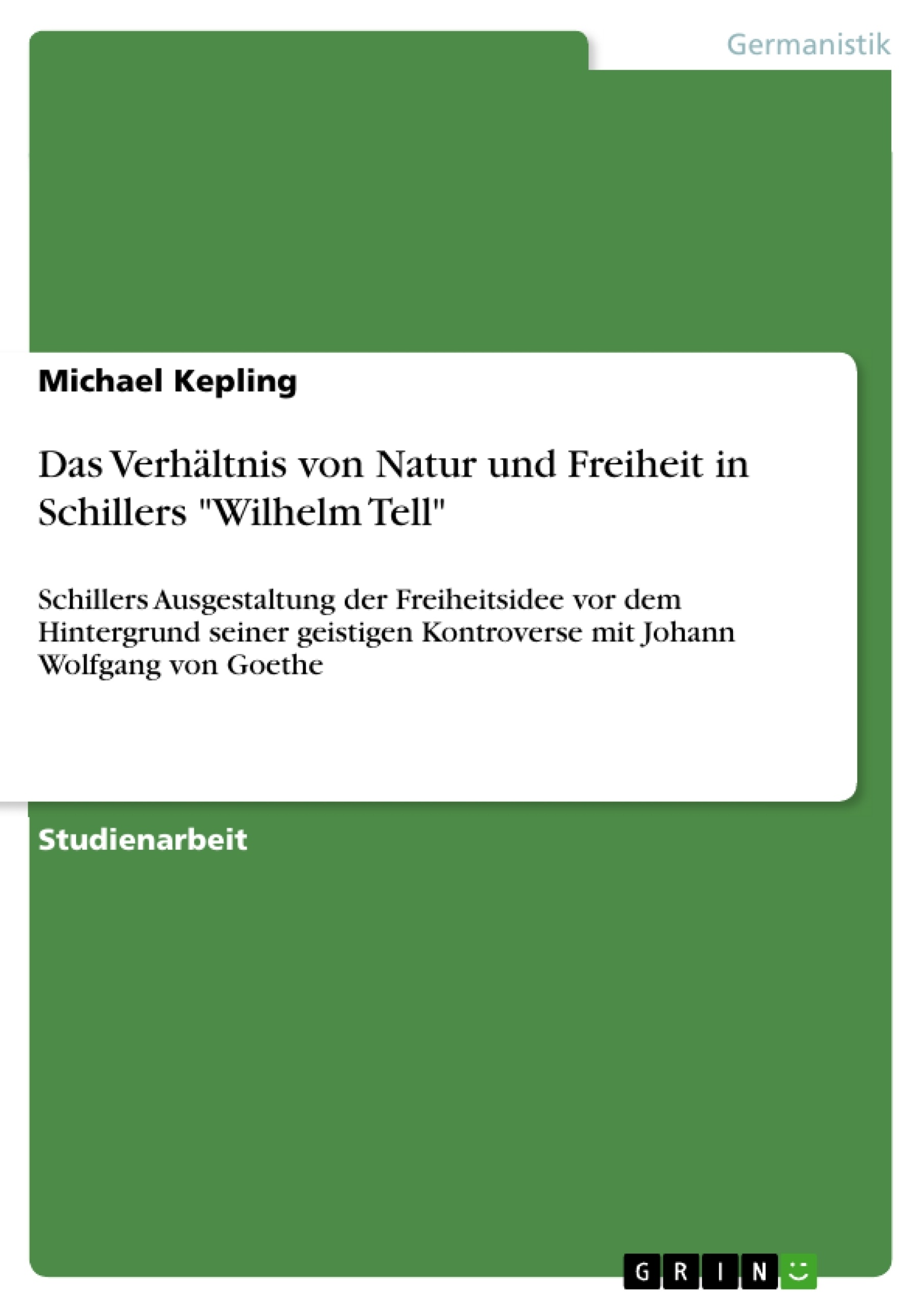„Ein jeder konnte dem anderen etwas geben, was ihm fehlte, und etwas dafür empfangen.“ Mit diesen Worten charakterisierte Friedrich Schiller seine ersten intensiveren Gespräche mit seinem Zeitgenossen Johann Wolfgang von Goethe – jene Gespräche also, die sich als Ausgangspunkt einer über ein Jahrzehnt andauernden intellektuellen Kontroverse erweisen sollten, einer Zusammenarbeit, letztlich einer Freundschaft.
Schillers Aussage verweist dabei implizit bereits auf die Verschiedenheit der beiden Dichter und damit auf die eigentliche Basis ihrer Freundschaft und Zusammenarbeit: eine fundamentale Spannung unterschiedlicher Denk- und Sehweisen. Goethe, der Dichter der Natur, und Schiller, der Freiheit und Vervollkommnung des Menschen durch die Kunst erstrebt, unterscheiden sich in nicht unwesentlichen Aspekten. Indem die beiden Dichter nun aber das von dem jeweils anderen empfangen, was ihnen selbst fehlt, machen sie Epoche. Die wechselseitige Einflussnahme zwischen Goethe und Schiller ist von entscheidender Bedeutung für jene Phase ihres Schaffens, die man später als „klassisch“ bezeichnen sollte. So zeichnet sich der „klassische“ Schiller nicht zuletzt auch dadurch aus, dass er bei aller Freiheit mehr Natur gewährt. Schiller stellt die Freiheit als Thema in den Mittelpunkt seines Werks, sie ist das Grundmotiv seines Dichtens von den Räubern bis zum Demetrius, er versucht in seiner reifen Schaffensphase gleichzeitig aber auch die Natur stärker auszudrücken, natürlichere Vorgänge zu schildern, um den Menschen bei allem Freiheitsenthusiasmus – dies hatte er in seiner Selbstrezension über die Räuber noch kritisiert – nicht zu „überhüpfen“.
Diese Arbeit versucht nun, den Einfluss Goethes, des Dichters der Natur, auf Schiller, den Dichter der Freiheit, mit Blick auf Schillers Entwicklung vom Stürmer und Dränger zum Klassiker, vom radikalen Freiheitsenthusiasten zum Dichter eines ausgewogeneren Verhältnisses zwischen Freiheit und Natur aufzuzeigen. Dazu sollen zunächst die unterschiedlichen Denk- und Sehweisen der beiden Dichter herausgearbeitet werden, bevor anhand der exemplarischen Analyse zweier Schillerscher Freiheitsdramen – den Räubern und dem Tell –, wobei der Schwerpunkt auf Schillers klassischem Werk, dem Wilhelm Tell, liegen soll, die besagte Entwicklung dargestellt werden kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Goethe und Schiller in der geistigen Kontroverse
3. Die Ausgestaltung der Freiheitsidee. Exemplarische Analysen
3.1 Freiheit und Unnatur in den Räubern
3.2 Freiheit in Wilhelm Tell
3.2.1 Der Rütlibund
3.2.2 Wilhelm Tell
4. Fazit
5. Bibliographie.