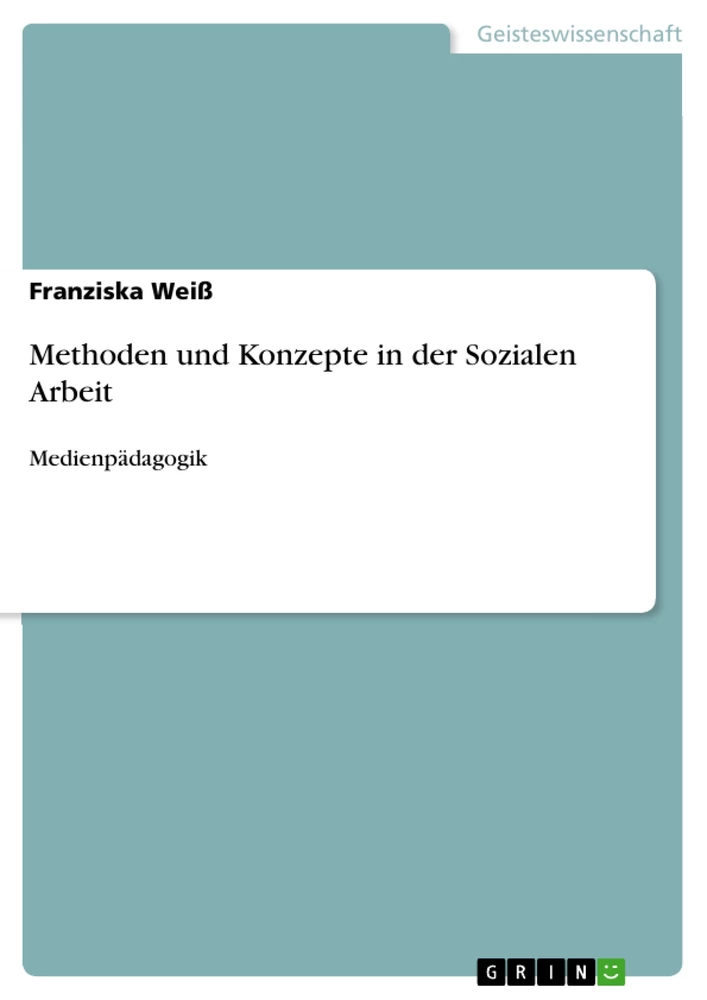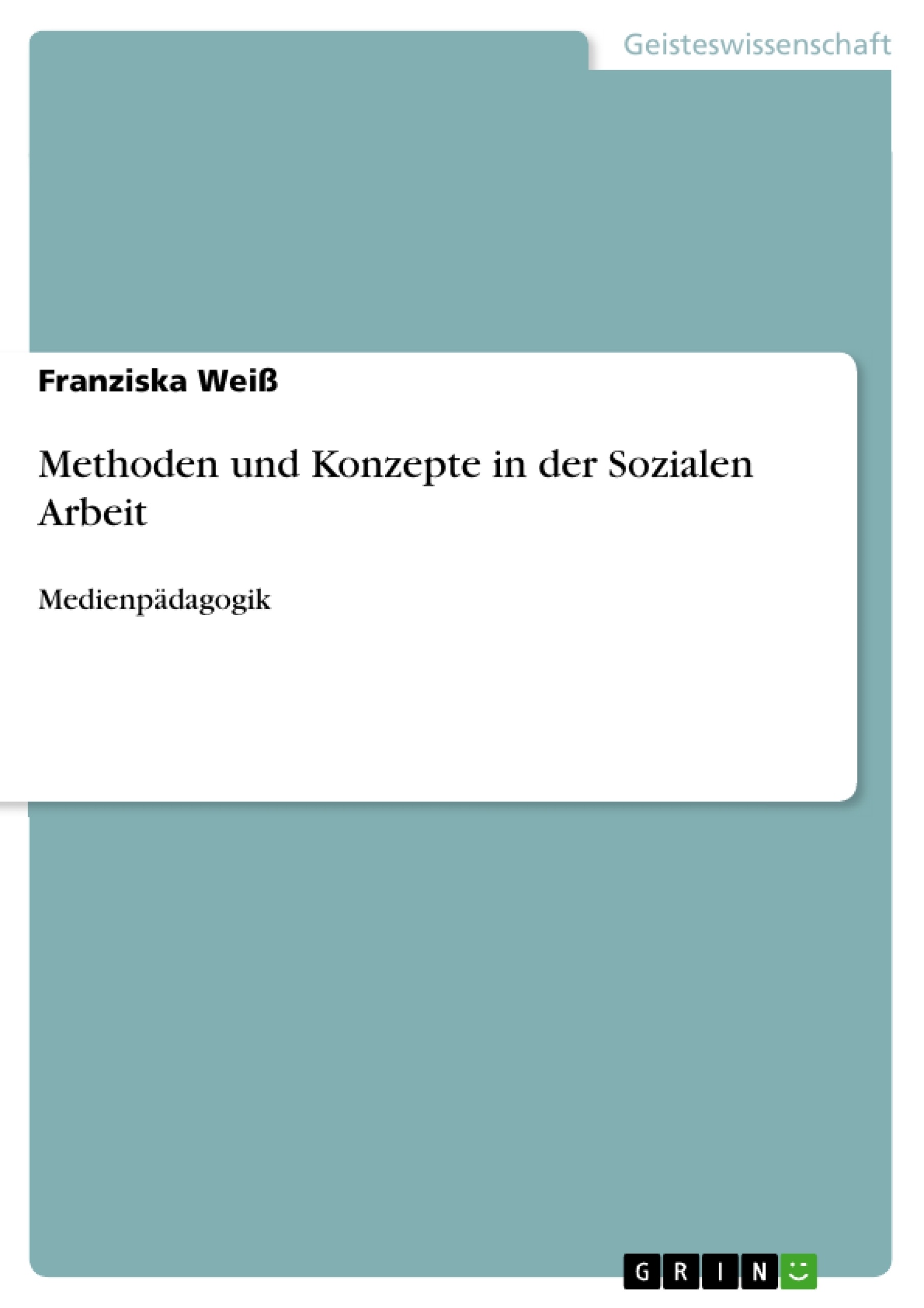Die folgende Arbeit ist im Rahmen des Studium der Sozialen Arbeit (BA) entstanden und ist als Sammlung verschiedener Teile zu betrachten. Die unterschiedlichen Stücke der Arbeit sind im groben in die Units 1 und 2, ästhetische Methoden zur Projektentwicklung und die Unit 3, Gesprächsführung unterteilt. Diese werden wiederum thematisch in Theorie, Methodik und persönliche Reflexion, bzw. Lernerfahrung gegliedert. Der Großteil handelt um die Entwicklungen und Erfahrungen, die zum Zweck einer Ausarbeitung eines fiktiven Projekts dienten, innerhalb der ersten und zweiten Unit des Modul 11. Hierbei wird die Annäherung an das vorgegebene Thema Geld in Form eines Filmes, das Beispielprojekt des Youth Video Museums, sowie eine praktische Übung eines möglichen Projekts beschreiben. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Auseinandersetzung mit dem Thema über das Medium eines Videos mit dem Namen „Money as Dept“ (Geld als Schuld).
In der Gesprächsführung wiederum wird sich besonders intensiv mit der Theorie und der geschichtlichen Einordnung des personenzentrierten Ansatzes beschäftigt.
Es soll hier verdeutlicht werden, dass dies nur Auszüge aus den tatsächlich behandelten Themen und Lernerfahrungen sind, die hier aufgegriffen werden und keinesfalls die ganze Breite zeigen, dies ist dem beschränkten Umfang der Arbeit zuzuschreiben.
Es wird vorwiegend die männliche Form verwendet, da diese allgemein gebräuchlich ist, ausschließlich in Zitaten werden verwendete weibliche Formen übernommen. Literaturangaben für Zitate stehen hinter diesen in Klammern, es werden keine Fußnoten verwendet.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung in das Portfolio
2 Einleitung: Modul 11 Unit 1 und 2
2.1 Methodische Einfuhrung des Dozenten
2.2 Gruppenbildung_ein erstes Zusammenfinden
3 Das fiktive Projekt
3.1 Der Film ,,Money as Dept“ (Geld als Schuld)
3.1.1 Methodik_die theoretische Betrachtung von Medienkritik
3.1.2 Erfahrene Methodik/Kritik
3.1.3 Eigener Lernprozess/Reflexion
3.2 Vorstellung des internationalen Projekts „YOUTH VIDEOMUSEUMS partnership44
3.2.1 Theorie_Was kann interkulturelle mediale Erfahrungen leisten?
3.2.2 Die theoretische Betrachtung methodischer Unterschiede in der Praxis und personliche Uberlegungen hierzu
3.2.3 Eigener Lernprozess in der Selbsterfahrung der verschiedenen Methoden..
3.3 Ein Anfang_konkretisierte Uberlegungen zum fiktiven Projekt am Beispiel des RAP-Projektes
3.3.1 Theorie_Methodik des Anfangs
3.3.2 Erfahrene Methodik des RAP-Proj ektes
3.3.3 Eigener Lernprozess_erste Ideen der konkreten Umsetzungsmoglichkeiten und allmahliche (innerliche) Konkretisierung
4 Gesprachsfuhrung: Modul 11 Unit 3
4.1 Theorie und Grundannahmen des personenzentrierten Ansatzes
4.1.1 Geschichtliche Einordnung
4.1.2 Aktives Zuhoren
4.2 Eigene Lernerfahrung
5 Fazit