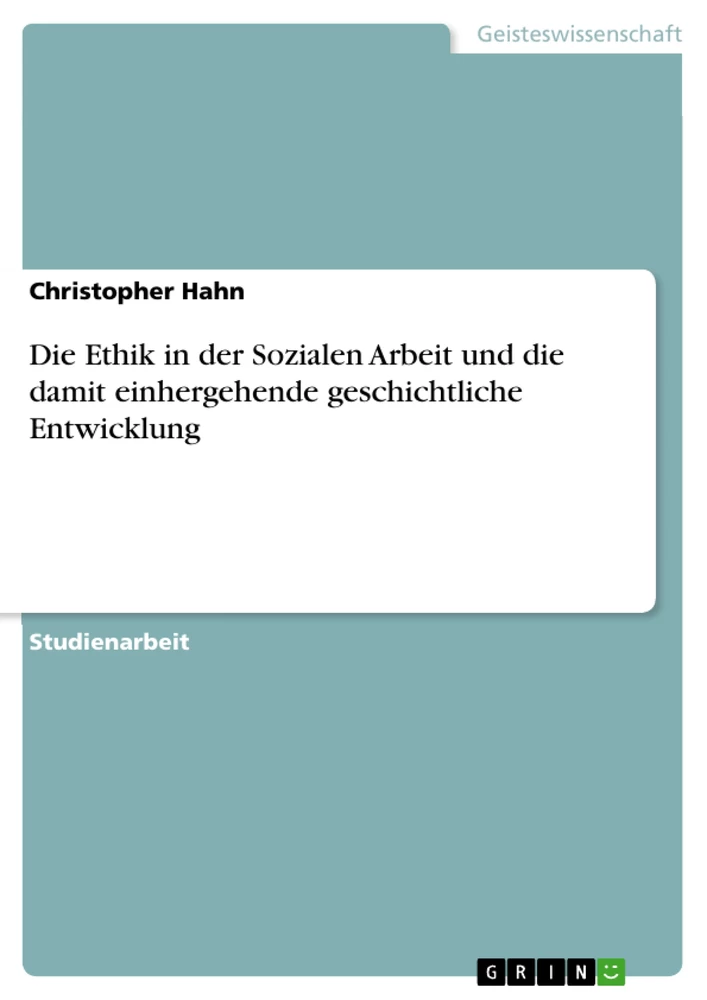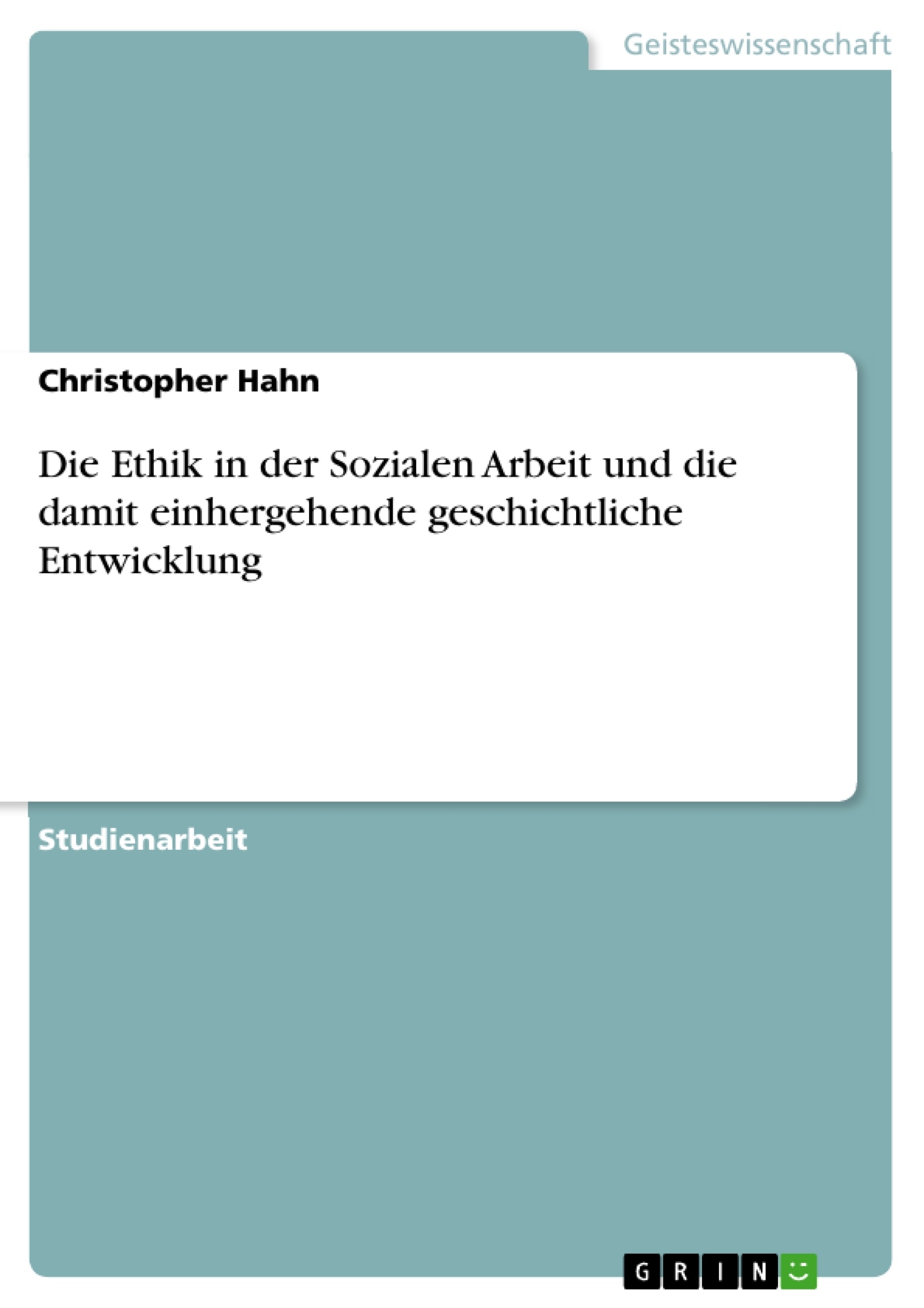Ethische Fragestellungen beeinflussen jegliche Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens, werden überwiegend jedoch nicht bewusst als solche wahrgenommen. Interaktionen zwischen Menschen sind geleitet von subjektiven oder kollektivistischen Wertvorstellungen. Permanent bewerten Menschen Situationen, Verhaltensweisen oder Charakterzüge was konkludierend bedeutet, dass Moral und Ethik als omnipräsente gesellschaftliche Phänomene zu betrachten sind. Der Begriff Ethik stammt von dem griechischen Wort „ēthikós“ (das Sittliche) ab und bedeutet im Allgemeinen die „Lehre vom moralisch guten Handeln.“ Hierbei kann jedoch nicht von der einen Ethik gesprochen werden, da es viele Ethiken gibt, die teilweise konträr zueinander ausgerichtet sind. Von dieser alltäglichen Erscheinungsform ethischer Grundsätze sind Ethiken zu unterscheiden, welche in einem professionellen Rahmen thematisiert werden, um Handlungsmöglichkeiten zu reflektieren und legitimieren. So verweist beispielsweise Dollinger (2012: S. 987) darauf, dass jeder, der systematisch auf andere Menschen einwirkt, sich zwangsläufig mit ethischen Fragestellungen befassen müsse. Dieser Sachverhalt ist in der Sozialen Arbeit gegeben, da ihre Akteure entscheidend in die Lebenszusammenhänge von Individuen eingreifen, was eine fachliche Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen unabdingbar macht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Berufsethik Sozialer Arbeit
2.1 Ethische Orientierung
2.2 Ethik in der Sozialen Arbeit
2.3 Verantwortungsethik
2.4 Empowerment statt Kolonialisierung
2.5 Ethikkodizes als berufsethische Grundlagen
3. Geschichtliche Hintergründe
3.1 Theologisch begründete Werte
3.2 Philosophisch begründete Werte
4. Schlusswort
Literaturverzeichnis