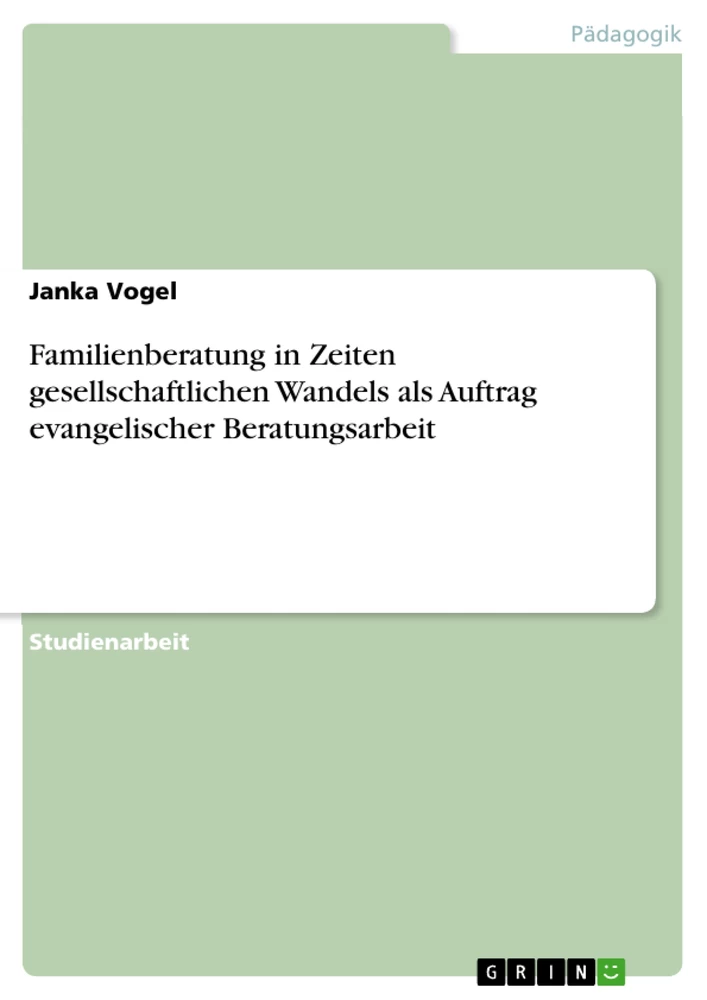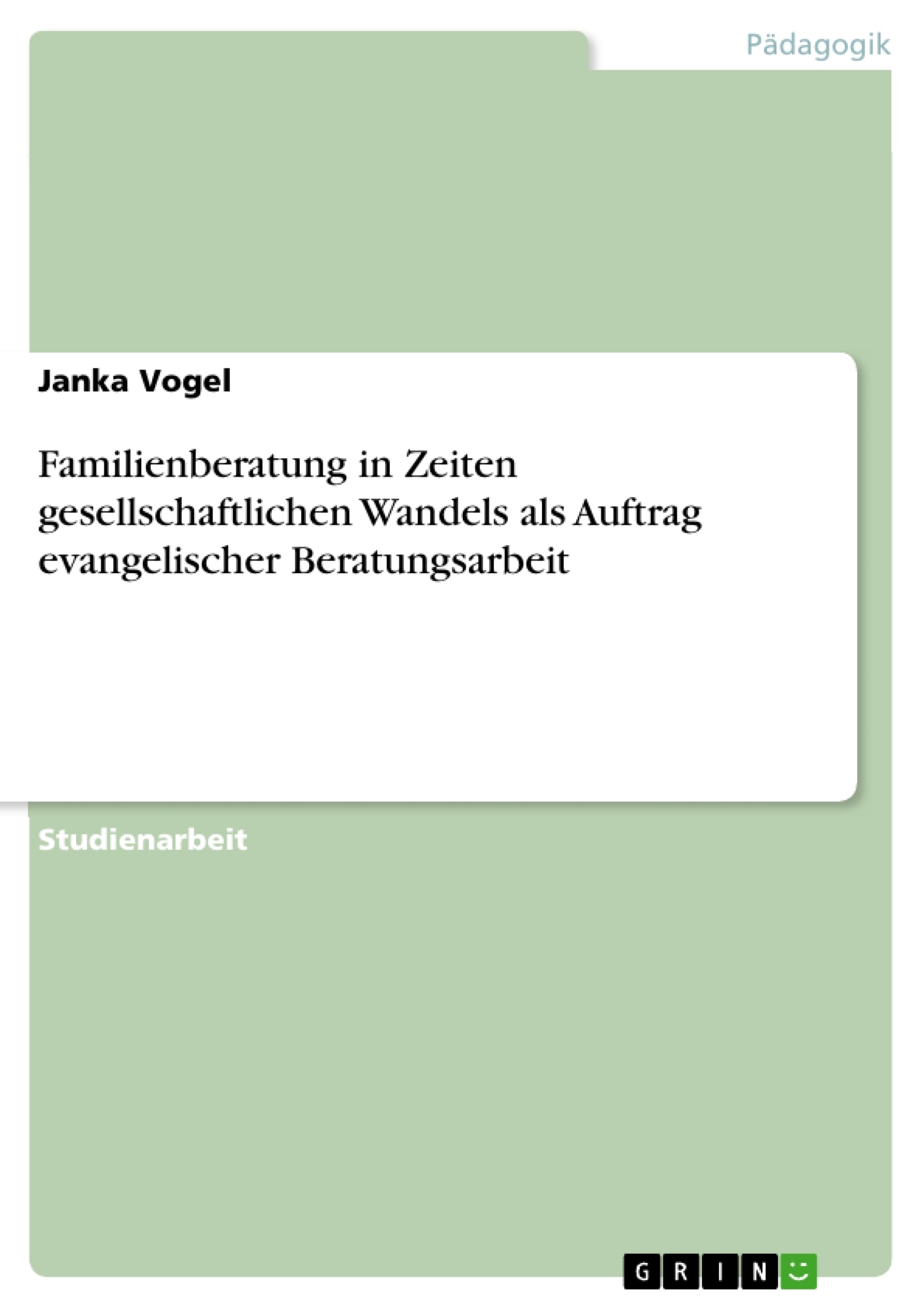Familienberatung ist weder im kirchlichen noch im sozialpädagogischen Kontext neu. Die Suche nach Rat im Allgemeinen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit, die Differenzierung von Beratungsangeboten dagegen hat erst im letzten Jahrhundert verstärkt eingesetzt. Ein Handbuch zur Familien- und Lebensberatung aus dem Jahre 1975 unterscheidet etwa zwischen Einzel-, Paar-, Familien-, Gruppen- und Organisationsberatung, sowie projektbezogener Beratung. Bauer et al. behandeln in ihrem 2012 herausgebrachten Grundlagenwerk sozialpädagogische Beratung, Schul- und Bildungsberatung im Jugendalter, Berufsberatung Jugendlicher, Weiterbildungsberatung, Familienberatung, feministische Frauenberatung und die Beratung pflegender Angehöriger als von einander abgrenzbare Beratungsformen.
Familienberatung wird da notwendig, wo Familien unter Druck geraten (sind), wo Problematiken sich häufen, die die Selbstheilungskräfte einer Familie übersteigen, oder wo komplexe Umstände zu extremer körperlicher, seelischer oder - und dies ist besonders in der kirchlichen Beratung relevant - geistlicher Belastung führen oder geführt haben. Familien geraten auch und aktuell wohl besonders in Bedrängnis, wenn die Bedingungen, die zu ihrem „Funktionieren“ notwendig sind, nicht oder in nicht ausreichendem Maße gegeben sind.
Familien - egal welcher Gestalt - brauchen Lebensraum, Raum zum Leben. Dass dieser Raum sich derzeit stark verändert, darauf deuten gesellschaftliche Vorgänge wie Urbanisierung und Gentrifizierung, stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen, später oder gar kein Kinderwunsch von Paaren, eine älter werdende Gesellschaft, die Pluralisierung von Lebensformen und -stilen, stärkere Individualisierung oder multiethnische Gemeinschaften unterschiedlichster Herkunft und Religion hin. Bedeuten die gesellschaftlichen Veränderungen eine Krise der Familie? Welchen Auftrag hat Beratung angesichts politischer, wirtschaftlicher und sozialer Bedrängnisse von Familien heute?
Im Folgenden soll dabei besonders die Frage nach dem Auftrag evangelischer Beratungsarbeit aufgeworfen werden. Mit Blick auf die im Juli diesen Jahres vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlichte Orientierungshilfe soll sie auf ihre Kriterien und Ziele befragt werden. Welche Orientierung kann diese Orientierungshilfe professionellen Beratern und Beraterinnen bieten?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gesellschaftlicher Wandel
2.1 Frauenerwerbstätigkeit und die Forderung nach gerechterer Verteilung der häuslichen Reproduktionsarbeit
2.2 Neue Lern- und Verhaltensschwierigkeiten
2.3 Globalisierte und transnationale Familien
3. Familienberatung
3.1 Warum Familienberatung heute die gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigen muss und welche Folgen das hat
3.2 Begleitung Rat suchender Familien als Auftrag der evangelischen Kirche
3.3 Die Orientierungshilfe des Rates der EKD und ihre Bedeutung für die evangelische Beratungsarbeit
4 Fazit
Literaturverzeichnis