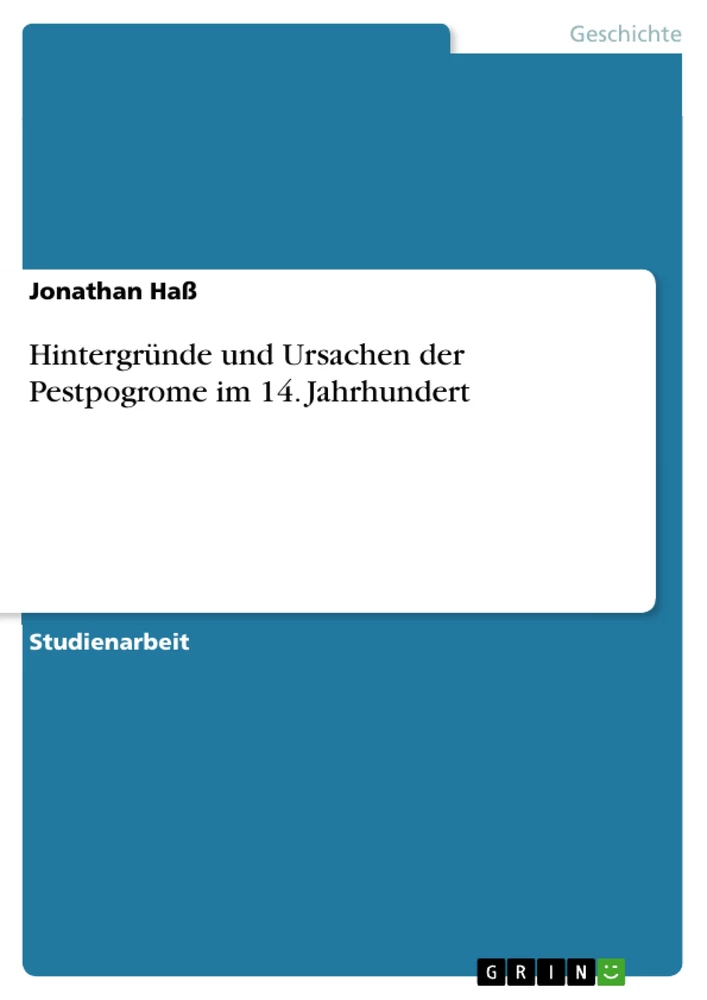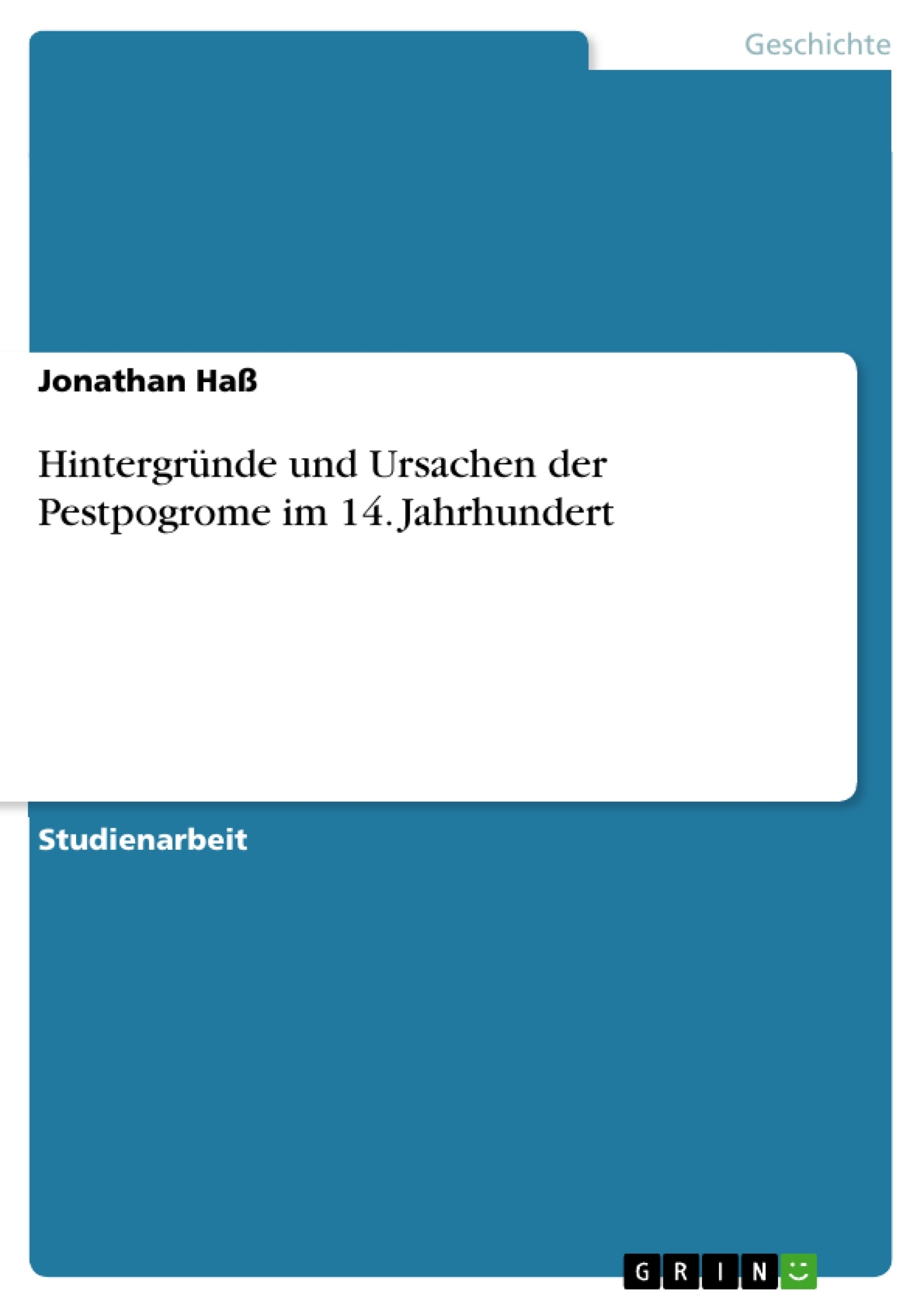Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Rahmen des Hauptseminars „Geschichte der Juden in Südwestdeutschland“ sowohl mit den allgemeinen Ursachen der spätmittelalterlichen Pestpogrome, als auch mit den jeweiligen Motiven der ausführenden Kräfte. Vor diesem Hintergrund müssen die Basisfaktoren bezüglich der Judenverfolgungen, welche zweifelsohne als die schwerwiegendste jüdische Katastrophe vor dem Holocaust angesehen werden kann, einer differenzierten Analyse unterzogen werden. Zu diesen überregional wirksamen Konstanten, welche für die Gesamtheit der Pestpogrome gelten können, zählen neben den poltischen und ökonomischen Aspekten im Reich auch die Stellung der Juden innerhalb der Gesellschaft. Diesbezüglich gilt es insbesondere das sich im Spätmittelalter konstant verschlechternde Verhältnis zwischen der christlichen Gesellschaft und den Juden zu untersuchen. Die Darstellungen hinsichtlich dieser Aspekte werden eingebettet in den Gesamtrahmen des „Schwarzen Todes“, welcher sowohl die Pesttheorien des Spätmittelalters als auch den tatsächlichen Verlauf der tödlichen Seuche beinhaltet. All jene Faktoren, die in Teilen nur scheinbar peripher mit der Thematik der vorliegenden Arbeit zusammenhängen, sind notwendig, um ein Gesamtbild der Situation in der Mitte des 14. Jahrhunderts zu erhalten.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit drei speziell ausgewählten Beispielen, welche einen tieferen Einblick in die Einzelkomponenten der Pestpogrome erlauben. In diesem Kontext wird vornehmlich die Thematik der angeblichen Brunnenvergiftung durch die Juden sowie deren vordergründige Verwendung zur Anklage gegen dieselben näher betrachtet. Auch wenn die exemplarischen Beispiele nur einen Ausschnitt aus dem Gesamtbild der Pestpogrome widergeben können - sind doch die einzelnen Verläufe in aller Regel sehr vielschichtig und komplex, so sollen die Ereignisse der Städte Freiburg im Breisgau, Nürnberg und Straßburg stellvertretend behandelt werden. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf den Umbrüchen innerhalb der urbanen Räume, welche sich hauptsächlich in den Machtkämpfen zwischen Patriziern und den sukzessiv in die Räte drängenden Zünften widerspiegelten. Welche Rolle der jüdischen Bevölkerung in diesem Konflikt zukam und inwiefern die zu Beginn angesprochenen fiskalischen Interessen der Gewalttäter als wirkliches Motiv für das Judenmorden angeführt werden können, sollen die Analysen im letzten Teil der Arbeit aufzeigen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Europa am Vorabend der Pest – Das 14. Jahrhundert in der Krise
2.1 Agrarkrise und gesamtwirtschaftliche Rezession
3. Spätmittelalterliche Pesttheorien - Versuche der Deutung und Begründung der Pestilencia Magna 4
4. Tatsächlicher Ursprung und Verlauf des „Schwarzen Todes“
5. Die Stellung der Juden im Spätmittelalter – Ein Verhältnis der Ausgrenzung
5.1 Gewalttätigkeiten an Juden im Spätmittelalter – Voraussetzung für die Pestpogrome?
5.2 Legenden um Hostienschändung und Ritualmord –Die Vorwände für Gewalttätigkeiten gegen die jüdische Bevölkerung
6. Die angebliche Brunnenvergiftung jüdischer Verschwörer – Die spätmittelalterliche Gesellschaft zwischen Hysterie und Judenhass
7. Die Pestpogrome: Verlauf und Ursache anhand drei exemplarischer Beispiele
7.1 Unrast in den Städten – Das spätmittelalterliche System im Umbruch
7.2 Der Pestpogrom in Freiburg i. Breisgau
7.3 Der Pestpogrom in Nürnberg
7.4 Der Pestpogrom in Straßburg
8. Die Rolle der Geißler im Kontext der Pestpogrome
9. Fazit
10. Literaturverzeichnis
Quellen
Sekundärliteratur