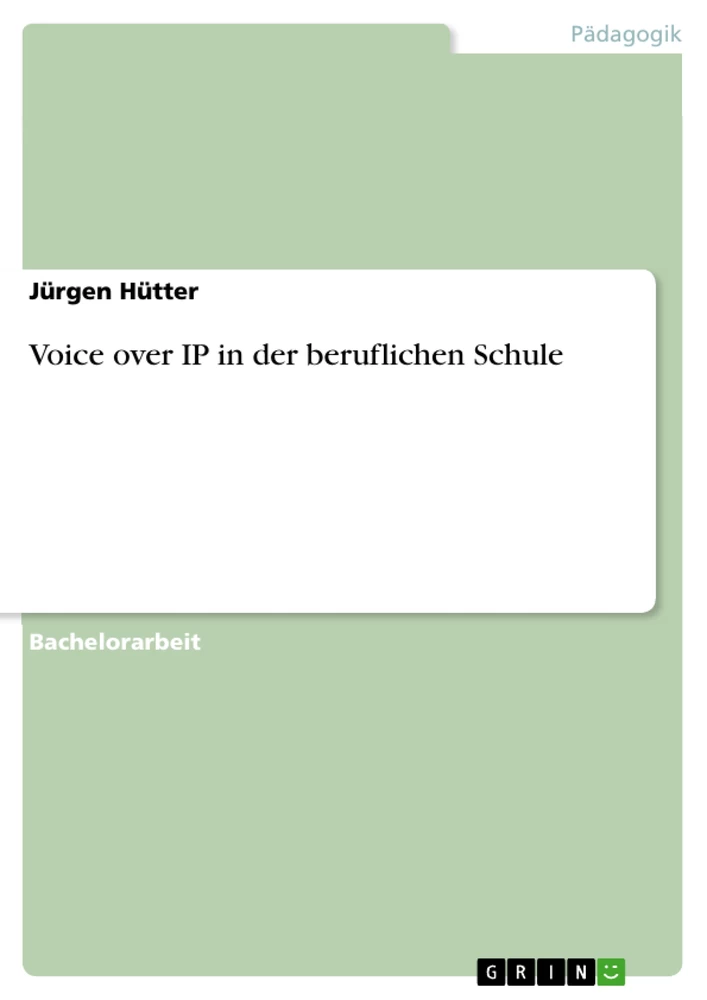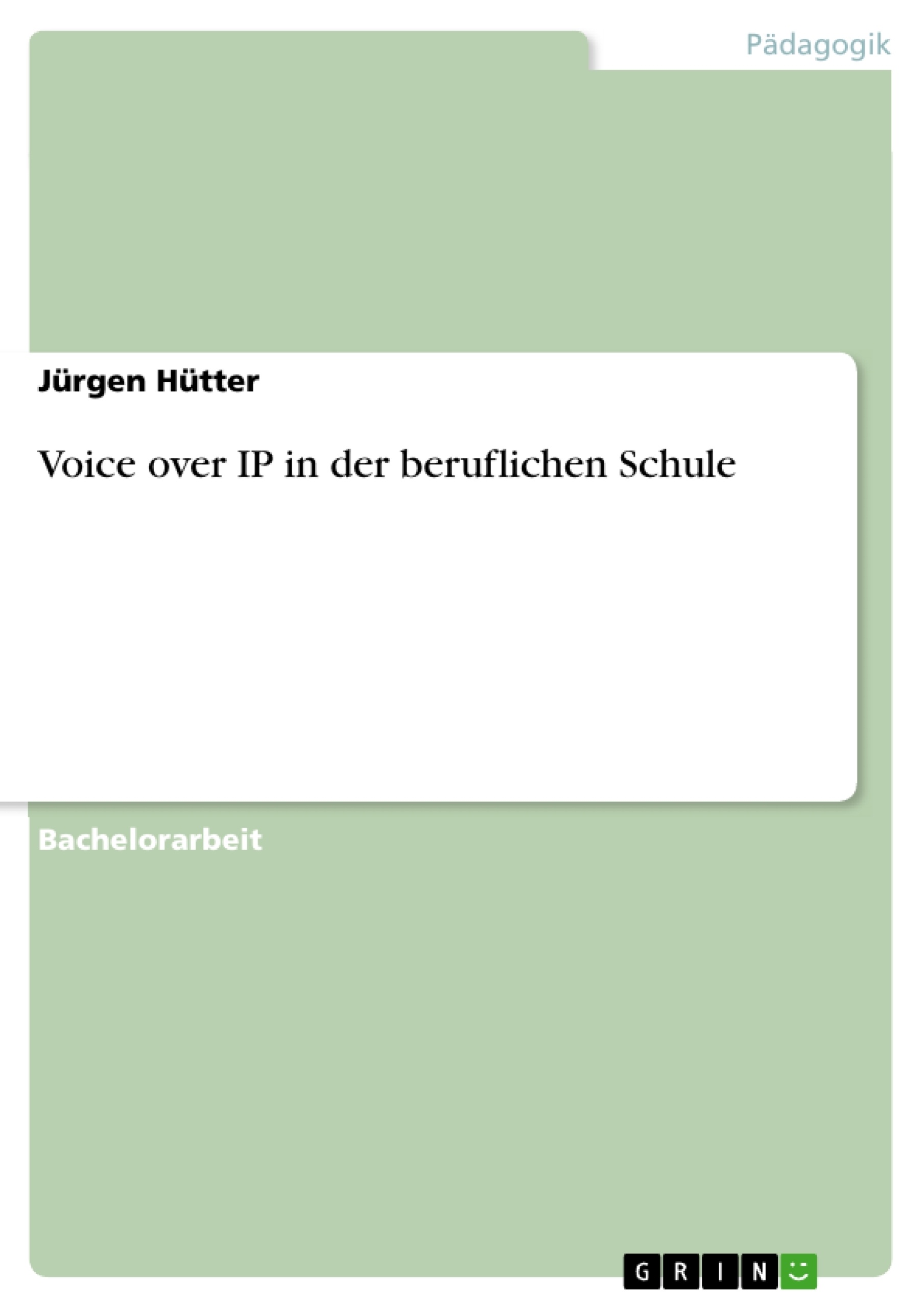Voice over IP wird in der Wirtschaft immer wichtiger, da es kostengünstig ist. Dies führt zu der Überlegung, VoIP auch an beruflichen Schulen einzuführen und Auszubildende darin zu schulen. Da es jedoch eine große Auswahl an Voice-over-IP-Programmen gibt, bietet meine Arbeit eine Übersicht über die bekanntesten Softwaren, zeigt Vor- und Nachteile auf und hilft bei der Entscheidung für ein geeignetes Programm anhand verschiedener schul- und lehrerbedingter Kriterien.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Problemstellung
2.1 Problembeschreibung
2.2 Mindestanforderungen an die Konzepte
2.2.1 Einstellungsmöglichkeiten der Privatsphäre
2.2.2 Stummschaltung des Mikrofons
2.2.3 Gruppenspeicherung
2.2.4 Interne Weiterleitung
2.2.5 Kontaktlistenweiterleitung
2.2.6 Sprachnachrichten
2.2.7 Kategorisierung der Kontaktliste
2.2.8 Gesprächsaufzeichnung
2.2.9 Gruppenskizzenprogramme
2.2.10 Bildschirmfreigabe
3. Vorstellung der drei Hauptprogramme
3.1 Skype
3.2 ICQ
3.3 TeamSpeak
4. Die Konzepte
4.1 Didaktischer und wirtschaftlicher Mehrwert von VoIP-Konzepten
4.2 Skype-Konzept
4.2.1 Konfiguration der Software
4.2.2 Einführung der Software
4.2.3 Abgleich der Mindestanforderungen
4.2.4 Anforderungen an den Lehrer
4.2.5 Vor- und Nachteile des Konzepts
4.3 ICQ-Konzept
4.3.1 Konfiguration der Software
4.3.2 Einführung der Software
4.3.3 Abgleich der Mindestanforderungen
4.3.4 Anforderungen an den Lehrer
4.3.5 Vor- und Nachteile des Konzepts
4.4 TeamSpeak-Konzept
4.4.1 Konfiguration der Software
4.4.2 Einführung der Software
4.4.3 Abgleich der Mindestanforderungen
4.4.4 Anforderungen an den Lehrer
4.4.5 Vor- und Nachteile des Konzepts
5. Preisvergleich
6. Empfehlung für spezifische Lehrertypen und Schulbudgets
7. Anhang
Abbildung 1 - Anteil der Haushalte mit Computer in europäischen Ländern 2012
Abbildung 2 - Anzahl der Internetnutzer weltweit nach Regionen 2012 (Internet World Stats, 2012)
Abbildung 3 - Internetnutzung in Deutschland bis 2013 (Initiative D21, 2013)
Abbildung 4 - Dauer der Internetnutzung weltweit 2012 (nach Regionen)
Abbildung 5 - Kinder - Computerkenntnisse vs. grundlegende Fähigkeiten
Abbildung 6 - Interesse an IP-Telefonie 2010
Abbildung 7 - Skype - registrierte und zahlende Nutzer
8. Literaturverzeichnis