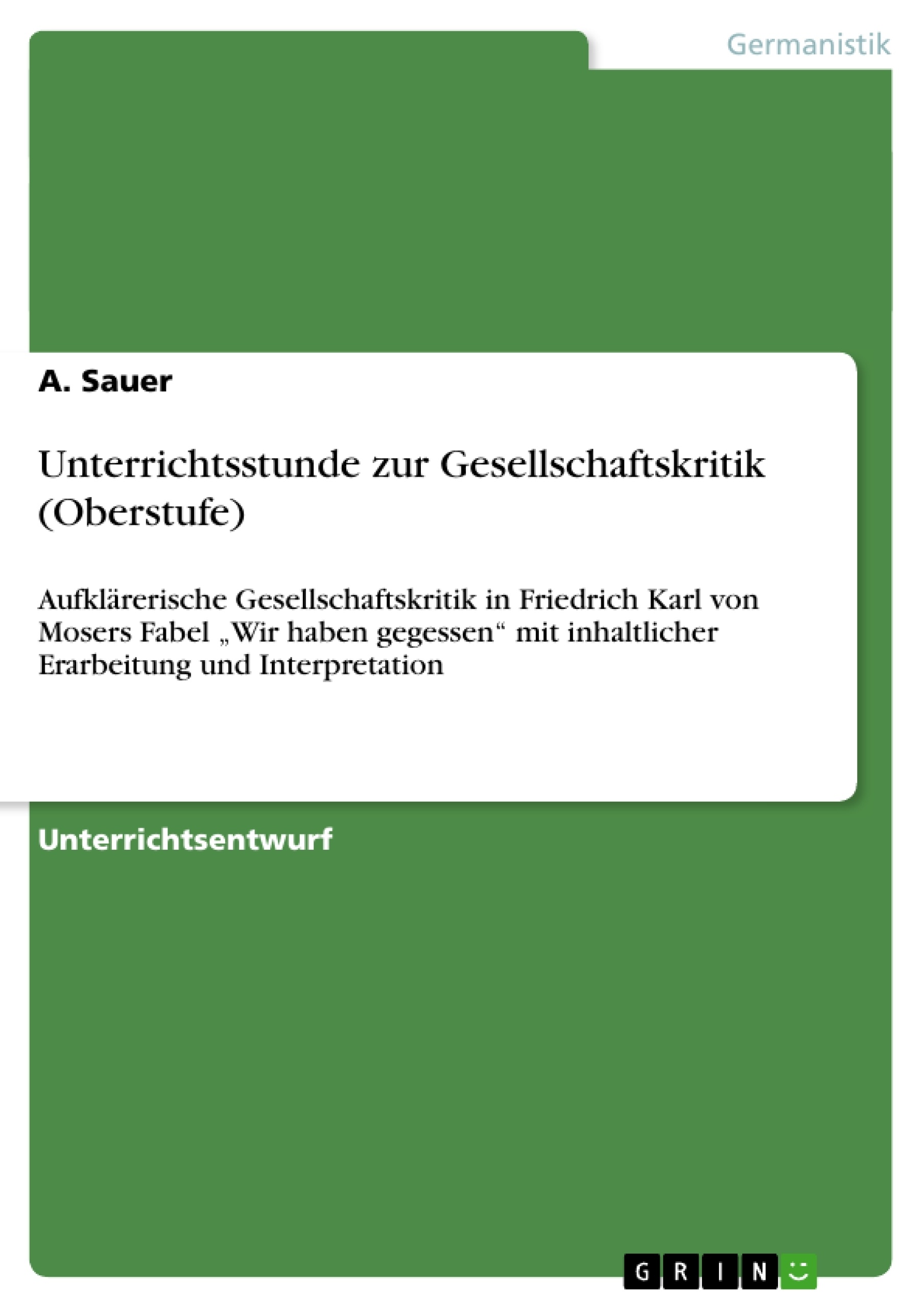Unterrichtsentwurf zu "Nathan der Weise" in Form einer Auskopplung durch eine Fabel als darstellende Unterscheidung der Epochen Aufklärung und Sturm und Drang
Sachanalytische Überlegungen
Die Fabel „Wir haben gegessen“ von Friedrich Karl von Moser aus dem Jahr 1786 thematisiert den damaligen Status des Volkes gegenüber des Adels. Es wird auf die Epoche der Aufklärung Bezug genommen, deren Hauptaussage es war, seinen eigenen Verstand und Vernunft einzusetzen, Gegebenheiten kritisch zu prüfen und selbständig zu denken. Dieses selbständige Denken wird in der Fabel durch den Sperber versinnbildlicht, der sich nicht wie die restliche Horde Vögel damit zufrieden gibt, den anderen nur beim Essen zuzuschauen. Hinsichtlich der Epoche der Aufklärung sollte diese Fabel das Volk aufrütteln, sich nicht wie die Horde Vögel zu verhalten und sich mit der für sie benachteiligten Situation zu begnügen, sondern sich gegen das Unrecht zur Wehr zu setzen und für die eigenen Interessen zu sorgen. Neben der Aufklärung, die eine geistige und kulturelle Strömung darstellte, ....
Lösung:
Inhalt:
Adler veranstaltet Fest, zu dem er alle Vögel einlädt. Diese dürfen ihm aber nur beim Essen zusehen und bekommen selbst nichts ab; der Adler frisst schließlich für seinen „Staat“ mit“
Gruppe 1: Form und Aufbau
• Fabel in Prosa, kurz + in einfacher Sprache > damit es auch Bürgertum versteht
• 2 Teile: Ausgangssituation; Aktion + Reaktion
Aktion geht vom Sperber aus, Reaktion vom Adler
• Kein Lehrsatz / Moral (Promytheon) > Leser soll sich diese selbst erschließen + auf aktuelle Sit. beziehen!
Typ. Für AK: Autor will Leser zum selbständigen Denken erziehen (Kant)
Leser muss Fabel verstehen, interpretieren + auf akt. Zeit anwenden
Gruppe 2: Symbole und ihre Bedeutung
• Adler = absolutistischer Herrscher dieser Zeit > typ, Verhalten für abs. Adligen
Orientiert am Sonnenkönig („Der Staat bin ich“)
• Mitfressen: einer sorgt für alle
• Restliche Vögel = Volk > Hatten unter dem Herrscher zu leiden
• Heißhunger = Leid, das die Bevölkerung durch ihren Herrscher erfahren musste
.......
Unterrichtsstunde zur Gesellschaftskritik (Oberstufe)
Aufklärerische Gesellschaftskritik in Friedrich Karl von Mosers Fabel „Wir haben gegessen“ mit inhaltlicher Erarbeitung und Interpretation
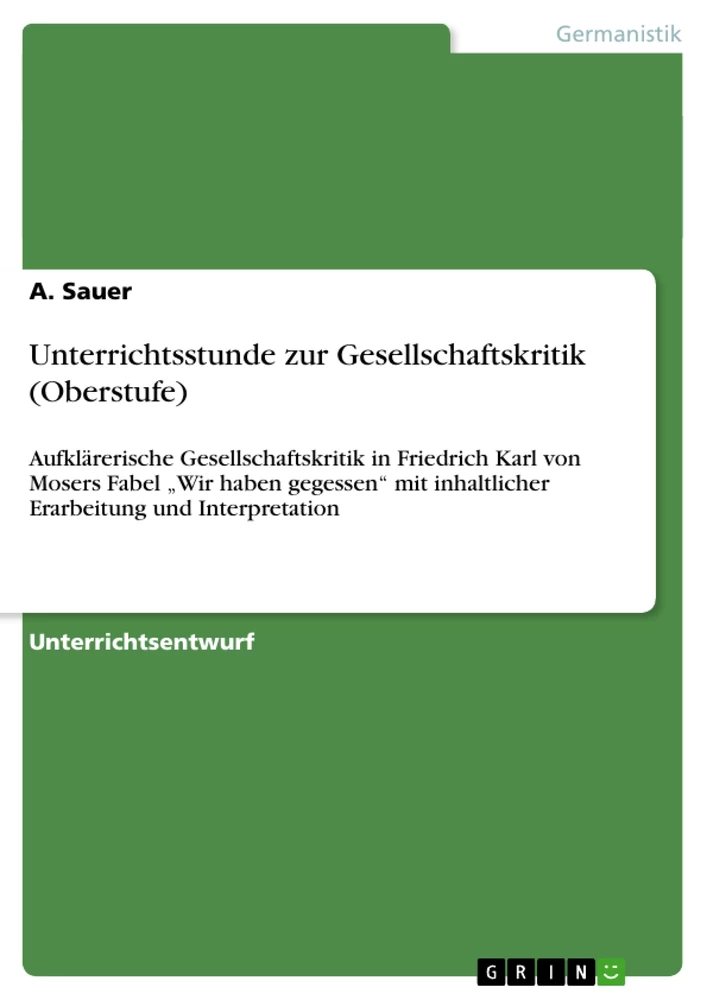
Unterrichtsentwurf , 2012 , 9 Seiten
Autor:in: A. Sauer (Autor:in)
Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft
Leseprobe & Details Blick ins Buch