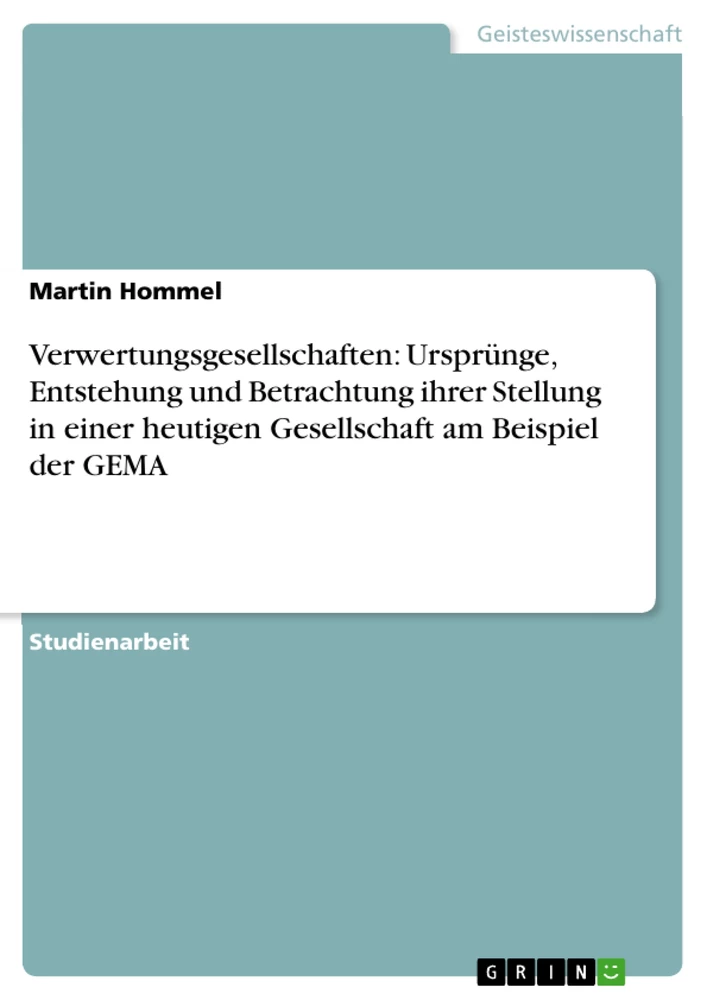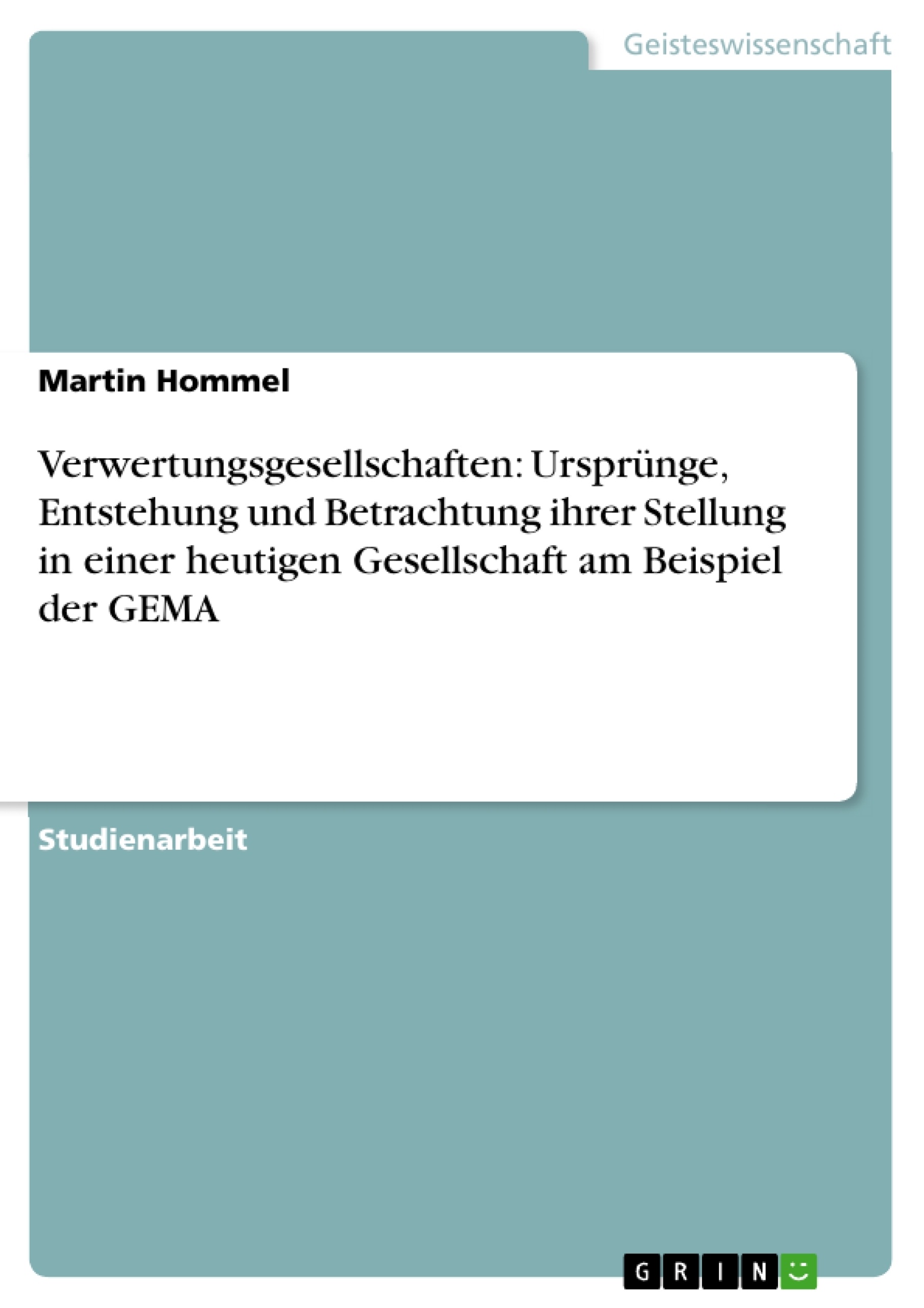Wie oft hören wir heutzutage vom Streit zwischen Künstlern, Verwaltungsgesellschaften und Onlinediensten wie Youtube oder Spotify. Im wieder geht es um die Frage des Urheberrechts und wie man mit ihm umgehen soll. Das ist Thema ist aktueller denn je, und jeder, ob beteiligt oder nicht, hat wohl so seine eigene Meinung dazu.
Klar ist, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem es immer einfacher wird urheberrechtlich geschützte Werke massenhaft zu nutzen. Es wäre einem einzelnem Urheber (Künstler, Musiker, Produzenten) daher nahezu unmöglich seine Vergütungsansprüche komplett allein durchzusetzen. Er müsste immer genau wissen wo, wann, von wem und zu welchem Zweck, seine Werke gerade genutzt werden. Auch einzelne Veranstalter und ausführende Künstler wären mit der Aufgabe überfordert, bei allen Rechteinhabern, deren Stücke sie aufführen, Genehmigungen und Aufführungsrechte einzuholen. Ein gut funktionierendes System an Verwertungsgesellschaften ist daher für jeden Urheber sowie Nutzer urheberrechtlich geschützter Werke unverzichtbar.
In der Hausarbeit sollen Ursprünge und Arbeitsweisen von Verwertungsgesellschaften allgemein beschrieben werden. Des weiteren soll die wohl am meisten diskutierte deutsche Verwertungsgesellschaft, die GEMA, vorgestellt werden und sich kritisch mit ihren Wirkungsweisen und den daraus immer wieder entstehenden Diskussionen auseinandergesetzt werden.
Am Ende soll sich die Frage stellen, ob Verwertungsgesellschaften wie die GEMA überhaupt noch zeitgemäß sind oder ob es neuen Ideen bedarf.
Inhalt
1. Einleitung
2. Verwertungsgesellschaften
2.1 Definition
2.2 Geschichte
2.3 Internationale Dachverbände
3. Die GEMA
3.1 Definition
3.2 Mitgliederstruktur
3.3 Vergütung, Pauschalabgabe, Tantiemen
3.3.1 Vergütung
3.3.2 Pauschalabgaben
3.3.3 Tantiemen
3.4 Kritik
3.4.1 Kritik von Innen
3.4.2 Kritik von außen
4. Schlussbemerkung
5. Literatur: