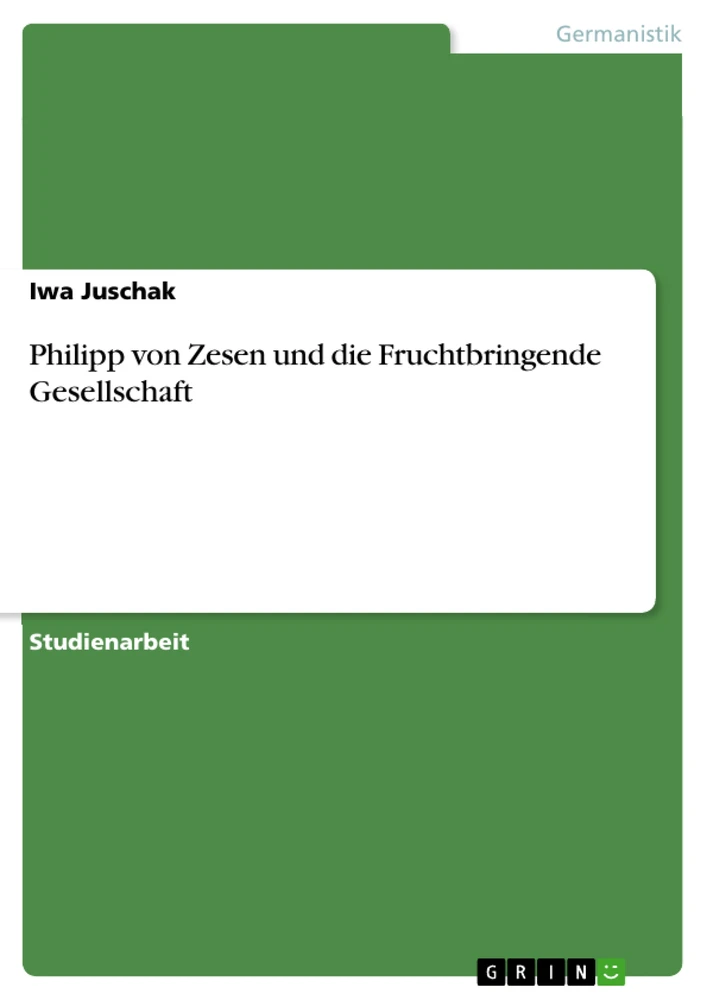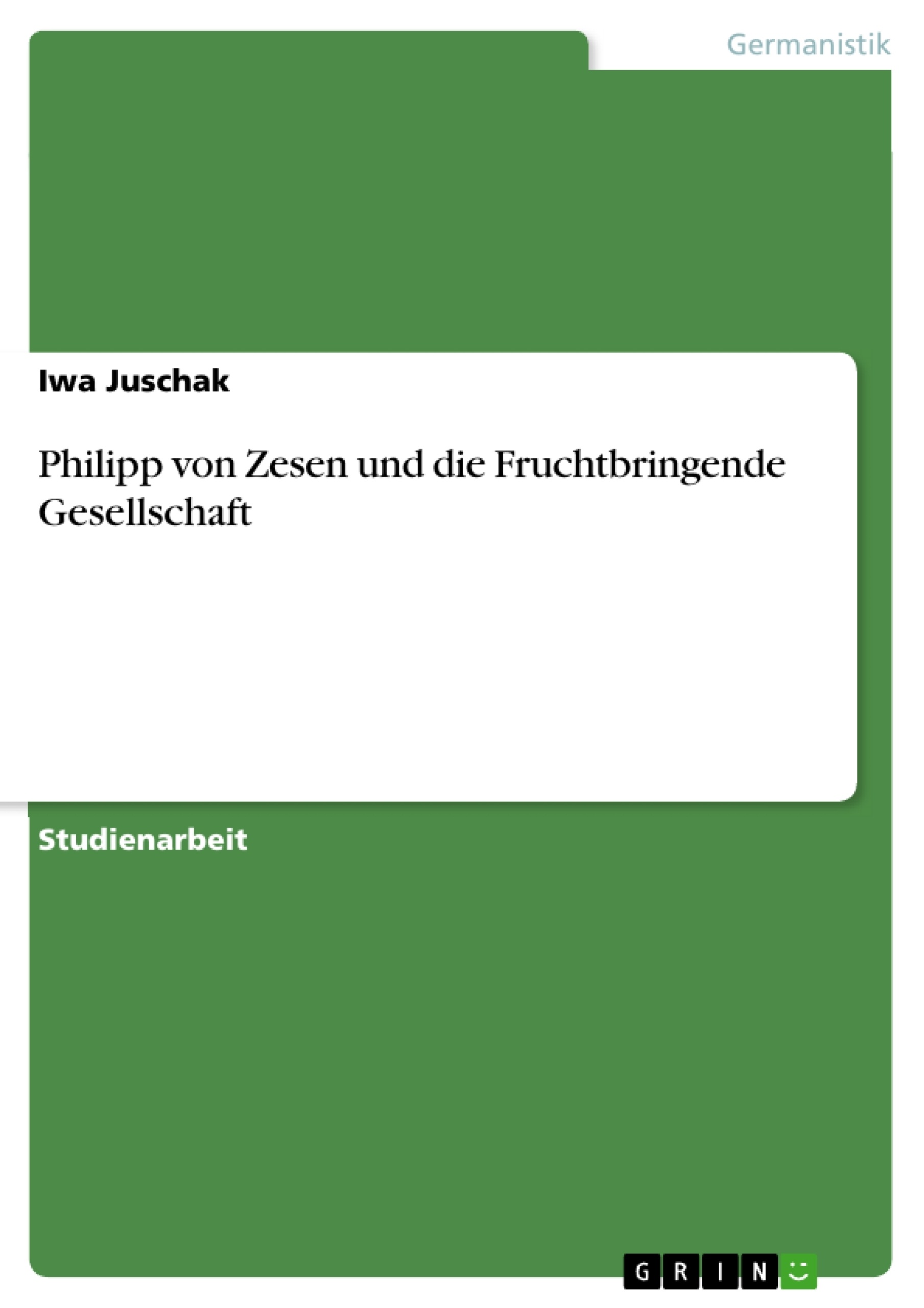Aus der Vielzahl der Sprachgesellschaften, die im 17. Jahrhundert in Deutschland entstanden, tritt die Fruchtbringende Gesellschaft als die wohl bedeutendste unter ihnen hervor. Ihr Anliegen war es, den durch verschiedene Faktoren begünstigten Sprachmischungstendenzen im Deutschen mit Hilfe von Reformen auf lexikalischer und orthographischer Ebene entgegenzuwirken. Es galt Ansehen und Würde der deutschen Sprache zu stärken und ihre Fähigkeit im literarischen und poetologischen Kontext unter Beweis zu stellen. Damit einhergehend entwickelte sich ein regelrechter Kulturpatriotismus, ein „Sprachen- und Literaturpolitischer Kampf gegen das Kulturmonopol von Fremd-, Universal- und Prestigesprachen“.
Philipp von Zesen (ab 1648 Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft) trat besonders radikal für die Reinhaltung der deutschen Sprache ein und polarisierte bereits zu Lebzeiten durch seine Reformversuche. In der Forschungsliteratur wird Zesen gleichzeitig als „bedeutendster und literarisch fruchtbarster Sprachpfleger“ wie auch „als eine der umstrittensten literarischen Persönlichkeiten des
17. Jahrhunderts“5 beschrieben. Diese Polarisierung verdankt er nicht zuletzt seinen mannigfaltigen Eindeutschungsversuchen fremdsprachlicher Ausdrücke.
Die vorliegende Arbeit wird sich im ersten Teil einer Darstellung der Fruchtbringenden Gesellschaft widmen, sie in den zeitgeschichtlichen Kontext einbetten sowie ihre Leistungen und Wirkungen umreißen.
Der zweite Teil der Arbeit wird sich speziell dem Sprachpfleger Philipp von Zesen zuwenden, seine lexikalischen und orthographischen Reformversuche beleuchten und auf seine Mitgliedschaft in der Fruchtbringenden Gesellschaft eingehen. Als Abschluss dieses zweiten Teiles soll der Versuch einer Analyse eines Textauszuges aus Zesens „Spraach-Uebung“ stattfinden.
Inhalt
1. Einleitung
2. Historischer Kontext
2.1 Politische Ausgangslage
2.2 Situation und Stellung der deutschen Sprache
3. Die Fruchtbringende Gesellschaft
3.1.Gründung und Organisation
3.2.Arbeit, Leistung und Wirkung der Fruchtbringenden Gesellschaft
4. Philipp von Zesen
4.1.Die Deutschgesinnte Genossenschaft
4.2.Zesens Sprachtheorie
4.2.1. Lexikologie
4.2.2. Orthographie
4.3.Zesen als Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
4.4.Textanalyse
5. Fazit und Ausblick
Literaturliste
1. Einleitung
Aus der Vielzahl der Sprachgesellschaften, die im 17. Jahrhundert in Deutschland entstanden, tritt die Fruchtbringende Gesellschaft als die wohl bedeutendste unter ihnen hervor.[1] Ihr Anliegen war es, den durch verschiedene Faktoren begünstigten Sprachmischungstendenzen im Deutschen mit Hilfe von Reformen auf lexikalischer und orthographischer Ebene entgegenzuwirken. Es galt Ansehen und Würde der deutschen Sprache zu stärken und ihre Fähigkeit im literarischen und poetologischen Kontext unter Beweis zu stellen. Damit einhergehend entwickelte sich ein regelrechter Kulturpatriotismus, ein „Sprachen- und Literaturpolitischer Kampf gegen das Kulturmonopol von Fremd-, Universal- und Prestigesprachen“[2].
Philipp von Zesen (ab 1648 Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft[3] ) trat besonders radikal für die Reinhaltung der deutschen Sprache ein und polarisierte bereits zu Lebzeiten durch seine Reformversuche. In der Forschungsliteratur wird Zesen gleichzeitig als „bedeutendster und literarisch fruchtbarster Sprachpfleger“[4] wie auch „als eine der umstrittensten literarischen Persönlichkeiten des
17. Jahrhunderts“[5] beschrieben. Diese Polarisierung verdankt er nicht zuletzt seinen mannigfaltigen Eindeutschungsversuchen fremdsprachlicher Ausdrücke.
Die vorliegende Arbeit wird sich im ersten Teil einer Darstellung der Fruchtbringenden Gesellschaft widmen, sie in den zeitgeschichtlichen Kontext einbetten sowie ihre Leistungen und Wirkungen umreißen.
Der zweite Teil der Arbeit wird sich speziell dem Sprachpfleger Philipp von Zesen zuwenden, seine lexikalischen und orthographischen Reformversuche beleuchten und auf seine Mitgliedschaft in der Fruchtbringenden Gesellschaft eingehen. Als Abschluss dieses zweiten Teiles soll der Versuch einer Analyse eines Textauszuges aus Zesens „Spraach-Uebung“ stattfinden.
2. Historischer Kontext
Die sprachpflegerische Arbeit der Fruchtbringenden Gesellschaft kann nur schwer aus dem historischen Kontext herausgenommen und verstanden werden. Ihr Anliegen, die deutsche Sprache zu kultivieren, wurzelt in politischen und kulturellen Umständen der damaligen Zeit und ist als Reaktion auf diese zu verstehen.
Im Folgenden soll es darum gehen, sowohl die politischen Bedingungen des 17. Jahrhunderts als auch die Situation der deutschen Sprache zu beleuchten.
2.1. Politik
Die Reformation durch Luther bewirkte eine konfessionelle Spaltung Europas. Das ehemals einheitlich katholische Kirchenfundament zerbrach und mit ihm zerfiel das Reich in konfessionelle Gegensätze. Während Süddeutschland, Österreich, Frankreich und Spanien im Katholizismus verwurzelt blieben, wandten sich Mittel- und Norddeutschland dem Protestantismus zu. Die konfessionellen Gegensätze führten schließlich im Jahre 1618 zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. In seinem Verlauf spielten mehr und mehr macht- und verfassungspolitische Fragen eine tragende Rolle. Die Fürstenbünde, welche sich zu Beginn des Krieges aufgrund gegensätzlicher Glaubensauffassungen im Streit befanden, begannen nun um die Hegemonie in Europa zu rivalisieren. Es gab Auseinandersetzungen um die Stellung der Monarchie im Reich zwischen den Ständen und der Krone.
Der Dreißigjährige Krieg endete im Jahre 1648 mit dem Westfälischen Frieden. Religionspolitisch sicherte dieser die Gleichstellung beider Glaubensrichtungen, verfassungspolitisch die „Besiegelung des deutschen Vielstaaterei-Absolutismus“[6].
2.2. Sprache
Die im vorhergehenden Abschnitt aufgezeigten politischen Ereignisse blieben nicht ohne Folgen für die Entwicklung der deutschen Sprache. Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen hatte durch den Dreißigjährigen Krieg an Macht und Ansehen verloren. Der Rückschritt betraf dabei sowohl den wirtschaftlichen Bereich, in welchem sich eine „schleichende Krise“[7] bemerkbar machte als auch die Stellung der deutschen Sprache im Kontext anderer europäischer Sprachen. Während europäische Nationen wie England und Frankreich im Merkantilismus aufstrebten und Nationalstolz entwickelten, blieb Deutschland, nicht zuletzt aufgrund seiner territorialen Zergliederung, ein solcher Aufstieg verwehrt. Mit dem Verlust an politischer und wirtschaftlicher Macht, und mit dem, auf die Vielstaaterei zurückzuführenden Mangel an nationaler Identität, ging auch ein Verlust des Ansehens der deutschen Sprache einher.[8] Die deutsche Sprache konnte sich im Kontext anderer europäischer Sprachen nur schwer behaupten. Zwar hatte Martin Luther durch seine Bibelübersetzungen zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache beigetragen, doch wurde die Entwicklung einer einheitlichen deutschen Hochsprache durch zwei Faktoren vereitelt. Zum einen war mit dem Westfälischen Frieden die Konsolidierung der „quasi-souveränen“[9] Territorialstaaten erreicht worden. Zum anderen fand eine verstärkte Hinwendung der Fürstenhöfe zu fremden Sprachen statt.[10] Neben dem Lateinischen als „Institutions- und Wissenschaftssprache“[11] bediente man sich bei Hofe in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts vor allem des Italienischen, Welschen und Spanischen.[12] Ab Mitte des 17. Jahrhunderts trat der Gebrauch des Französischen mehr und mehr in den Vordergrund.[13] Diese Orientierung an der französischen Sprachkultur deutete sich bereits vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges an und lag, nach Polenz zum einen in dem Streben der deutschen Fürsten nach „Sozialdistanzierung“[14] von unteren, des Französischen nicht mächtigen, Ständen. Zum anderen lag sie in „dem als Konsumzwang erklärbaren Luxusbedürfnis der deutschen Fürstenhöfe [...]“[15] begründet. Die Alamodesprache Französisch fand in „allen Gebieten gesellschaftlichen Lebens“[16] Verwendung und breitete sich bald über die Grenzen der Fürstenhöfe hinweg aus. Die Quellen ins Deutsche eindringender Fremdworte waren vielfältig. Französische Begriffe wurden vor allem durch die „Peuplierungspolitik der Landesherren“[17] die Aufnahme französischer Hugenotten und Waldenser, in den deutschen Sprachraum getragen. Da Frankreich kulturell weiter entwickelt war als Deutschland, das heißt, über Kulturgüter verfügte, die man in Deutschland bis dato nicht kannte und dementsprechend auch nicht mit eigenen Begriffen bezeichnen konnte, kam es zu Entlehnungen aus dem französischen Sprachgut. Die „Schließung der Lücken im Wortfeld“[18] bezeichnet Polenz als „sachlichen Kulturimport“[19]. Die Integration fremdsprachlicher Begriffe erfolgte überdies durch literarische Übersetzungen, welche als Übung für die eigene Schriftstellerei galten und oftmals fremdsprachliche Ausdrücke beibehielten.[20] Zudem fanden fremdsprachliche Ausdrücke, die durch Bildungsreisen oder in Zusammenhang mit dem Fernhandel aus dem europäischen Ausland mitgebracht wurden, Einzug ins Deutsche. Bezüglich der Bildungsreisen spielten die Niederlande eine gewichtige Rolle.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Deutschland im 17. Jahrhundert nicht nur territorial zergliedert war, sondern auch auf sprachlicher Ebene keine Einheit bildete. In Anbetracht der genannten Bedingungen lässt sich das Streben der Fruchtbringenden Gesellschaft, die Suche nach einem einheitlichen Nationalitätenbewusstsein vermittels einer einheitlichen deutschen Hochsprache - fernab des damaligen Fremdwörterkultes – erklären und begründen.[21]
[…]
[1] Vgl. Engels, H.: Die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts. Gießen 1983, S. 93.
[2] von Polenz, P.: Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band II. 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1994, S. 8f.
[3] Vgl. van Ingen, F.: Philipp von Zesen. Stuttgart 1970, S. 5.
[4] Rat des Kreises Bitterfeld, Abt. Kultur, Kreismuseum Bitterfeld (Hrsg.): Bitterfelder Heimatblätter. Beiträge zur Heimatkunde der Stadt und des Kreises Bitterfeld. Heft X. Bitterfeld 1989, S. 3.
[5] Engels, S. 131.
[6] von Polenz, S. 4.
[7] von Polenz, S. 4f.
[8] Vgl. Engels, S. 8.
[9] von Polenz, S. 4.
[10] Ebenda.
[11] Ebenda.
[12] Vgl. von Polenz, S. 60.
[13] Ebenda, S. 64.
[14] Ebenda, S. 81.
[15] Ebenda.
[16] Engels, S. 158.
[17] Engels, S. 7.
[18] von Polenz, S. 85.
[19] Ebenda.
[20] Ebenda, S. 59.
[21] Vgl. Engels, S. 13.