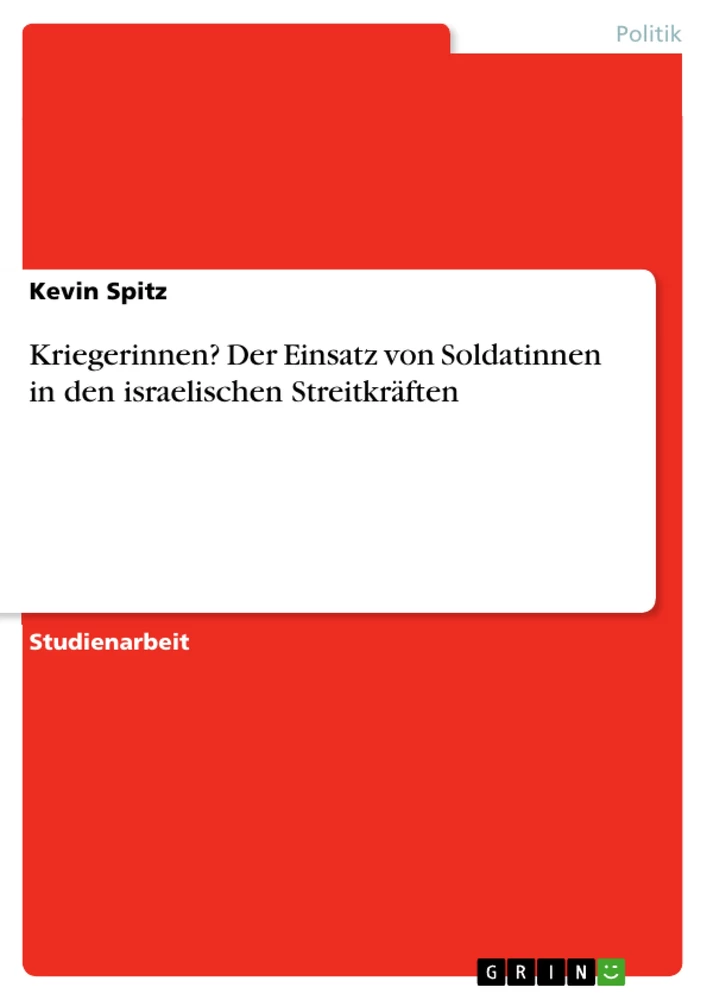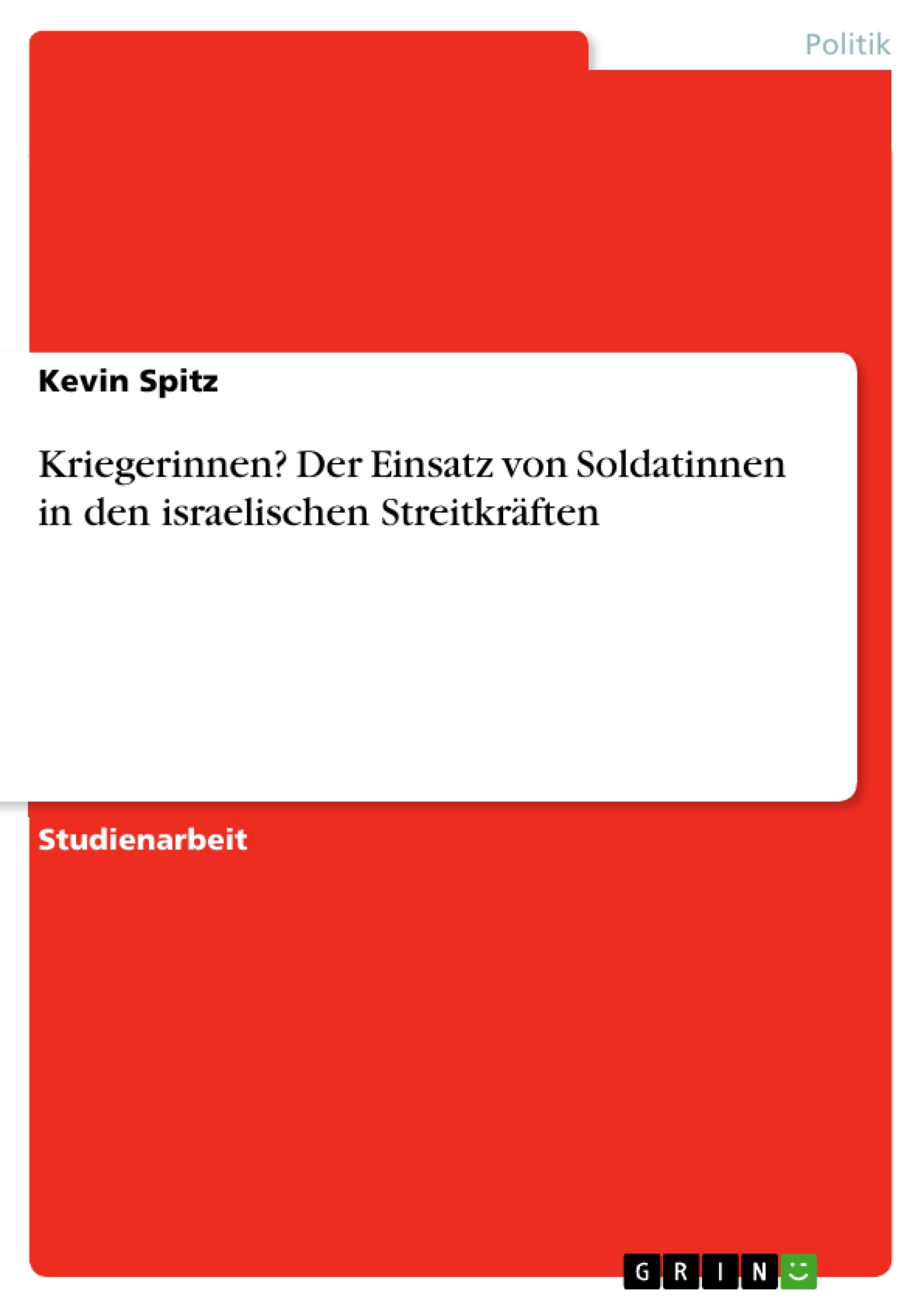Freitag, der 18. Mai 2012, Camp David: Beim Gipfeltreffen der G8 stehen an diesem Abend einige der brisantesten internationalen Themen auf dem Programm: der Aufbau einer Demokratie in Afghanistan, die friedliche Beilegung des Bürgerkriegs in Syrien, die diplomatische Beendigung des iranischen Atomwaffenprogrammes und eine mögliche Unterstützung des Arabischen Frühlings.
Im Umfeld dieser Nahost-Themen ist der israelisch-arabische Konflikt aus dem Fokus der Berichterstattung geraten, doch nur wenig spricht für ein Anhalten dieses peripheren Zustandes. Der Staat Israel stellt territoriale, kulturelle sowie rechtliche Grenzen und Demarkationslinien in einer Region, die tief geprägt ist von Kultur, Religion, Ideologie und Geschichte und hat deshalb seit seiner Gründung im Mai 1948 – also genau 64 Jahre vor dem G8-Gipfel in Camp David – mit der Eskalation von zahlreichen Krisen zu kämpfen, die zwar nur einen geografisch vergleichsweise kleinen Raum betreffen, aber umso größere globale Auswirkungen haben können und eine starke Präsenz in den Medien und der internationalen Politik garantieren. ...
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Entstehung der "people’s army"
3. Bedeutung des Militärs
4. Rolle der Frau
5. Resümee
6. Literatur