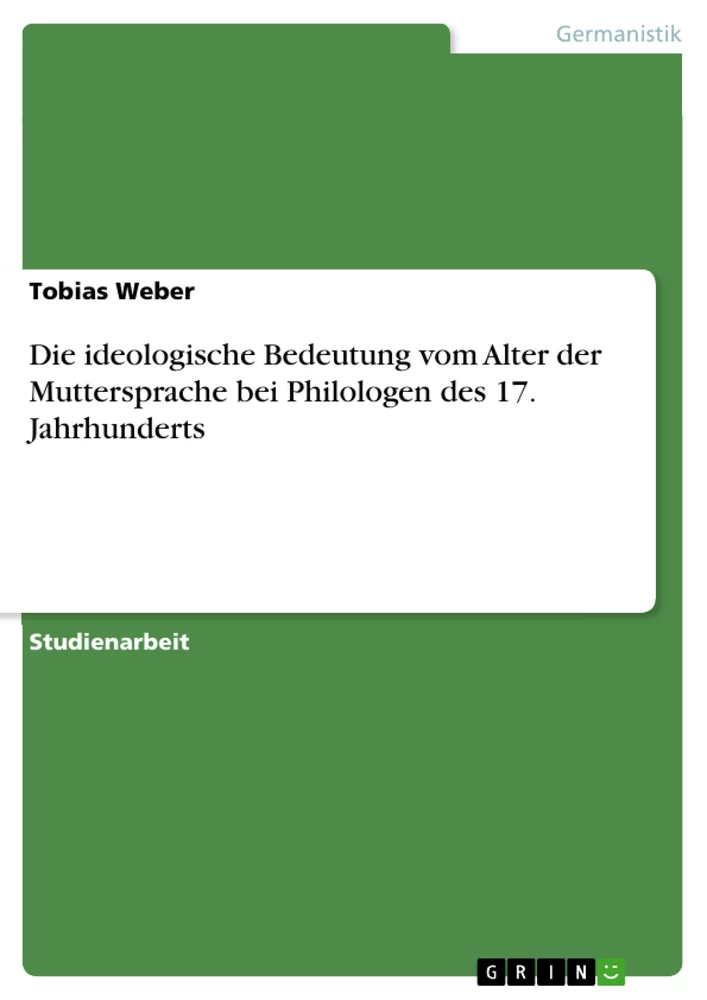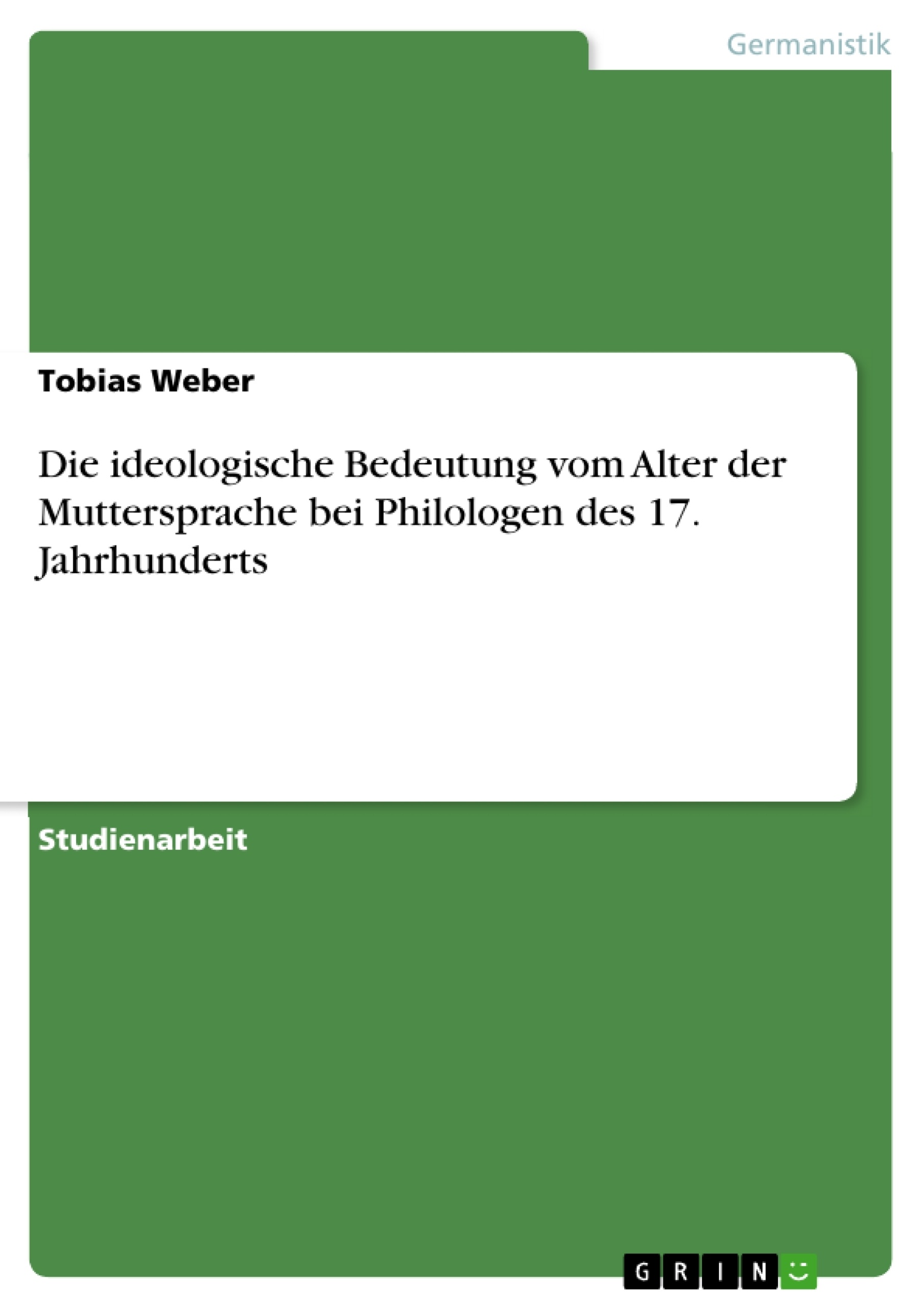In der vorliegenden Arbeit soll die ideologische Bedeutung des Sprachalters für die Argumentation der Sprachpfleger des 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum erörtert werden. Dazu wird zunächst auf die kulturpatriotische Strömung der damaligen Zeit eingegangen, um die Grundlagen für eine tiefer gehende Analyse zu schaffen. Wir betrachten also im Folgenden die Entstehung, Verbreitung und Etablierung des Sprach- oder Kulturpatriotismus in Europa, später im deutschsprachigen Raum, sowie deren bedeutendste Vertreter und ihre Ideen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird das zeitgenössische Sprachgeschichtskonzept des 17. Jahrhunderts dargelegt. Dazu wird insbesondere Schottelius' Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache diskutiert, welche "die umfassendste und fundierteste Einbeziehung sprachhistorischer Fragestellungen in ein grammatikographisches Werk vor Adelung bietet" (Rössing-Hager 1985, S. 1566). Dabei wird der Fokus der Betrachtung auf der Betonung und Begründung des hohen Alters der deutschen Sprache liegen. Abschließend werden die weiteren sprachphilosophischen und -wissenschaftlichen Auswirkungen der Sprachpfleger des 17. Jahrhunderts betrachtet. Die ideologisch belastete Grundhaltung der noch nicht wissenschaftlichen Arbeits- und Denkweise der frühen Philologen wird allseits deutlich.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 die Wurzeln des Sprach- oder Kulturpatriotismus
1.2 nationale Sprachpflege
1.3 Sprachpflege im 17. Jahrhundert
2. Sprachgeschichtsschreibung im 17. Jahrhundert
2.1 das zeitgenössische Sprachgeschichtskonzept
2.2 Alter, Verwandtschaft und Bedeutung der einzelnen Sprachen
2.3 die Besonderheit des Alters der Teutschen HaubtSprache
2.4 Sprachwandel
3. Ausblick
3.1 Kritik
3.2 weiterführende Sprachgeschichtsschreibung
3.3 Zusammenfassung
Literatur- und Quellenverzeichnis