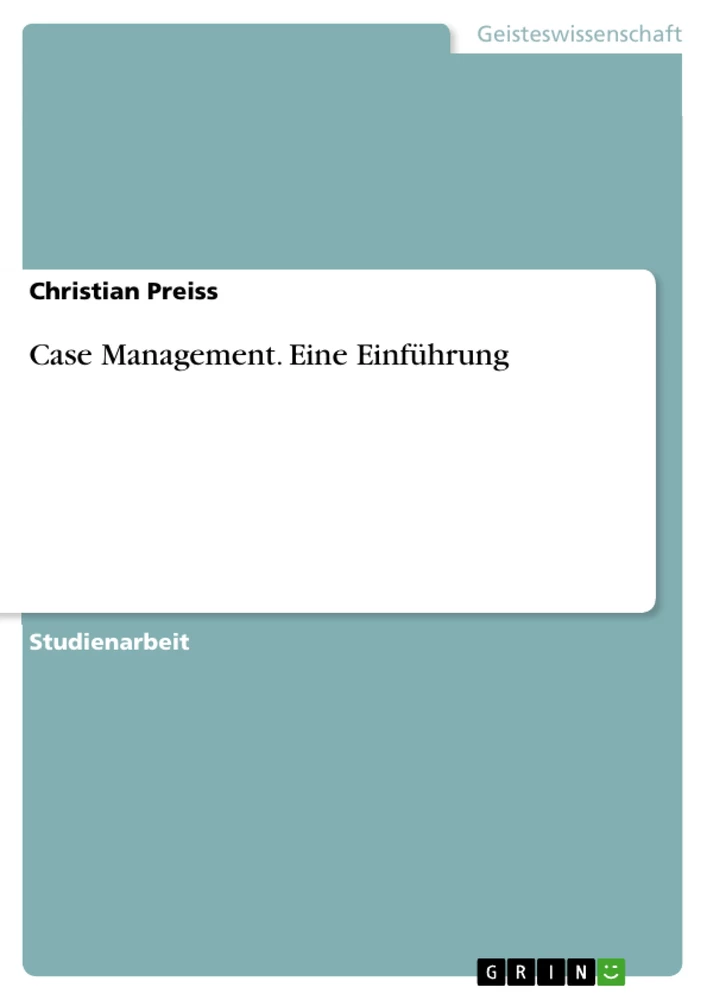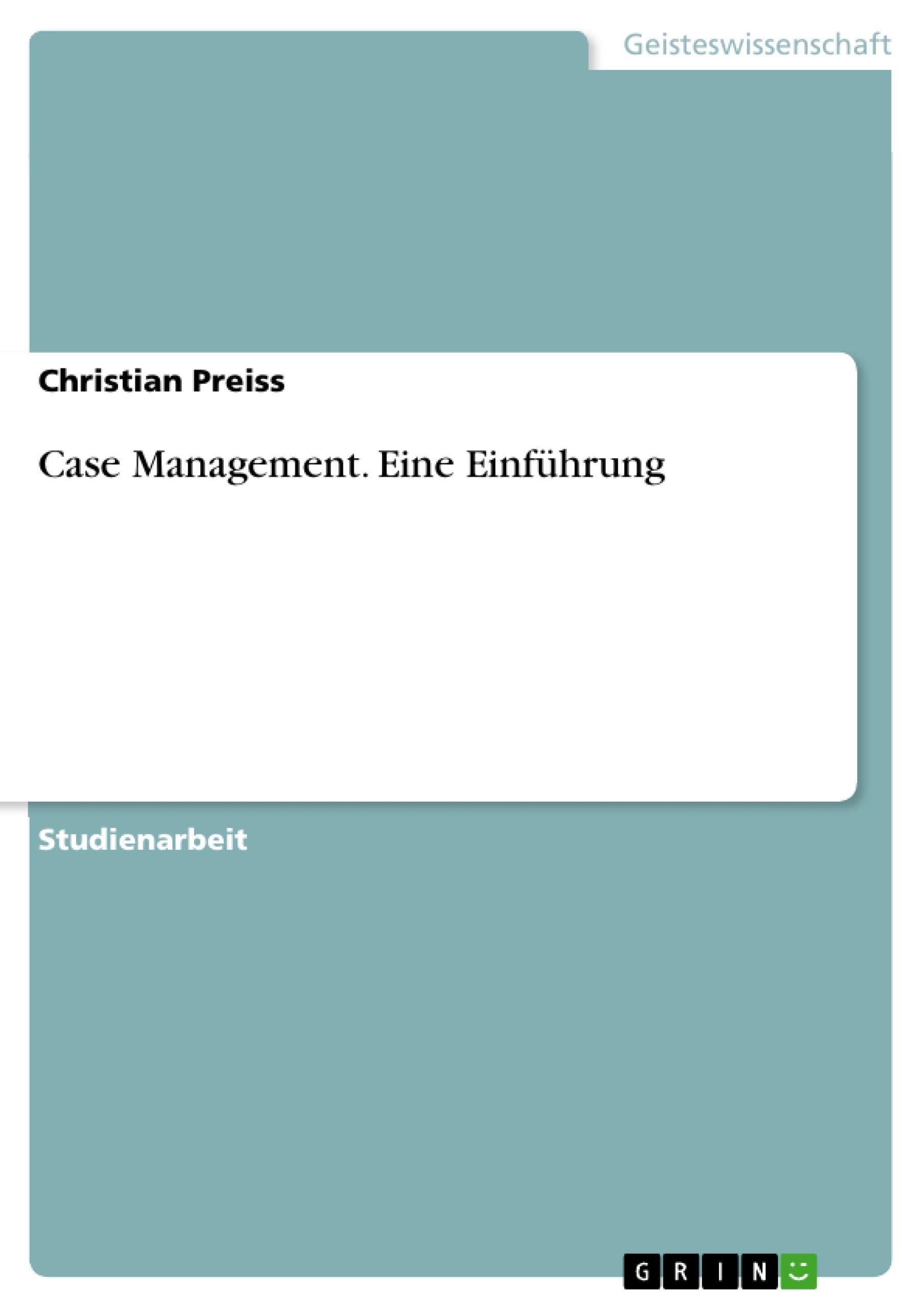Die immer knapper werdenden finanziellen Mittel der öffentlichen Haushaltskassen zwingen auch die Sozialarbeit zu einer Ökonomisierung mit betriebswirtschaftlichen Ansätzen. Die Forderung nach einer wirtschaftlichen Optimierung ist eine logische Konsequenz.
Demnach muss die Sozialarbeit sparsamer und dennoch effizienter und effektiver werden. So werden sozialarbeiterische Organisationen zu sozialen Dienstleistern umstrukturiert und Sozialarbeiter werden zu Managern der sozialen Angebote, verknüpfen die zur Verfügung stehenden Ressourcen und stimmen das Angebot der möglichen Hilfestellungen ab. Eine mittlerweile gängige Methode, die all diese Schritte in sich vereint, ist das so genannte Case Management. Dieses wird nicht nur in der Sozialen Arbeit und im Gesundheitswesen angewandt, sondern auch in der Pflege, der Rehabilitation, der Psychiatrie, bei medizinischen Behandlungen, in der Altenpflege, der Behindertenhilfe, der Familienhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch der Straffälligen- und Bewährungshilfe sowie der Suchtmittelabhängigen- und Wohnlosenhilfe.
Case Management kann als koordinierter und vernetzter Hilfeprozess betrachtet werden, der versucht durch Aktivierung der persönlichen, sozialen und materiellen Ressourcen die Abhängigkeit der Klienten von Hilfesystemen zu verringern. Es geht darum, die Selbstbestimmung der Klienten zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung.
1. Definition.
2. Geschichtlicher Hintergrund.
3. Funktionen des Case Manager.
3.1 Advocacy Funktion.
3.2 Broker Funktionen.
3.3 Gate Keeper Funktionen.
4. Gestaltungsaufgaben.
4.1 Angebots- und Nutzerorientierung.
4.2 Handeln nach Vereinbarungen.
4.3 Prozedurale Fairness.
4.4 Produktorientierung.
4.5 Qualitätsmanagement
4.5.1 Strukturqualität
4.5.2 Prozessqualität
4.5.3 Ergebnisqualität
5. Methode des Case Managements.
5.1 Falleinschätzung.
5.2 Hilfeplanung.
5.3 Durchführung.
5.4 Begleitung und Überprüfung der Hilfen.
5.5 Klientenfürsprache.
5.6 Beendigung und Auswertung.
6. Fazit und Kritik.
Literaturverzeichnis.