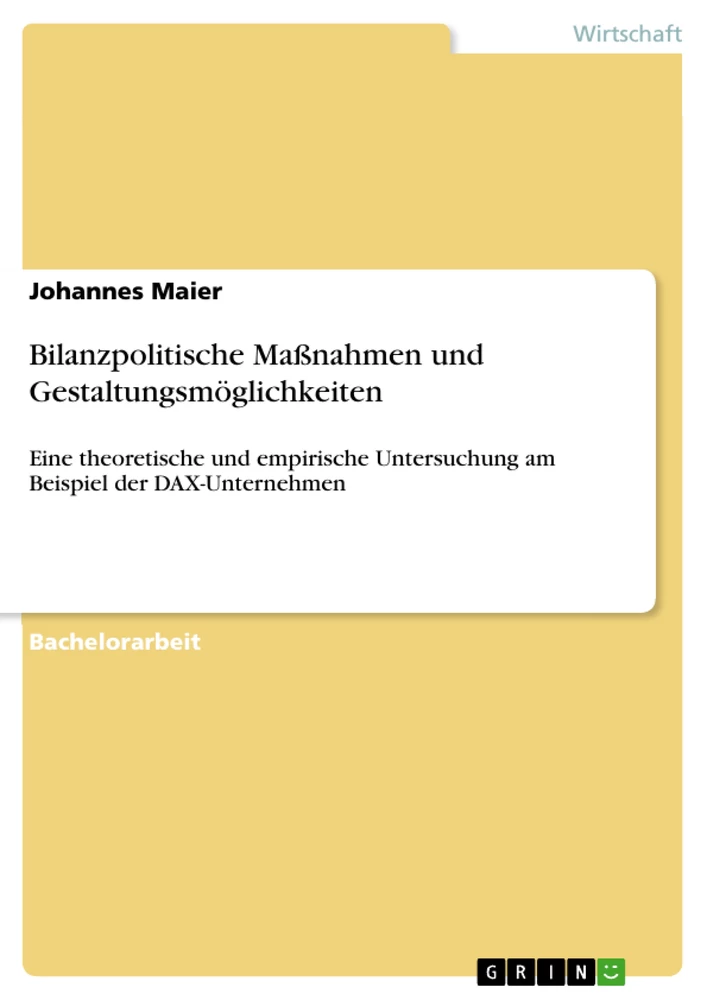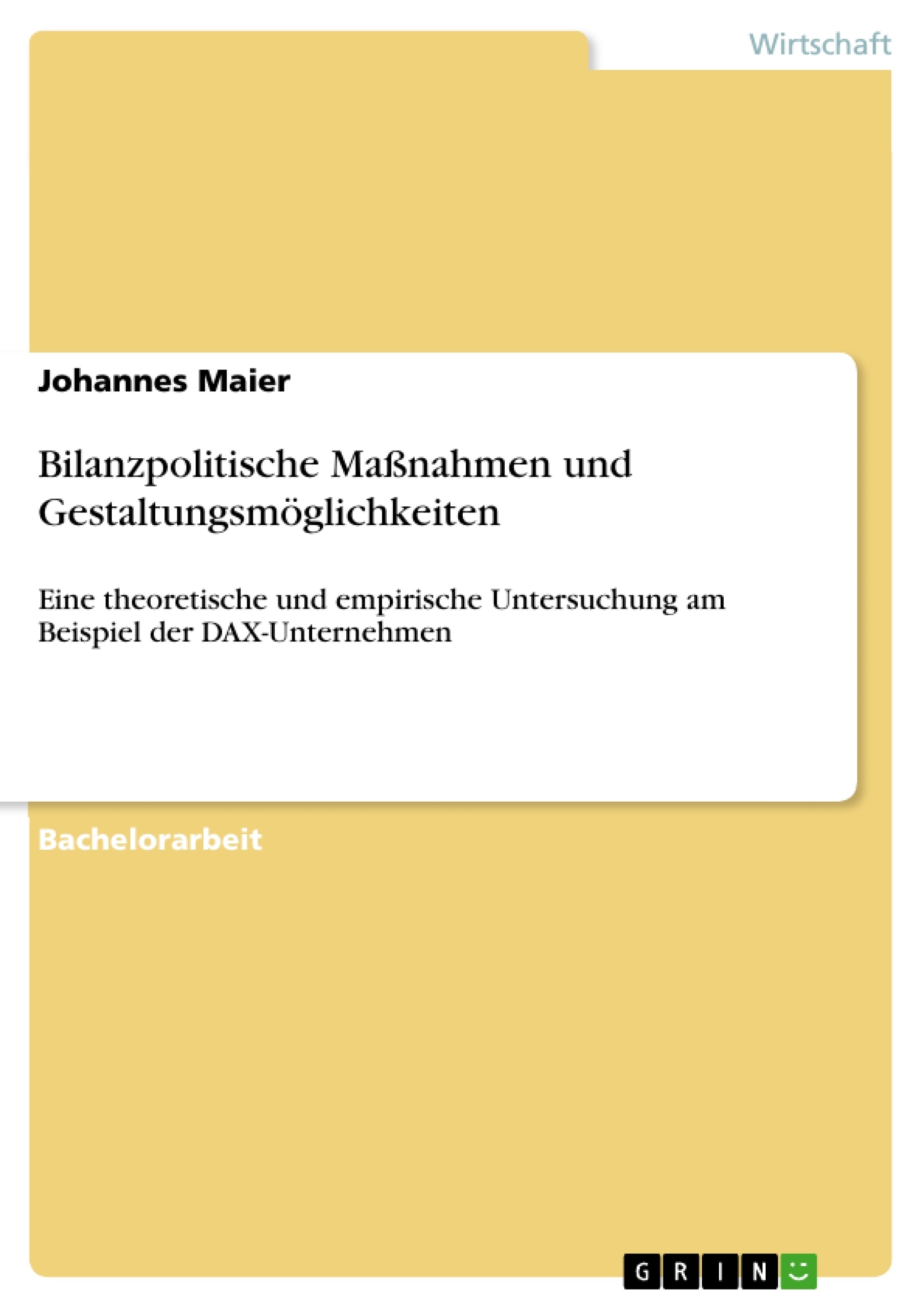1. Problemstellung
Die Bilanzpolitik (Jahresabschlusspolitik) lässt sich als ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik sehen. Es sind hier die unterschiedlichen Zielsetzungen, die das Management durch Beeinflussung der Unternehmensdaten im Rahmen der Unternehmenspolitik verfolgt, zu beachten, welche mit Hilfe bzw. durch die Unterstützung bilanzpolitischer Maßnahmen erreich werden sollen.
Die Bilanzpolitik nimmt nicht nur, wie sich aufgrund der Namensgebung vermuten lässt, auf die Bilanz Bezug. Im weiteren Sinne kann die zielgerichtete Gestaltung der Rechnungslegung durch das Management verstanden werden. Sie soll so zur Erreichung definierter Unternehmensziele beitragen und ein im Sinne des Jahresabschlusses tatsächliches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage abgeben. Durch diverse bilanzpolitische Maßnahmen wird dem bilanzierenden Unternehmen ermöglicht die Gestaltung des Jahresabschlusses unter rechtlich zulässigen Rahmenbedingungen nach seinen Vorstellungen darzustellen. Durch die Publikation des Jahresabschlusses sollen die Informationsempfänger zu Beiträgen bewegt werden die u. a. das Ziel verfolgen das Unternehmen als lukratives Anlageobjekt für Investoren darzustellen und sie z. B. zum Ankauf von Aktien zu bewegen.
Jedoch sind nicht alle bilanzpolitischen Maßnahmen unumstritten. Aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung (März 2013) geht hervor, dass Unternehmen oftmals versuchen die Bilanz zu schönen, indem sie sich reicher rechnen, um so ein positiveres Bild nach außen zu generieren. Derartige Maßnahmen können bei einer schlechten Wirtschaftslage, Krisen oder ähnlichen Zuständen, wie dies aktuell mit der noch anhaltenden Eurokrise der Fall ist, schnell negative Effekte erzeugen.
Für international agierende Unternehmen und Konzerne ist es jedoch oft von Notwendigkeit die gesetzlichen Wahlrechte und Spielräume bis zum Maximalen auszureizen und den Jahresabschluss nach außen zu schönen, um dem erhöhten und immer größer werdenden Konkurrenzdruck, der auf zunehmende Globalisierung und Internationalisierung zurückzuführen ist, stand zu halten. Dies kann nur unter der Bedingung einer zuverlässigen Risikoabschätzung stattfinden, was heißt, dass es auch Grenzen der Bilanzpolitik gibt, welche sowohl gesetzlich reglementiert sind, als auch solche, die sich aus ethnischen Gründen ergeben.
In den folgenden Abschnitten der Arbeit sollen die Grundlagen der Bilanzpolitik, Ziele und Motive sowie ihre Grenzen und bilanzpolitische Maßnahmen ...
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Problemstellung
2. Grundlagen der Bilanzpolitik
2.1. Definition
2.2. Motive und Ziele der Bilanzpolitik
2.2.1. Motive
2.2.2. Ziele
2.2.2.1. Monetäre Ziele
2.2.2.2. Nicht-Monetäre Ziele
2.2.3. Zielkonflikte
2.2.4. Strategien zur Lösung konkurrierender Ziele
2.3. Grenzen der Bilanzpolitik
3. Bilanzpolitische Maßnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten nach HGB und IAS/IFRS
3.1. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen
3.2. Sachverhaltsabbildende Maßnahmen
3.2.1. Formelle bilanzpolitische Maßnahmen
3.2.2. Materielle bilanzpolitische Maßnahmen
3.2.2.1. Ermessensspielräume
3.2.2.2. Ansatz- und Bewertungswahlrechte
3.3. Konzernbilanzpolitik
3.3.1. Aspekte
3.3.1.1. Jahresabschluss II-Erstellung
3.3.1.2. Kapital- und Schuldenkonsolidierung
3.3.1.3. Zwischenergebniseliminierung und Aufwands- und Ertragskonsolidierung
3.3.1.4. Steuerabgrenzung im Konzernabschluss
4. Analyse und Auswertung ausgewählter bilanzpolitischer Maßnahmen der DAX-Unternehmen
4.1. Immaterielle Vermögenswerte
4.1.1. Überblick
4.1.2. Analyse und Auswertung am Beispiel von VW, Daimler und BMW
4.2. Sachanlagen
4.2.1. Überblick
4.2.2. Analyse und Auswertung am Beispiel von Bayer und Merck
4.3. Rückstellungen
4.3.1. Überblick
4.3.2. Analyse und Auswertung am Beispiel von Beiersdorf
4.4. Leasing
4.4.1. Überblick
4.4.2. Analyse und Auswertung am Beispiel von Lufthansa
5. Thesenförmige Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis VII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Koalitionspartner von Unternehmen
Abbildung 2: Arten der Bilanzpolitik
Abbildung 3: Systematisierung bilanzpolitischer Ziele
Abbildung 4: Instrumente der Bilanzpolitik
Abbildung 5: Systematisierung der Wahlrechte
Abbildung 6: Immaterielle Vermögenswerte (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 7: Entwicklung bei Mehraktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 8: Ergebnisveränderung bei Mehraktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 9: Veränderung der Abschreibung bei Mehraktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 10: Veränderung der Kennzahlen bei Mehraktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 11: Nutzungsdauern Bayer
Abbildung 12: Nutzungsdauern Merck
Abbildung 13: Grunddaten der Beispielinvestition
Abbildung 14: Beispielinvestition: Bilanzen Bayer und Merck
Abbildung 15: Beispielinvestition: Kennzahlen Bayer und Merck
Abbildung 16: Entwicklung sonstige Rückstellungen (Ausgangssituation)
Abbildung 17: Entwicklung sonstige Rückstellungen (ohne Auflösung)
Abbildung 18: Auswirkungen des Leasings: Bilanz und GuV der Lufthansa
Abbildung 19: Auswirkungen des Leasings: Kennzahlen der Lufthansa
Abbildung 20: Maßnahmen formeller Bilanzpolitik nach HGB
Abbildung 21: Maßnahmen formeller Bilanzpolitik nach IAS/IFRS
Abbildung 22: Maßnahmen materieller Bilanzpolitik nach HGB Teil I
Abbildung 23: Maßnahmen materieller Bilanzpolitik nach HGB Teil II
Abbildung 24: Maßnahmen materieller Bilanzpolitik nach IAS/IFRS Teil I
Abbildung 25: Maßnahmen materieller Bilanzpolitik nach IAS/IFRS Teil II
Abbildung 26: Ermessensausübung des Bilanzierenden beim Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte
Abbildung 27: Grafische Wirkungsdarstellung der Aktivierung
Abbildung 28: Entwicklung bei Minderaktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 29: Ergebnisveränderung bei Minderaktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 30: Veränderung der Abschreibung bei Minderaktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 31: Veränderung der Kennzahlen bei Minderaktivierung (BMW, Daimler, VW)
Abbildung 32: Annual Report (2011) der Lufthansa
Abbildung 33: Bilanzpolitische Maßnahmen im Rahmen der Konzernabschlusserstellung nach HGB
Abbildung 34: Bilanzpolitische Maßnahmen im Rahmen der Konzernabschlusserstellung nach IAS/IFRS
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Problemstellung
Die Bilanzpolitik (Jahresabschlusspolitik) lässt sich als ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik sehen. Es sind hier die unterschiedlichen Zielsetzungen, die das Management durch Beeinflussung der Unternehmensdaten im Rahmen der Unternehmenspolitik verfolgt, zu beachten, welche mit Hilfe bzw. durch die Unterstützung bilanzpolitischer Maßnahmen erreich werden sollen.
Die Bilanzpolitik nimmt nicht nur, wie sich aufgrund der Namensgebung vermuten lässt, auf die Bilanz Bezug. Im weiteren Sinne kann die zielgerichtete Gestaltung der Rechnungslegung durch das Management verstanden werden.[1] Sie soll so zur Erreichung definierter Unternehmensziele beitragen und ein im Sinne des Jahresabschlusses tatsächliches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage abgeben. Durch diverse bilanzpolitische Maßnahmen wird dem bilanzierenden Unternehmen ermöglicht die Gestaltung des Jahresabschlusses unter rechtlich zulässigen Rahmenbedingungen nach seinen Vorstellungen darzustellen. Durch die Publikation des Jahresabschlusses sollen die Informationsempfänger zu Beiträgen bewegt werden die u. a. das Ziel verfolgen das Unternehmen als lukratives Anlageobjekt für Investoren darzustellen und sie z. B. zum Ankauf von Aktien zu bewegen.
Jedoch sind nicht alle bilanzpolitischen Maßnahmen unumstritten. Aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung (März 2013) geht hervor, dass Unternehmen oftmals versuchen die Bilanz zu schönen, indem sie sich reicher rechnen, um so ein positiveres Bild nach außen zu generieren.[2] Derartige Maßnahmen können bei einer schlechten Wirtschaftslage, Krisen oder ähnlichen Zuständen, wie dies aktuell mit der noch anhaltenden Eurokrise der Fall ist, schnell negative Effekte erzeugen.
Für international agierende Unternehmen und Konzerne ist es jedoch oft von Notwendigkeit die gesetzlichen Wahlrechte und Spielräume bis zum Maximalen auszureizen und den Jahresabschluss nach außen zu schönen, um dem erhöhten und immer größer werdenden Konkurrenzdruck, der auf zunehmende Globalisierung und Internationalisierung zurückzuführen ist, stand zu halten. Dies kann nur unter der Bedingung einer zuverlässigen Risikoabschätzung stattfinden, was heißt, dass es auch Grenzen der Bilanzpolitik gibt, welche sowohl gesetzlich reglementiert sind, als auch solche, die sich aus ethnischen Gründen ergeben.
In den folgenden Abschnitten der Arbeit sollen die Grundlagen der Bilanzpolitik, Ziele und Motive sowie ihre Grenzen und bilanzpolitische Maßnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten nach hier geltenden gesetzlichen Auslegungen im Sinne des HGB, als auch nach international geltenden Standards im Sinne der IAS/IFRS dargestellt und deren Wirkung aufgezeigt werden.
Anhand von zahlreich ausgewählten Beispielen angewandter bilanzpolitischer Maßnahmen der DAX-Unternehmen nach IAS/IFRS wird die theoretische Basis mit den in der Praxis angewandten und besonders oft vorkommenden Methoden untermauert und erläutert. Im letzten Teil der Arbeit erfolgt abschließend eine Zusammenfassung über die zuvor aufgeführten Punkte und Darlegungen des Themengebiets.
2. Grundlagen der Bilanzpolitik
2.1. Definition
Unter Bilanzpolitik versteht man die „[.] bewusste und zweckorientierte Einflussnahme auf [den] Jahresabschluss [.] in formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten [.]“[3] durch Führungskräfte und die Unternehmensleitung. Unter den zulässigen Möglichkeiten werden hier gesetzliche und faktische Wahlrechte und Ermessensspielräume verstanden.[4] Der Begriff Bilanzpolitik lässt zunächst vermuten, dass es sich hierbei nur um Maßnahmen handelt, welche die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) betreffen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Neben der Bilanz und GuV hat diese auch Auswirkungen auf Anhang, Lagebericht und Eigenkapitalspiegel und kann somit als Synonym für Jahresabschlusspolitik verwendet werden.[5] Da neben den genannten Bestandteilen auch andere, nicht normierte Medien Objekte zielgerichteter Beeinflussung sein können, wie z. B. Sozialbilanzen, Umweltberichte und Aktionärsbriefe sowie Zwischenabschlüsse, Sonder- und Konzernbilanzen, kann der Begriff der Bilanzpolitik auch durch Rechnungslegungspolitik ersetzt werden.[6]
Bilanzpolitik lässt sich also „[.] als Mittel zur Steuerung der mit einem Jahresabschluss in Zusammenhang stehenden (finanziellen) Konsequenzen und als Instrument der Informationspolitik zur Lenkung des Verhaltens aktueller und potenzieller Unternehmenskoalitionäre [.]“[7] definieren. Durch das bewusste Ergreifen diverser zulässiger Maßnahmen (Wahlrechte, Spielräume), welche Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben, sollen die Adressaten oder Rechtsfolgen beeinflusst werden.[8]
2.2. Motive und Ziele der Bilanzpolitik
Grundsätzlich lassen sich die Koalitionspartner (externe Adressaten) eines Unternehmens in drei verschiedene Gruppen einteilen, die in der folgenden Abbildung vereinfacht dargestellt sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Koalitionspartner von Unternehmen
Entsprechend ihrer Interessen haben die Bezugsgruppen der Koalitionspartner bestimmte Erwartungshaltungen hinsichtlich des finanziellen Erscheinungsbildes und des Images eines Unternehmens. Sie unterscheiden sich im Hinblick auf die divergierenden Ansprüche, Rechte und Sanktionsmöglichkeiten.[9] Oberstes Ziel sollte sein, die wirtschaftliche Lage im Zusammenspiel mit den Marktpartnern zu verbessern und zu stabilisieren. Um ein möglichst zielkongruentes Verhalten mit den Koalitionspartnern zu erreichen, sollte das Unternehmen deren Erwartungen gerecht werden. Die Motive und Ziele der Bilanzpolitik können sowohl aus den verschiedenen Erwartungshaltungen der Koalitionspartner, als auch von den übergeordneten Unternehmenszielen abgeleitet werden.
2.2.1. Motive
Die Motive für Bilanzpolitik und v. a. die sich daraus ergebenden Ziele sind vielfältig. Zunächst soll verstärkt auf die Motive eingegangen werden. Sie ergeben sich nicht nur wie bereits erwähnt durch die verschiedenen Interessen der genannten Gruppen, sondern auch durch die diversen Funktionen[10] des jeweils zu Grunde liegenden Abschlusses.
Dies geschieht einerseits durch gesetzliche, vertragliche oder faktische Vorgaben bzw. durch individuelle Intentionen des Abschlusserstellers. Es ergeben sich hieraus zwangsläufig Implikationen für die Gestaltung der Ergebnisermittlung z. B. im Hinblick auf die Höhe der Ausschüttung, des Ergebnisausweises sowie die Minimierung der Steuerzahlungen.[11] Verhalten und Meinungsbildung aktueller und potentieller Adressaten des Unternehmens sollen durch die entsprechende Gestaltung des Jahresabschlusses beeinflusst werden und so zu gewünschten Handlungsweisen führen. Ein weiteres Motiv kann auch das Vermeiden möglicher Panikreaktionen wichtiger Bilanzadressaten zu Zeiten einer Unternehmenskrise sein. Um nicht in jeglichem Sinne “Kredit“ zu verspielen, ist oft durch den innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens gezielten Einsatz bilanzpolitischer Maßnahmen eine Art Schönung und Verschleierung zu betreiben, welche von außen nicht so leicht ersichtlich ist. Auf diesen Aspekt und viele weitere Ziele der Bilanzpolitik wird im nachfolgenden Punkt eingegangen.
2.2.2. Ziele
Um die Ziele definieren zu können, muss zunächst die im Sinne der übergeordneten Unternehmensziele zu verfolgende Art der Bilanzpolitik festgelegt werden. Unterscheiden lassen sich hier eine progressive und konservative Bilanzpolitik. Progressive Bilanzpolitik zielt auf einen Ausweis möglichst hoher Ergebnisse und eines möglichst hohen Eigenkapitals ab. Die konservative Bilanzpolitik hingegen bezweckt einen Ausweis möglichst geringer Ergebnisse und eines möglichst geringen Eigenkapitals.[12] Mögliche Gründe für eine dieser Ausrichtungen lassen sich in nachstehender Abbildung finden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Arten der Bilanzpolitik
Quelle: Petersen/Zwirner/Künkele (2009), S. 15.
Die Ziele lassen sich nicht nur aus den übergeordneten Unternehmenszielen und der verfolgten Art von Bilanzpolitik ableiten, sondern werden auch durch die zuvor aufgeführten Motive des Bilanzierenden beeinflusst und definiert. Wie bereits aus den Motiven ersichtlich wurde, werden diese zudem stark von den verschiedenen Vorstellungen der Koalitionspartner beeinflusst. Die auseinandergehenden Ansichten der Anteilseigener einerseits und die Vorstellungen des Bilanzierenden andererseits sind jedoch durch die gesetzl. Vorschriften und Richtlinien eingeschränkt.[13] Es muss der Unternehmensleitung gelingen die Ziele so zu stecken, dass diese durch die im Rahmen der rechtlich zulässigen bilanzpolitischen Maßnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten erreicht werden können um so einen möglichst großen Teil der Anteilseigner und Interessensgruppen zufrieden zu stellen und deren Wünschen nachzukommen. Es ergeben sich dadurch zahlreiche zu vereinende Zielvorstellungen, die im weiteren Kontext aufgeführt und erläutert werden. Die Zielsetzungen lassen sich unterscheiden in monetäre und nicht-monetäre Ziele. Abbildung 3 zeigt einen Überblick auf die Einteilung und Unterordnung der bilanzpolitischen Ziele.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Systematisierung bilanzpolitischer Ziele
Quelle: In Anlehnung an Küting (2008), S. 754.
2.2.2.1. Monetäre Ziele
Unter monetären Zielen[14] werden weitestgehend finanzpolitische Ziele des Unternehmens verstanden. „Die Finanzpolitik zielt darauf ab, die Zahlungsfähigkeit in jeder betrieblichen Situation sicherzustellen“[15] und leistet so einen erheblichen Beitrag zur Existenzsicherung als oberstes Unternehmensziel. Grundsätzlich lassen sich die Zielsetzungen in ihrer Einflussnahme auf den Finanzbereich unterscheiden. So findet hier die Einteilung der Finanzziele in mittelbare und unmittelbare Beeinflussung statt.
Zu den Zielen der unmittelbaren Einflussnahme zählen v. a. solche, durch die eine direkte Beeinflussung des Bilanzierenden auf den Periodenerfolg stattfindet. In diesem Zusammenhang hat die Rechnungslegungspolitik die Funktion, den Abfluss erwirtschafteter Mittel aus der Unternehmung zu steuern als auch die Struktur der Bilanz aus Unternehmenssicht zielbringend und sinnvoll zu gestalten.[16] Hierunter fällt zunächst die Beeinflussung der Ansprüche derer, die ein Gewinnbeteiligungsrecht haben. Gemeint sind hier insbesondere der Staat, der in Form von Steuern beachtet werden muss, sowie die Aktionäre, die in Form von Ausschüttungen (Dividenden) bedacht werden wollen.[17] Insbesondere die Reduzierung der Steuerbemessungsgrundlage durch geschickten Einsatz bilanzpolitischer Maßnahmen, welche im folgenden Kapitel ausführlich erläutert werden, stellt eines der Hauptziele dar.[18] Ein weiteres Ziel, was nun unter die mittelbare Beeinflussung des Finanzbereichs zählt, ist die Sicherung des künftigen Mittelzuflusses (Kapitals). Im Grunde wird hier die Beschaffung von Fremd- oder Eigenkapital verstanden. Ziel ist es, je nach gewünschter Form der Finanzierung, das Verhalten der potenziellen Kapitalgeber zu Gunsten des Unternehmens zu beeinflussen.[19]
2.2.2.2. Nicht-Monetäre Ziele
Wie in Abbildung 3 ersichtlich, gehören zu den nicht-monetären Zielen[20] die publizitätspolitischen Ziele und die individualpolitischen Ziele des Managements. Die Publizitätspolitik zielt darauf ab grundsätzlich über den Stand der Entwicklung der Unternehmung im Bezug auf Wirtschaftlichkeit, sozialen und ökologischen Leistungen im Sinne der Imagepflege und über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu informieren. Dies geschieht mittels Jahresabschluss und Lagebericht.[21] Es können verschiedene Strategien der Publizitätspolitik verfolgt werden. Unterschieden wird zwischen zwei Grundausrichtungen – der aktiven und passiven Publizitätspolitik. Bei der passiven Abschlusspolitik werden lediglich die gesetzl. Mindestanforderungen bereitgestellt, d. h. das Unternehmen gibt keine Zusatzinformationen. Bei der aktiven Abschlusspolitik hingegen erhält der Abschlussadressat zusätzliche, über die gesetzlichen Mindestvorschriften hinausgehende, wertvolle Unternehmensinformationen.[22]
Unter den individualpolitischen Zielen des Managements wird das Bestreben der Geschäftsleitung verstanden, im Rahmen der Bilanzpolitik eigene Ziele wie bspw. Wohlstandsmaximierung in den Vordergrund zu rücken und zu verfolgen, was durch besondere Formen der Gewinnpolitik bzw. durch die Gestaltung von Anhang und Lagebericht erfolgen kann.[23] Dies tritt v. a. bei managementgeführten Unternehmen auf. Meist lassen sich jedoch die verschiedenen Zielsetzungen nicht gleichzeitig realisieren, sodass Zielkonflikte entstehen, die es gilt zu lösen.
2.2.3. Zielkonflikte
Wie aus den Kapiteln 2.2.2.1 und 2.2.2.2 zu ersehen ist, gibt es zahlreiche verschiedene Zielvorstellungen. Hinsichtlich des gemeinsamen Oberziels, gilt es, diese aufeinander abzustimmen. Innerhalb dieses Zielsystems ist jedoch das Auftreten von Konfliktsituationen möglich.[24] Diese können entstehen, „[.] wenn die Verwirklichung eines Ziels die Realisierung ein oder mehrerer [anderer] Ziele bzw. Zielbündel behindert oder ausschließt.“[25] Der Bilanzierende muss versuchen bei der Wahl der Zielsetzungen einzuschätzen, welche Auswirkungen diese auf das Verhalten der externen Adressaten hat.[26] Dies ist aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Unternehmenskoalitionäre an die zu verfolgenden Ziele des Unternehmens nicht immer ganz einfach. Konflikte treten nicht nur zwischen jenen Zielen auf die mittelbar sind. In erster Linie sind es die direkt am Jahresergebnis ansetzenden Ziele (Ausschüttungs- und Steuerbelastungsziele), deren Verwirklichung zu einem unerwünschtem Bilanzbild führen können und so die Meinungsbildung anderer externer Bilanzadressaten u. U. nachteilig beeinflussen.
Grundsätzlich wird bei verschiedenen Zielsetzungen zwischen konkurrierenden und gleichgerichteten Zielen unterschieden. Bei gleichgerichteten Zielen besteht kein Konfliktpotenzial, da bei Erreichung eines Ziels das andere ebenfalls realisiert werden kann. Schwieriger hingegen gestaltet sich die Sachlage bei konkurrierenden Zielen. Die Erreichung des einen Ziels führt dazu, dass andere Ziele nur mit großen Einschränkungen bzw. gar nicht erreicht werden können.[27] So lässt sich bspw. die Zielsetzung der Minimierung der Steuerzahlungen nicht mit dem Ziel der Gewinnmaximierung vereinbaren, da bei steigenden Gewinnen die Steuerbemessungsgrundlage in der Regel steigt und somit – c. p. – die Steuerlast des Unternehmens. Um die auftretenden Probleme der konkurrierenden Ziele zu beheben, gibt es verschiedene Strategien der Zielverfolgung, welche im nächsten Gliederungspunkt erläutert werden.
2.2.4. Strategien zur Lösung konkurrierender Ziele
Zur Lösung konkurrierender Ziele gibt es diverse Strategien die angewendet werden können. Diese werden im folgendem exemplarisch dargestellt.
- Präferenzbildung: Bei dieser Strategie nimmt das Unternehmen entsprechend der Dringlichkeit der Ziele eine Gewichtung vor. Das heißt, es werden die Zielsetzungen, die dem Unternehmen zunehmend als wichtig erscheinen bevorzugt und die sich aus der Nicht-Beachtung anderer, nicht relevanter bzw. vernachlässigbarer Ziele ergebenden Nachteile in Kauf genommen. Die Bilanzpolitik wird auf die Ziele mit der höchsten Priorität ausgerichtet.[28]
- Durchschnittsbildung: Der Bilanzierende versucht den unterschiedlichen Interessen der externen Adressaten jeweils zum Teil zu entsprechen. Diese Strategie wird gewählt, wenn einzelne Ziele oder Ansprüche, welche in Konflikt zueinander stehen, wichtig sind und nicht vernachlässigt werden können.[29]
- Gewinnglättung: Ziel dieser Strategie ist einen möglichst über den Zeitablauf konstanten Gewinn auszuweisen. So ist es möglich verschiedene Zielsetzungen jährlich gleichmäßig zu erfüllen, um so das Vertrauen der Stakeholder zu stärken und Solidität der Unternehmung zu vermitteln.[30]
- Objektivierungsthese: Das Unternehmen konzentriert sich auf diejenigen Ziele, deren Realisierung bei objektiver Betrachtung am realistischsten ist. Diese Strategie empfiehlt sich, wenn die verschiedenen Ziele als gleichgewichtig eingeschätzt werden können.[31]
- Doppelstrategie: Unerwünschte Folgen können durch zusätzliche Angaben im Anhang oder Lagebericht relativiert und die Meinungsbildung der Koalitionspartner im Hinblick auf andere Zielevorstellungen korrigiert werden.[32]
- Nichterkennbarkeit bilanzpolitischer Maßnahmen: Sind für den Bilanzleser die angewandten bilanzpolitischen Instrumente weitestgehend unsichtbar, so lassen sich dadurch Zielkonflikte vermeiden und unerwünschte Verhaltensweisen der Adressaten werden erst gar nicht ausgelöst. In die gleiche Richtung zielt eine restriktive Informationspolitik.[33]
- Konzernabschluss: Unternehmen, die zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet sind, „können den Einzelabschluss noch eindeutiger als früher unter Ausschüttungs- und Steuerminimierungsgesichtspunkten aufstellen und den Konzernabschluss als Korrektiv zur Darstellung der “richtigen“ Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwenden.“[34]
2.3. Grenzen der Bilanzpolitik
Die Definition der Bilanzpolitik macht bereits deutlich, dass sich die Maßnahmen nur im rechtlich zulässigen Rahmen bewegen dürfen. Der bilanzpolitische Aktionsraum ist also begrenzt durch die geltenden Gesetze und ökonomischen Vorgaben der Unternehmensleitung.
Die ökonomischen Grenzen resultieren hauptsächlich aus den unternehmenspolitischen Grundsatzentscheidungen, durch die das Bilanzbild bereits weitestgehend vorgezeichnet ist.[35] Hier wird verstanden, dass durch die verschiedenen Ziele, wie bereits in Punkt 2.2.3 genannt, Konflikte entstehen können, welche sich auf ein Ziel positiv, auf andere Zielsetzungen des Unternehmens jedoch auch negativ auswirken können. Die durch das Gesetz definierten Grenzen ergeben sich durch das zugrunde liegende Normensystem. Einerseits zwingend durch das in der Bundesrepublik Deutschland geltende HGB und anderseits verpflichtend für kapitalmarktorientierte Unternehmen durch die international geltenden Standards, die IFRS. Hier ist als erstes der im Gesetz verankerte Stetigkeitsgrundsatz zu nennen, welcher sowohl im HGB als Teil der GoB (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB), als auch bei den IFRS (IAS 8.13) fest verankert ist. Zudem sollte hier auch die Generalnorm nach § 264 Abs. 2 HGB und IAS 1.15 genannt werden, die u. a. auch zur Begrenzung der bilanzpolitischen Spielräume beitragen soll.[36] Auf die speziellen bilanzpolitischen Maßnahmen, welche u. a. Spielräume und Wahlrechte beinhalten, wird im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert eingegangen.
Die Bilanzpolitik wird im gesetzl. Sinne von den handelsrechtlichen GoB, Normen des Handels- und Steuerrechts, den Normen der IFRS und den Satzungen bzw. dem Gesellschaftsvertrag eingegrenzt. Die Ersteller des Jahresabschlusses müssen zudem im Anhang detaillierte Angaben – die nach IFRS strenger gesetzt sind als im Rahmen des HGB[37] – zu einzelnen Positionen der GuV und der Bilanz machen.[38] Noch zu erwähnen ist die Prüfungspflicht nach § 316 HGB. Diese stellt eine weitere Grenze dar, sollten Abweichungen zwischen dem Abschlussprüfer und den Verantwortlichen bestehen und es dem Management nicht gelingen diesen von der Gesetzmäßigkeit des gewählten Ansatzes bzw. der Bewertung zu überzeugen.[39] Die Grenzen der Bilanzpolitik sind dort erreicht, wo gegen Gesetz, Satzung oder GoB absichtlich oder unbeabsichtigt gehandelt wird. In diesem Fall würde man von Bilanzmanipulation oder Bilanzfälschung sprechen.
Eine weitere zu nennende Grenze stellt die Bilanzanalyse dar. Mit Hilfe dieser versuchen die externen Adressaten durch die Analyse und Auswertung des Jahresabschluss und Lagebericht einen tiefergründigen, informationsreicheren Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu erlangen.[40] Es ist möglich, dass aufgrund “entlarvter“ Maßnahmen die Auswirkungen erkannt werden und so die positive Wirkung im Sinne der Beeinflussung nicht erreicht werden kann. Aus Sicht des Unternehmens ist die Bilanzpolitik erfolgreich, wenn möglichst wenige der angewandten Maßnahmen durch Bilanzanalysten zu erkennen sind. Der Erfolg der Bilanzpolitik ist von einem angestrebten Verhaltensmuster der Bilanzadressaten abhängig. Letztlich bestimmen die vom Bilanzierenden eingesetzten und vom Analysten in seine Berechnung einbezogenen und eingesetzten Instrumente gleichzeitig den Einsatz und die Dosierung des bilanzpolitischen Rahmens.[41]
3. Bilanzpolitische Maßnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten nach HGB und IAS/IFRS
Die Bilanzpolitik beschäftigt sich nicht nur mit der Festlegung von aus den allgemeinen Unternehmenszielen abgeleiteten Zielsetzungen. Vielmehr sind die geeigneten Mittel, die zur Zielerreichung notwendig sind, auszuwählen und die geltenden Restriktionen zu beachten. Die zur Verfügung stehenden Instrumente unterscheiden sich in sachverhaltsgestaltende und sachverhaltsabbildende Maßnahmen (Abbildung 4). Unter ersterem werden Maßnahmen vor dem Bilanzstichtag verstanden. Unter Sachverhaltsabbildung sind Maßnahmen nach dem Bilanzstichtag zu verstehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Instrumente der Bilanzpolitik
Quelle: Küting (2008), S. 759.
3.1. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen
Unter Sachverhaltsgestaltung werden zumeist geschäftspolitische Maßnahmen verstanden – oftmals kurzfristig – die vor Ablauf des Geschäftsjahres durchgeführt werden um die wirtschaftliche und bilanzrechtliche Realität vor dem Bilanzstichtag zu beeinflussen. Sie zielen vorrangig auf die Gestaltung der Bilanz ab. Es steht häufig der Wunsch im Vordergrund das zugrunde liegende Mengengerüst der Bewertung und Bilanzierung maßgebend zu beeinflussen um so bestimmte Voraussetzungen für die Anwendung anderer bilanzpolitischer Instrumente zu schaffen, die im Rahmen der Abschlusserstellung eingesetzt werden sollen.[42]
Für den Bilanzleser sind die Maßnahmen aus dem Jahresabschluss in der Regel nicht zu erkennen. Zudem unterliegen sie nicht dem Stetigkeitsgrundsatz. Grundsätzlich lassen sich drei typische Formen unterscheiden:
(1) Zeitliche Vor- oder Nachverlagerung von Geschäftsvorfällen;
Beispiel: Die Anschaffung bzw. Reparatur von Anlagegütern wird zur Entlastung des Ergebnisses in nachfolgende Geschäftsjahre verlagert. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet werden müssen.
(2) Einleitung von Maßnahmen, die nach dem Bilanzstichtag wieder rückgängig gemacht werden können; und
Beispiel: Rückzahlung eines Bankkredites kurz vor dem Bilanzstichtag und Neuaufnahme im folgenden Geschäftsjahr.
(3) Durchführung bilanzpolitisch motivierter Handlungen, die nach dem Bilanzstichtag nicht mehr umkehrbar sind.
Beispiel: Veräußerung von Vermögensgegenständen gegen Entgelt und unter Auflösung von stillen Reserven an einen Leasinggeber, um sie von diesem anschließend zurück zu leasen. Der Leasingvertrag wird so gestaltet, dass die Aktivierung des Vermögensgegenstandes beim Leasinggeber als wirtschaftlichem Eigentümer erfolgt. (sale-and-leaseback)[43]
Die Analyse des Verhältnisses von Jahresergebnis und Cashflow stellt ein geeignetes Instrument zur Erkennbarkeit dar. Ein über den Zeitraum höher ausfallendes Jahresergebnis im Vergleich zum Cashflow oder „ein fortwährend positives Jahresergebnis, welchem ein stetig negativer operativer Cashflow gegenübersteht“[44], sind Indizien für die Vornahme von Sachverhaltsgestaltungen.[45] Die Sachverhaltsgestaltung hat sowohl nach HGB als auch nach IAS/IFRS einen hohen Stellenwert innerhalb der Bilanzpolitik eines Abschlusses.
3.2. Sachverhaltsabbildende Maßnahmen
Sachverhaltsabbildende Maßnahmen knüpfen an die realen Vorgänge und Tatsachen an, die sich aus den geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens ergeben. Einfacher ausgedrückt betrifft es die Abbildung von bereits erfolgten Geschäftsvorfällen während des Berichtszeitraums. Oft ist auch von Maßnahmen nach dem Bilanzstichtag die Rede.[46] Die Sachverhaltsabbildung lässt sich in zwei Kategorien unterteilen, in formelle und materielle Bilanzpolitik. Die formelle Bilanzpolitik nimmt primär Einfluss auf den Ausweis der Vermögens- und Kapitalstruktur. Die materielle Bilanzpolitik hingegen nimmt Einfluss auf das Periodenergebnis (Höhe d. Ergebnisausweis).[47]
Die verschieden einsetzbaren Instrumente lassen sich entsprechend ihrer logischen Abfolge zu den zutreffenden Bilanzierungsentscheidungen unterteilen. Zunächst stellt sich die Frage, ob ein Objekt oder Vorgang dem Grunde nach in die Bilanz aufzunehmen ist (Bilanzansatzentscheidung) und in welcher Höhe (Bewertungsentscheidung). Steht fest, wo der Posten in welcher Höhe auszuweisen ist, muss geprüft werden, ob zu einzelnen Sachverhalten und Vorgängen Angaben im Anhang oder Lagebericht zu erläutern sind. Die im Rahmen der Bilanzierung zu treffenden Entscheidungen werden durch die existierenden Rechnungslegungsvorschriften nicht in allen Fällen verbindlich geregelt. Die gesetzlichen bzw. normativen Vorschriften beinhalten vielmehr Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungswahlrechte zur formellen und materiellen Gestaltung des Jahresabschlusses.[48]
3.2.1. Formelle bilanzpolitische Maßnahmen
Die formelle Bilanzpolitik nimmt Einfluss auf die äußere Gestaltung des Jahresabschlusses. Im Grunde befasst sie sich mit der Form und Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht. Zu unterscheiden ist zwischen Ausweis-, Gliederungs- und Erläuterungswahlrechten.[49]
Unter den Ausweiswahlrechten sind verschiedene Möglichkeiten zur Zusammenfassung und/oder weitergehenden Untergliederung bestimmter Positionen in Bilanz und GuV, aber auch in der Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung zu verstehen. Die strukturbezogenen Instrumente gestalten die Struktur der Bilanz und GuV, die u. U. Auswirkungen auf die Bilanzsumme haben, jedoch nicht das Ergebnis beeinflussen. Im Rahmen der erläuterungsbezogenen Instrumente sind Detaillierungsgrad und Darstellungsweise der Informationen als Potenzial im Rahmen der Dokumentation der Sachverhalte im Anhang zu nennen. Mögliche anwendbare Instrumente der formellen Bilanzpolitik nach HGB und IAS/IFRS können Abbildung 20 und Abbildung 21 im Anhang entnommen werden.
Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass der Einsatz formeller bilanzpolitischer Maßnahmen denen der materiellen Maßnahmen in seiner Wirkung meist deutlich nachstehen.[50]
3.2.2. Materielle bilanzpolitische Maßnahmen
Die materielle Bilanzpolitik nimmt im Gegensatz zur formellen Einfluss auf die Höhe der Abschlussdaten und ist auf die zielgerichtete Steuerung des Ergebnisses ausgerichtet. Sie nimmt auf die Höhe der Vermögens- bzw. Schuldendarstellung und zumeist auch auf die Bilanzsumme Einfluss. Hinsichtlich der materiellen Maßnahmen muss unterschieden werden zwischen Ansatz- und Bewertungswahlrechten einerseits und Ermessenspielräumen anderseits. Zudem kann eine Unterscheidung zwischen faktischen und gesetzlichen (expliziten) Wahlrechten erfolgen (Abbildung 5). Bei einem Vergleich zwischen HGB und IAS/IFRS lässt sich feststellen, dass lt. IAS/IFRS nur wenige offene Wahlrechte, allerdings ein Mehr an Ermessensspielräumen vorhanden sind. Eine Übersicht an Maßnahmen nach HGB und IAS/IFRS kann dem Anhang entnommen werden (Abbildung 22 bis Abbildung 25).[51]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Systematisierung der Wahlrechte
Quelle: Petersen/Zwirner/Künkele (2009), S. 5.
3.2.2.1. Ermessensspielräume
Ermessensspielräume eröffnen dem Bilanzierenden die Entscheidungsmöglichkeit innerhalb der gesetzl. zulässigen Bandbreite einen Wertansatz zu wählen. Sie entstehen, wenn Bilanzierungsnormen generell Ansatz und Bewertung eines Abschlusspostens regeln, diese jedoch keine konkreten Vorgaben oder Methoden zu seiner Bestimmung enthalten. Es ist das subjektive Ermessen des Bilanzierenden maßgebend. Zu den Ermessensspielräumen werden in der Literatur zudem oft Verfahrensspielräume mit einbezogen. Diese entstehen bspw. bei Bilanzierungsproblemen in der Praxis, bei denen Auslegungsalternativen aufgrund unbestimmter Rechtsbegriffe bestehen. Es ist schwierig einen Unterschied zwischen Verfahrensspielräumen und faktischen (verdeckten) Wahlrechten auszumachen.[52] Da die Grenzen objektiv nicht eindeutig festzulegen sind, werden dem Bilanzierenden teilweise erhebliche Bandbreiten akzeptabler Wertansätze ermöglicht.[53]
Nach den IAS/IFRS können die Ermessenspielräume weiter unterschieden werden. So ist hier auch oftmals von sogenannten offenen Regelungen die Rede. Für diese ist zwar eine Regelung existent, diese sind jedoch für eine bilanzpolitische Gestaltung offen. Folgende Fälle sind möglich:
(1) Für bestimmte Sachverhalte werden keine Regelungen an die Hand gegeben;
(2) Es werden Regelungen für Sachverhalte in den Standards vorgegeben, wegen einer notwendigen Allgemeingültigkeit sind diese jedoch so unscharf formuliert, dass letztlich Spielräume verbleiben; und
(3) Es verbleibt im Rahmen von Regelungen dem Bilanzierenden ein eigenes Ermessen, welches auch bilanzpolitisch beeinflusst sein kann.[54]
Die im Rahmen der Ermessenspielräume getroffenen Wertansätze nach HGB und IAS/IFRS müssen plausibel begründet werden können und vom Wirtschaftsprüfer akzeptiert werden. Ein typisches Beispiel für derartige Spielräume stellt z. B. die Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögenswerten dar. Hier lässt sich auch ein Verfahrensspielraum (faktisches Wahlrecht) zuordnen. So ist es dem Bilanzierenden möglich, die Abschreibungsmethode entsprechend der am besten wiederspiegelnden Alternative für den Nutzenverlauf eines Vermögenswertes zu wählen.[55]
3.2.2.2. Ansatz- und Bewertungswahlrechte
Wahlrechte bestehen, wenn dem Bilanzierenden für einen gegeben Tatbestand mindestens zwei eindeutig, sich gegenseitig ausschließende Alternativen zur Verfügung stehen, die unterschiedliche Rechtsfolgen hervorrufen. Der Rechnungslegende entscheidet welche Folgen eintreten sollen. Sie betreffen sowohl Ansatz- als auch Bewertungsfragen und werden in explizite und faktische Wahlrechte unterschieden.[56] So beschäftigen sich Bilanzansatzwahlrechte (Bilanzierung dem Grunde nach) damit, ob Sachverhalte in die Bilanz aufgenommen werden sollen. Bewertungswahlrechte (Bilanzierung der Höhe nach) beschäftigen sich damit, in welcher Höhe bzw. mit welchem Wertansatz ein Sachverhalt in der Bilanz aufgenommen wird.[57]
Explizite Wahlrechte – auch gesetzl. Wahlrechte genannt – sind eindeutig durch den Gesetzgeber bzw. Standardsetter kodifiziert, d. h. sie werden ausdrücklich im Gesetz oder in einem Standard genannt. Faktische Wahlrechte unterscheiden sich von den expliziten Wahlrechten dahingehend, dass sie nicht aufgrund ausdrücklicher Nennung im Gesetz bzw. dem zugrunde liegenden Normensystem zur Verfügung stehen. Es handelt sich eher um Gebote und Verbote, die an bestimmte vorliegende Sachverhalte oder Voraussetzungen geknüpft sind. Der Rechnungslegende hat bei deren Interpretation verschiedene Auslegungsalternativen für unbestimmte Rechtsbegriffe oder großzügige Bilanzierungsnormen.[58]
Die IAS/IFRS haben zahlreiche Wahlrechte, die durch den IASB unterschiedlich gewichtet werden. Im Vergleich zu den HGB-Vorschriften sind hier vorwiegend faktische und wenige explizite Wahlrechte festzustellen. „So werden in bestimmten Fällen unterschiedliche, in manchen Fällen sogar gegensätzliche Methoden zugelassen und [.] im jeweiligen Standard diskutiert und mit Anwendungshinweisen oder -einschränkungen versehen.“[59]
3.3. Konzernbilanzpolitik
Unter Konzernbilanzpolitik versteht man die zielorientierte Gestaltung des Konzernabschlusses mit seinen Bestandteilen Bilanz, GuV und Anhang sowie des Lageberichts. Der Konzernabschluss besitzt im Gegensatz zum Einzelabschluss reine Informationsfunktion. Die Ziele beschränken sich also im Wesentlichen darauf, Art und Umfang der zu publizierenden Informationen zu beeinflussen und so nur den vom Unternehmen gewünschten Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu ermöglichen.
3.3.1. Aspekte
3.3.1.1. Jahresabschluss II-Erstellung
Ein mögliches bilanzpolitisches Instrumentarium ergibt sich bereits bei der Vereinheitlichung der Einzelabschlüsse der einzubeziehenden Unternehmen. § 299 HGB besagt, dass die Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen (TU) auf den Abschlussstichtag des Mutterunternehmens aufzustellen sind, da an jenem auch die Aufstellung des Konzernabschlusses zu erfolgen hat. Beträgt die Abweichung weniger als drei Monate, so steht es dem Bilanzierenden frei, für das TU einen Zwischenabschluss aufzustellen oder davon abzusehen. Man könnte hier auch von einem faktischen Wahlrecht bzgl. der Vereinheitlichung der Abschlussstichtage sprechen. Es wird dem Bilanzierenden ermöglicht, den Vermögens- sowie den Erfolgs- und Eigenkapitalausweis in der Konzernbilanz und GuV u. U. erheblich zu beeinflussen. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die zwischen den Stichtagen stattfinden, sind jedoch nach § 299 Abs. 3 HGB in der Konzernbilanz und GuV zu berücksichtigen oder wahlweise im Konzernanhang anzugeben.[60]
Des Weiteren von Bedeutung ist im Zwecke der Konzernrechnungslegung die Neuausübung der Ansatz- und Bewertungswahlrechte innerhalb des Normenrahmens des MU. Dem Bilanzierenden wird ermöglicht, das ansatz- und bewertungsbezogene bilanzpol. Instrumentarium erneut unabhängig von der Inanspruchnahme in den originären Einzelabschlüssen einzusetzen. Das Gestaltungspotenzial kann dazu genutzt werden die wirtschaftliche Lage des UN und des Konzerns aus betriebswirtschaftlicher Sicht besser darzustellen. Jedoch kann diese sog. zweigleisige Strategie auch die tatsächliche Wirtschaftslage verschleiern. Transparenz wird hier z. T. durch gesetzl. geforderte Anhangangaben geschaffen.[61] Die genannten Aspekte finden grundsätzlich auch bei den IAS/IFRS mit zu beachtenden Einschränkungen Anwendung. Die Nichterstellung eines Zwischenabschlusses ist nach IFRS nicht generell, sondern nur ausnahmsweise wegen mangelnder Praktikabilität zulässig. Vorgänge während des Abweichungszeitraums sind zwingend in der Konzernbilanz und -GuV zu erfassen (IAS 27.22 f.).[62]
3.3.1.2. Kapital- und Schuldenkonsolidierung
Die Kapitalkonsolidierung bietet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. So gibt es zahlreiche durch den Gesetzgeber eingeräumte Methodenwahlrechte für das Konsolidierungsverfahren (s. Anhang Abbildung 33 und 34) an sich sowie für bestimmte Folgewirkungen (z. B. Behandlung des GoF). Mithilfe der Gestaltungsspielräume kann v. a. Einfluss auf die Höhe und Struktur des Vermögens, des ausgewiesenen Eigenkapitals sowie die konsolidierungsbedingten Wirkungen des Konzernjahreserfolgs genommen werden.[63]
Grundsätzlich stehen zwei zentrale Ansatzpunkte im Rahmen des bilanzpolitischen Instrumentariums zur Verfügung. Dies ist (1) das Verfahren der Kapitalkonsolidierung und (2) der Unterschiedsbetrag aus der Kapitalaufrechnung. So lässt sich bspw. durch die Wahl des (1) Konsolidierungsverfahrens das Eigenkapital, die Eigenkapitalquote als auch die Bilanzsumme[64] beeinflussen (s. Anhang Abbildung 33 und 34). Der Unterschiedsbetrag aus der Kapitalaufrechnung (2) ist für das Bild des Konzernabschlusses von mehrfacher Bedeutung. So ist deren Höhe entscheidend für die Höhe der Aufdeckung an stillen Reserven und Lasten ggf. zusätzlich an der Höhe eines positiven oder negativen GoF. Mithilfe von Zuordnung und Fortführung des Unterschiedsbetrags kann auf die Struktur des auszuweisenden Vermögens eingewirkt werden.[65]
Die Kapitalkonsolidierung nach IAS/IFRS ist aufgrund fehlender Konsolidierungswahlrechte eingeschränkt. So ist nach IFRS 3 nur die Erwerbsmethode mit voller Neubewertung der zu übernehmenden Vermögenswerte und Schulden möglich. Zudem ist keine Beeinflussung der Höhe und Auflösung des Unterschiedsbetrages aus der Kapitalkonsolidierung möglich. Weitere Einschränkungen ergeben sich bei der Neuausübung von Bilanzierungswahlrechten auf Ebene der TU den Unterschiedsbetrag zu beeinflussen. Die bilanzpol. Maßnahmen erstrecken sich in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen. Diese bieten sich hauptsächlich bei der Neubewertung des erworbenen Nettovermögens und beim jährlichen Werthaltigkeitstest für den Goodwill.[66]
[...]
[1] Vgl. Coenenberg/Haller/Schultze (2009), S. 997.
[2] Vgl. Heismann (2013), S. 29.
[3] Petersen/Zwirner/Künkele (2010), S. 2.
[4] Vgl. Bitz/Schneeloch/Wittstock (2011), S. 677 f.
[5] Vgl. ebenda, S. 678.
[6] Vgl. Freidank/Velte (2007), S.11.
[7] Petersen/Zwirner/Künkele (2010), S. 2.
[8] Vgl. Wagenhofer/Ewert (2007), S. 237.
[9] Vgl. Küting/Weber (2009), S. 35.
[10] Funktionen des Jahresabschlusses sind u. a. Dokumentations-, Informations- und Ausschüttungsbemessungsfunktion als auch über das Maßgeblichkeitsprinzip gem. § 5 EStG Steuerbemessungsfunktion.
[11] Vgl. Coenenberg/Haller/Schultze (2009), S. 997.
[12] Vgl. Petersen/Zwirner/Künkele (2010), S. 14.
[13] Vgl. Küting/Weber (2009), S. 35.
[14] Monetäre Ziele werden auch als qualitative Ziele bezeichnet (Vgl. Petersen/Zwirner/Künkele (2010), S. 3.)
[15] Vgl. Küting/Weber (2009), S. 35.
[16] Vgl. Freidank/Velte (2007), S. 660.
[17] Vgl. ebenda, S. 660.
[18] Vgl. Wöhe/Döring (2008), S. 886.
[19] Vgl. Bitz/Schneeloch/Wittstock (2011), S. 684.
[20] Die nicht-monetären Ziele werden auch als quantitative Ziele bezeichnet (Vgl. Petersen/Zwirner/Künkele (2010), S. 3.)
[21] Vgl. Freidank/Velte (2007), S. 663.
[22] Vgl. ebenda, S. 663 f.
[23] Vgl. ebenda, S. 664 f.
[24] Vgl. Freidank/Velte (2007), S. 666.
[25] Freidank/Velte (2007), S. 666.
[26] Vgl. Küting (2008), S.756
[27] Vgl. Freidank/Velte (2007), S. 666.
[28] Vgl. Küting (2008), S. 757, Rn. 2122.
[29] Vgl. ebenda, S. 757, Rn. 2123.
[30] Vgl. ebenda, S. 757, Rn. 2124.
[31] Vgl. ebenda, S. 757, Rn. 2125.
[32] Vgl. ebenda, S. 757, Rn. 2126.
[33] Vgl. Küting (2008), S. 757, Rn. 2127.
[34] Vgl. ebenda, S. 756, Rn. 2128.
[35] Vgl. Wirtschaftslexikon (2012).
[36] Vgl. Coenenberg/Haller/Schultze (2009), S. 1007 f.
[37] Vgl. Coenenberg/Haller/Schultze (2009), S. 1008.
[38] Vgl. Freidank/Velte (2007), S. 677.
[39] Vgl. ebenda S. 677.
[40] Vgl. Küting/Weber (2009), S. 1.
[41] Vgl. ebenda S. 47.
[42] Vgl. Küting (2008), S. 758, Rn. 2130.
[43] Vgl. Küting (2008), S. 759 f., Rn. 2132-2135.
[44] Wohlgemuth (2007), S. 66.
[45] Vgl. ebenda, S. 66.
[46] Vgl. Wagenhofer/Ewert (2007), S. 241.
[47] Vgl. Petersen/Zwirner/Künkele (2010), S. 4.
[48] Vgl. Küting (2008), S. 760, Rn. 2136.
[49] Vgl. Fink/Schultze/Winkeljohann (2010), S. 8.
[50] Vgl. Fink/Schultze/Winkeljohann (2010), S. 8.
[51] Vgl. ebenda, S. 9 f.
[52] Vgl. Wohlgemuth (2007), S. 68.
[53] Vgl. Küting/Pfitzer/Weber, S. 647 und Küting (2008), S. 762, Rn. 2139 f.
[54] Vgl. Tanski (2006), S. 3 f.
[55] Vgl. Wohlgemuth (2007), S. 69.
[56] Vgl. Küting/Weber (2009), S. 40 und Küting/Pfitzer/Weber (2008), S. 647.
[57] Vgl. Küting (2008), S. 763 f.
[58] Vgl. Küting/Weber (2009), S. 41.
[59] Tanski (2006), S. 40.
[60] Vgl. Küting (2008), S. 894 f., Rn. 2523.
[61] Vgl. Küting (2008), S. 895 f., Rn. 2524 ff.
[62] Vgl. ebenda, S. 897, Rn. 2527.
[63] Vgl. ebenda, S. 964 f.
[64] EK, EK-Quote und Bilanzsumme sind abhängig von versch. Faktoren, u. a. Beteiligungsquote MU, EK-Quote TU, Verhältnis der Beteiligungsabweichung von anteiligen EK des TU
[65] Vgl. Küting (2008), S. 964 ff.
[66] Vgl. Küting (2008), S. 977 f., Rn. 2676/4 ff.