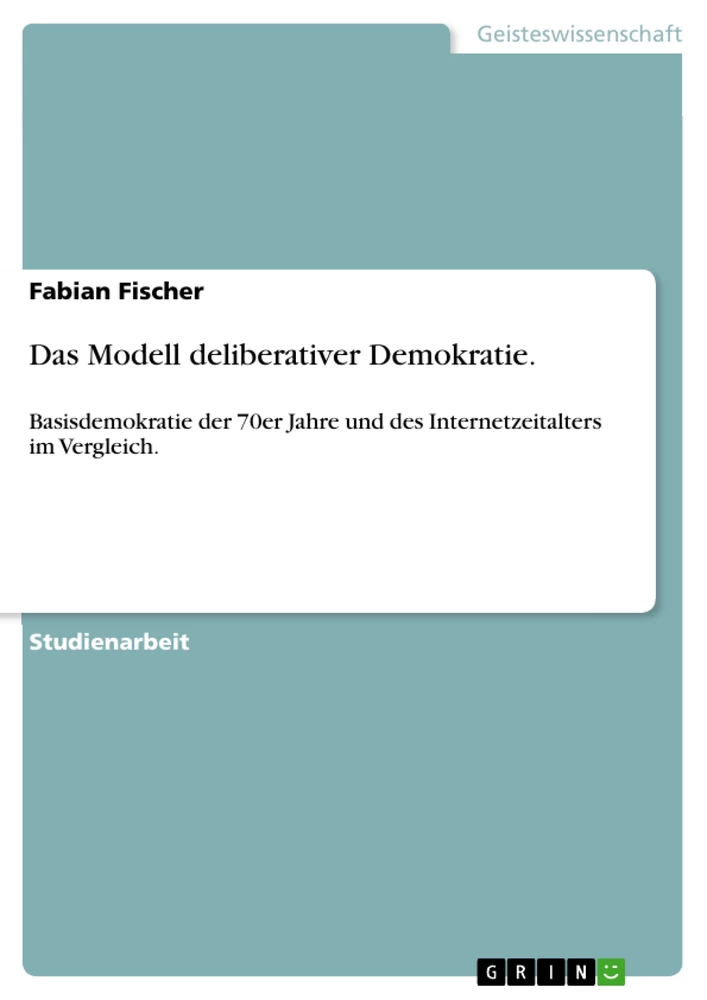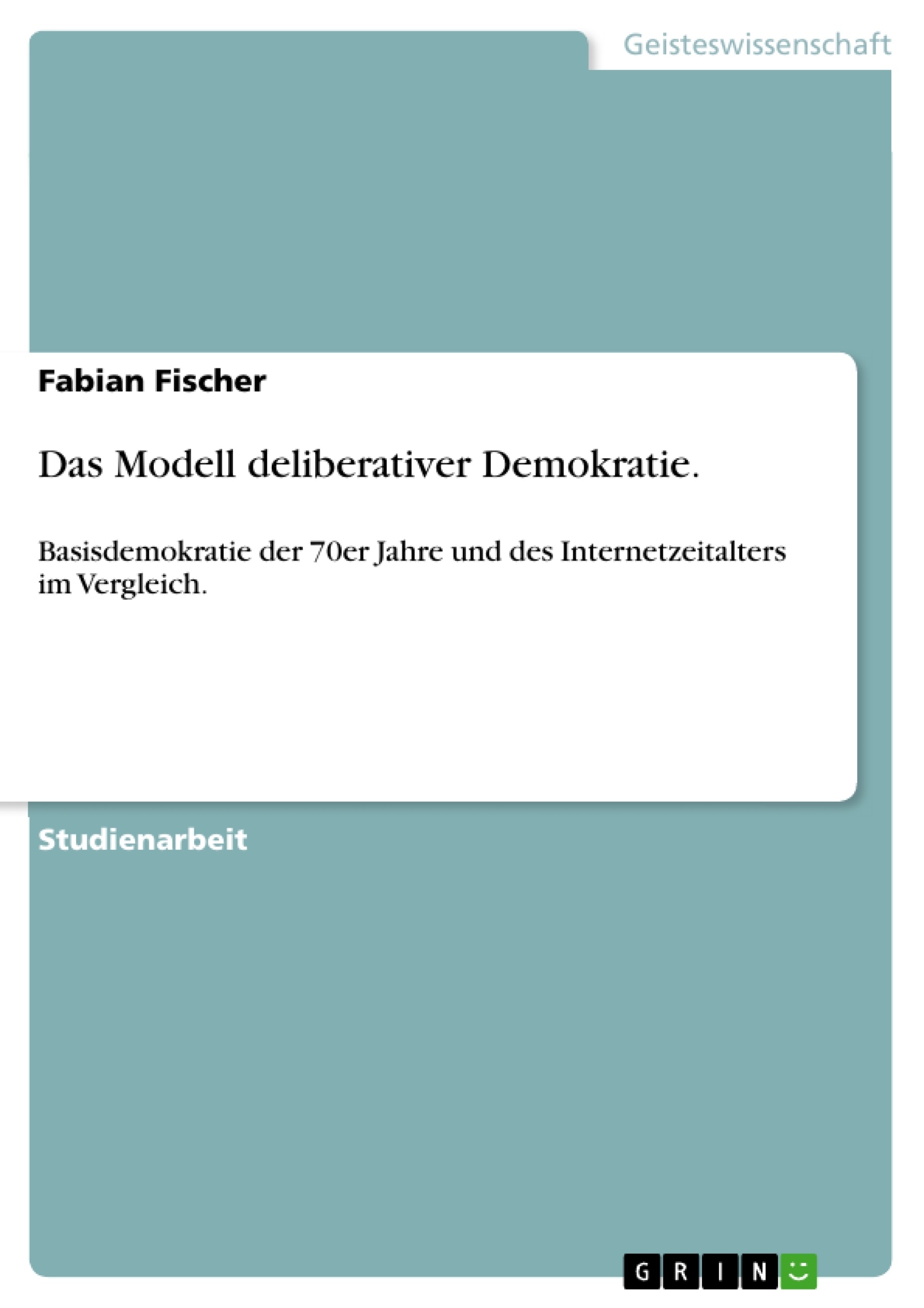Das
Modell
der
deliberativen
Demokratie,
welches
in
den
80er
Jahren
aufkam,
wurde
in
der
Vergangenheit
in
vielen
Punkten
auf
Grund
seines
basisdemokratischen
Charakters
kritisiert
und
als
idealistisch
und
nicht
anwendbar
abgestempelt.
In
Deutschland
wurde
das
Modell
der
deliberativen
Demokratie
insbesondere
von
dem
renommierten
Philosophen
Habermas
in
die
Forschung
eingebracht.
Bei
den
internationalen
Vertretern
und
Vertreterinnen
deliberativer
Demokratie
sind
unter
anderem
James
S
Fishkin
und
Seyla
Benhabib
von
großer
Bedeutung.
Der
wohl
bedeutendste
Ansatz
bei
der
Entwicklung
der
deliberativen
Demokratie
ist
hierbei
jedoch
vermutlich
Jürgen
Habermas
zuzuschreiben
(vgl.
Kost
2008:
30).
Das
Modell
der
deliberativen
Demokratie
entspricht
dem
von
vielen
Bürgern
geäußerten
Wunsch
nach
mehr
Mitbestimmung
und
einer
verstärkten
Einbeziehung
der
Öffentlichkeit
in
politische
Entscheidungen.
Ein
stetig
wachsendes
Unbehagen
darüber
wie
etablierte
Parteien
Entscheidungen
treffen,
ohne
dabei
die
Bevölkerung
einzubeziehen,
zeigt
sich
in
Deutschland
nicht
nur
an
Ereignissen
wie
Stuttgart
21.
Auch
das
plötzliche
Aufkommen
der
Piratenpartei,
mit
dem
Versprechen
politische
Entscheidungen
transparenter
zu
gestalten,
ist
ein
Indikator
für
das
Verlangen
nach
einer
neuen
Art
der
Politik.gestalten,
ist
ein
Indikator
für
das
Verlangen
nach
einer
neuen
Art
der
Politik.
Zwar
diskutiert
die
etablierte
Politik
mittlerweile
vordergründig
über
neue
Formen
der
Beteiligung
und
Einbeziehung
Betroffener
in
die
politischen
Entscheidungsfindungen,
jedoch
wurden
in
den
vergangenen
Legislaturperioden
kaum
partizipative
bzw.
deliberative
Komponenten
in
das
politische
Tagesgeschäft
integriert
(vgl.
Baus
2012:
5).
Das
Internet
hat
zunehmenden
Einfluss
auf
das
politische
und
gesellschaftliche
Entscheidungsgeschehen.
Dass
gerade
in
den
vergangenen
Jahren
der
Ruf
nach
neuen
Elementen
der
Mitbestimmung
immer
lauter
wurde
und
BürgerInnen
immer
öfter
den
öffentlichen
Diskurs
forderten,
ist
u.a.
auf
die
starke
Ausbreitung
des
Internets
zurückzuführen. So
bietet
die
digitale
Welt
neben
neuen
Wegen
der
Mobilisierung
des
gesellschaftlichen
Protests
auch
innovative
Kommunikationsmittel
wie
z.B.
Social
Medias...
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Modell der deliberativen Demokratie
3. Die Neuen Sozialen Bewegungen und Öffentlichkeit
3.1 Charakteristika der Neuen Sozialen Bewegungen
3.1.1 Die neue Reichweite der Neuen Sozialen Bewegungen
3.1.2 Die alternativen Medien
3.1.3 Die Sozialisation der Akteure
3.2 Kriterien deliberativer Demokratie
3.2.1 Die räumlichen und organisatorischen Grenzen
3.2.2 Die Medien als „Gatekeeper“
3.2.3 Das Machtgefälle zwischen den Diskursteilnehmern
4. Das Internet und die Kriterien deliberativer Demokratie
4.1 Das World Wide Web
4.2 Die schwindende Macht der klassischen Massenmedien
4.3 Die digitale Spaltung der Gesellschaft
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis