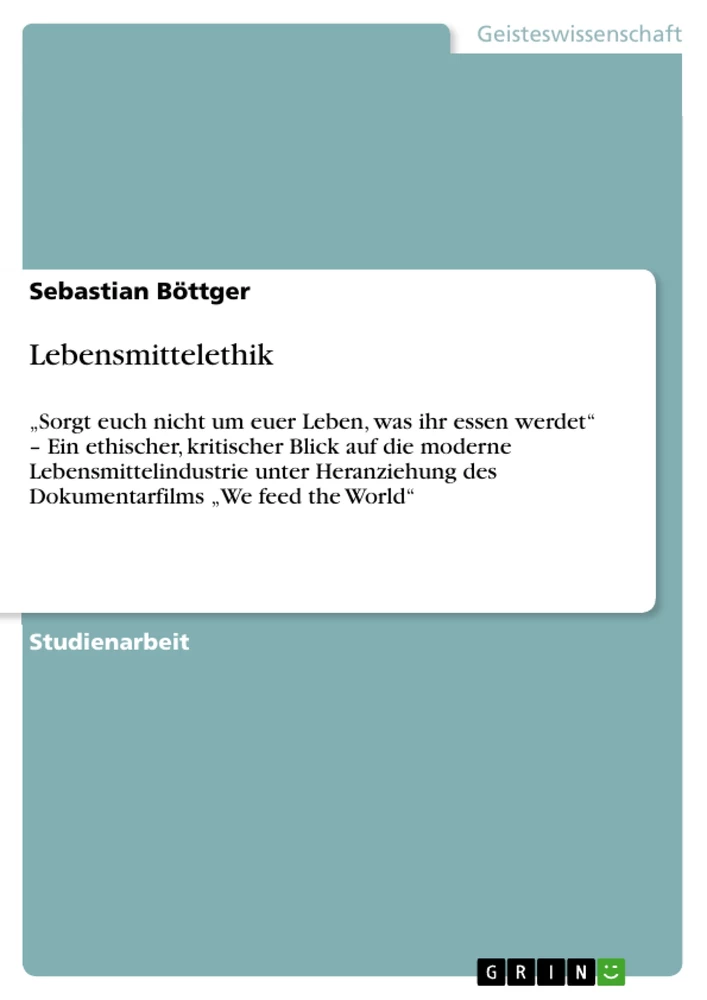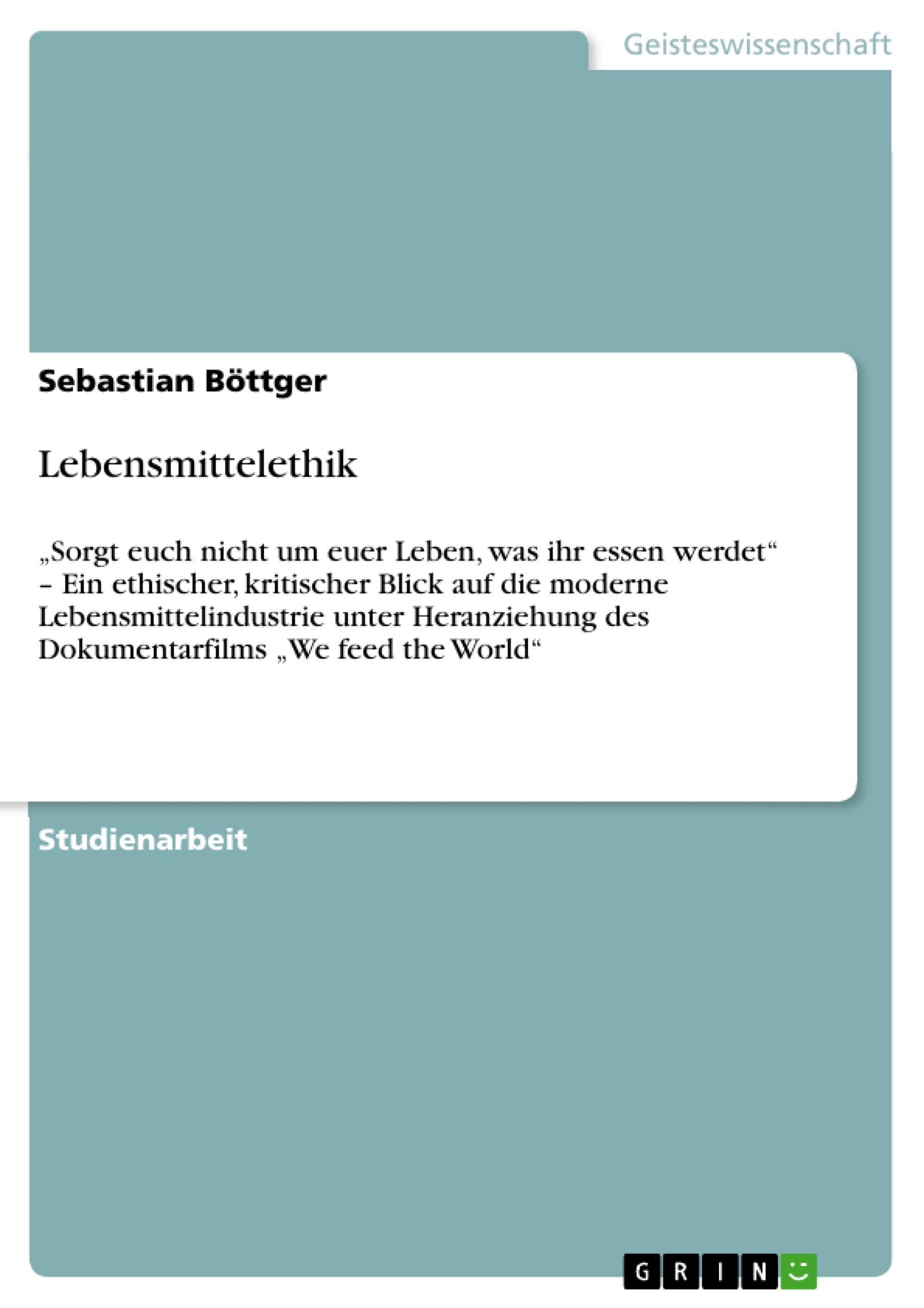„Es ist nicht zum Essen, es ist nur zum Verkaufen“ !
In dieser Arbeit wird sich mit der modernen Lebensmittelindustrie befasst. Die Grundlage für dieses Thema legt die Bergpredigt, in welcher auch davon gesprochen wird, man solle sich nicht um das Essen sorgen, welches man am nächsten Tag essen möchte. Vor 2000 Jahren waren dies trostspendende Worte, selbst bis in die moderne Neuzeit hinein.
Aber wie verändert sich die Agrar- und Landwirtschaft seitdem, bzw. wie sieht ein moderner Betrieb heute aus? Der Dokumentarfilm „We feed the World“ beschreibt dies sehr eindrucksvoll und zeigt impulsiv durch Bilder, wie der Mensch den Globus und das Ökosystem beherrscht.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Dokumentarfilm „We feed the Worl
2.1. Die Moderne Lebensmittelindustr
2.2. Schlüsse und ethische Grundsätze des Films
3. Schöpfungstheolog
3.1. Der Schöpfungsauftr
3.2. Gentechnik und die eigentliche Schöpfung Gottes
4. Fazit
5. Literaturangaben