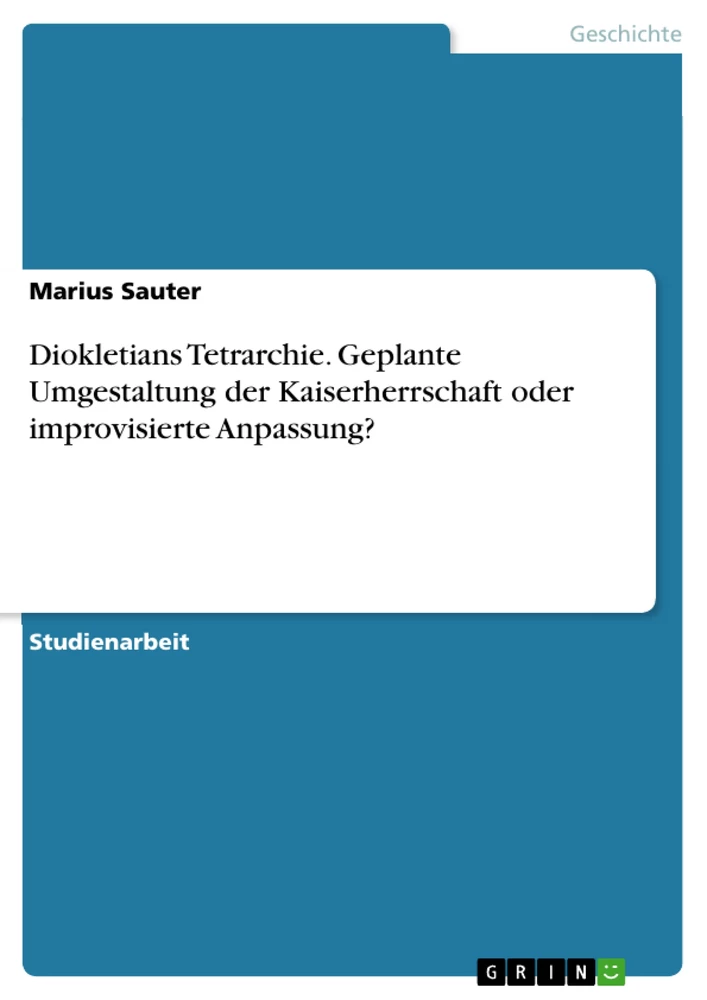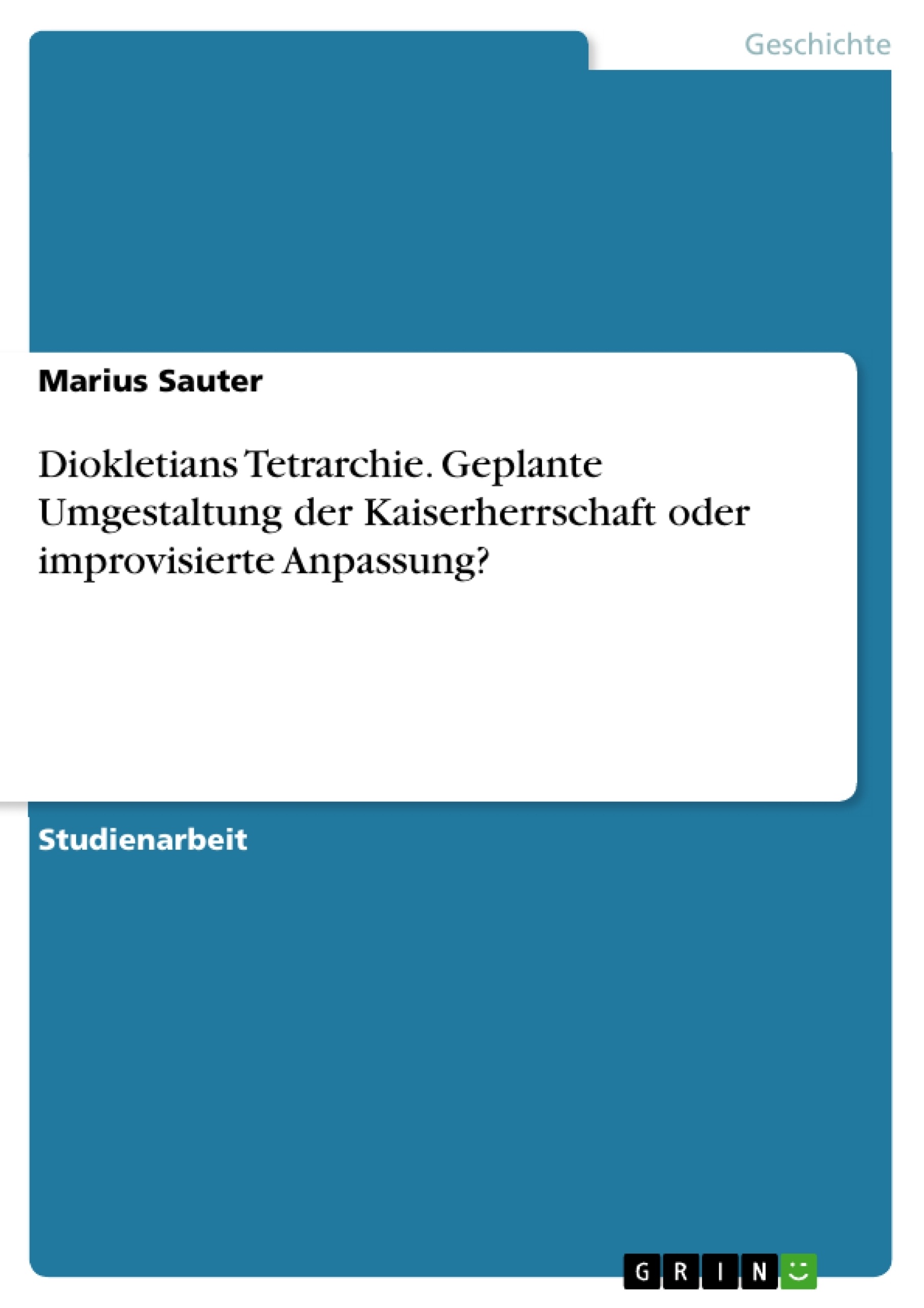Die von Diokletian eingeführte Mehrkaiserherrschaft war von ihrer Grundidee nichts sensationell neues: Bereits zuvor hatten römische Kaiser (augusti) sich Mitkaiser in der Form von caesares ernannt. Dennoch erfuhr seine Regierung ein großes Echo in den spätantiken Quellen. So heißt es etwa bei Orosius: res praeterea humano generi hucusque incognia: multorum simul regum patiens consortium et magna concordia potestasque communis, alias numquam, nunc in commune prospiciens.
Diese Eintracht (concordia) ist auch für andere spätantike Autoren ein herausragendes Merkmal der tetrarchischen Herrschaft unter Diokletian und wird als ein „bemerkenswertes Phänomen in der Geschichte Roms“ beschrieben. Selbst Laktanz, der aufgrund seines christlichen Hintergrunds eher negativ gegenüber Diokletian und dessen Regierung eingestellt war, konzediert diesem eine glückliche Hand in der Regierung, zumindest bis zur Christenverfolgung:
Diocles (sic enim ante imperium vocabatur) cum rem publicam talibus consiliis et talibus sociis everteret, com pro sceleribus suis nihil non mereretur, tamdiu tamen summa felicitate regnavit, quamdiu manus suas iustorum sanguine non inquinaret.
Die moderne Forschung ist sich einig darüber, dass die Regierungszeit Diokletians von 284 bis 305 zurecht als eine wichtige Zäsur in der römischen Geschichte anzusehen ist. Die Rezeption dieses speziellen Regierungssystems setzt sich bis in die heutige Zeit fort, wobei besonders die Frage kontrovers diskutiert wurde und wird, ob es sich bei Diokletians Tetrarchie um ein von ihm bewusst geplantes System handelte, oder ob sich dieses nach und nach aus einzelnen Reaktionen auf bestimmte politisch-administrative und militärische Notwendigkeiten heraus entwickelte. Dieser Frage soll in dieser Arbeit nachgegangen werden.
Eine umfassende Darstellung der Regierungszeit Diokletians kann und soll dabei in dieser Arbeit nicht geleistet werden. Ganz ohne die Beschreibung des historischen Kontextes jedoch kann die vorgenommene Untersuchung auch nicht auskommen.
Inhalt
I. Einleitung Seite
II. Zur Wortbedeutung und Verwendung des Begriffs „Tetrarchie“ Seite
III. Improvisation oder geplantes Vorgehen? Seite
III.1 Die Namensgebung in der ersten Dyarchie Seite
III.2 Iovius und Herculius - Die domus divina Seite
III.3 Die Ernennung der caesares Seite
III.4 Herstellung einer tetrarchischen Symmetrie Seite
III.5 Abdankung Seite
IV. Schlussbetrachtung Seite
V. Quellen- und Literaturverzeichnis Seite