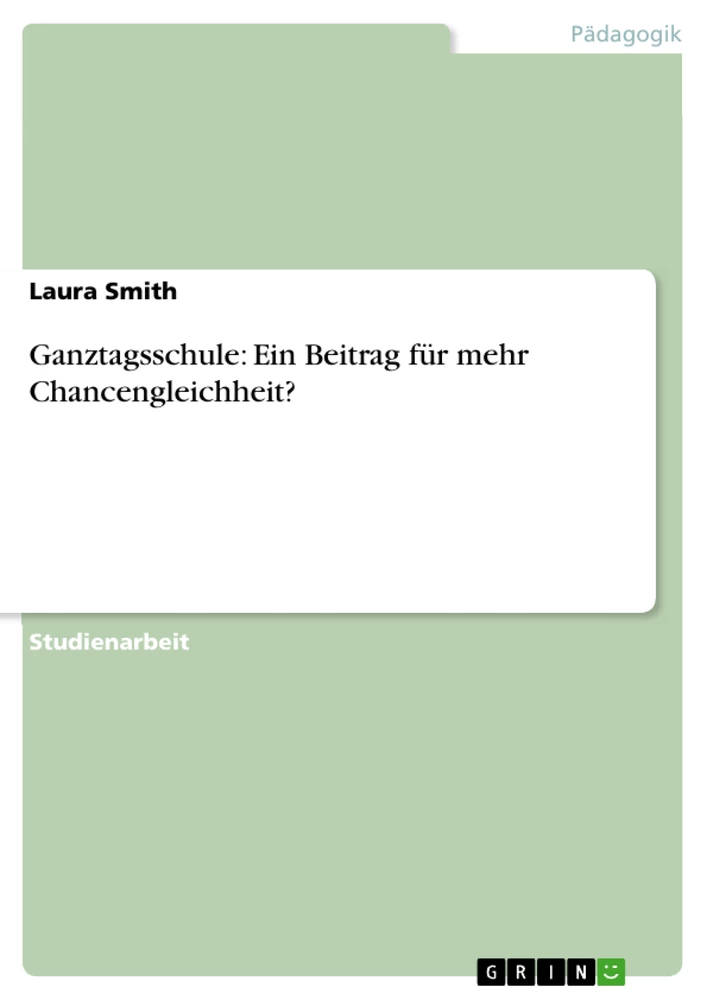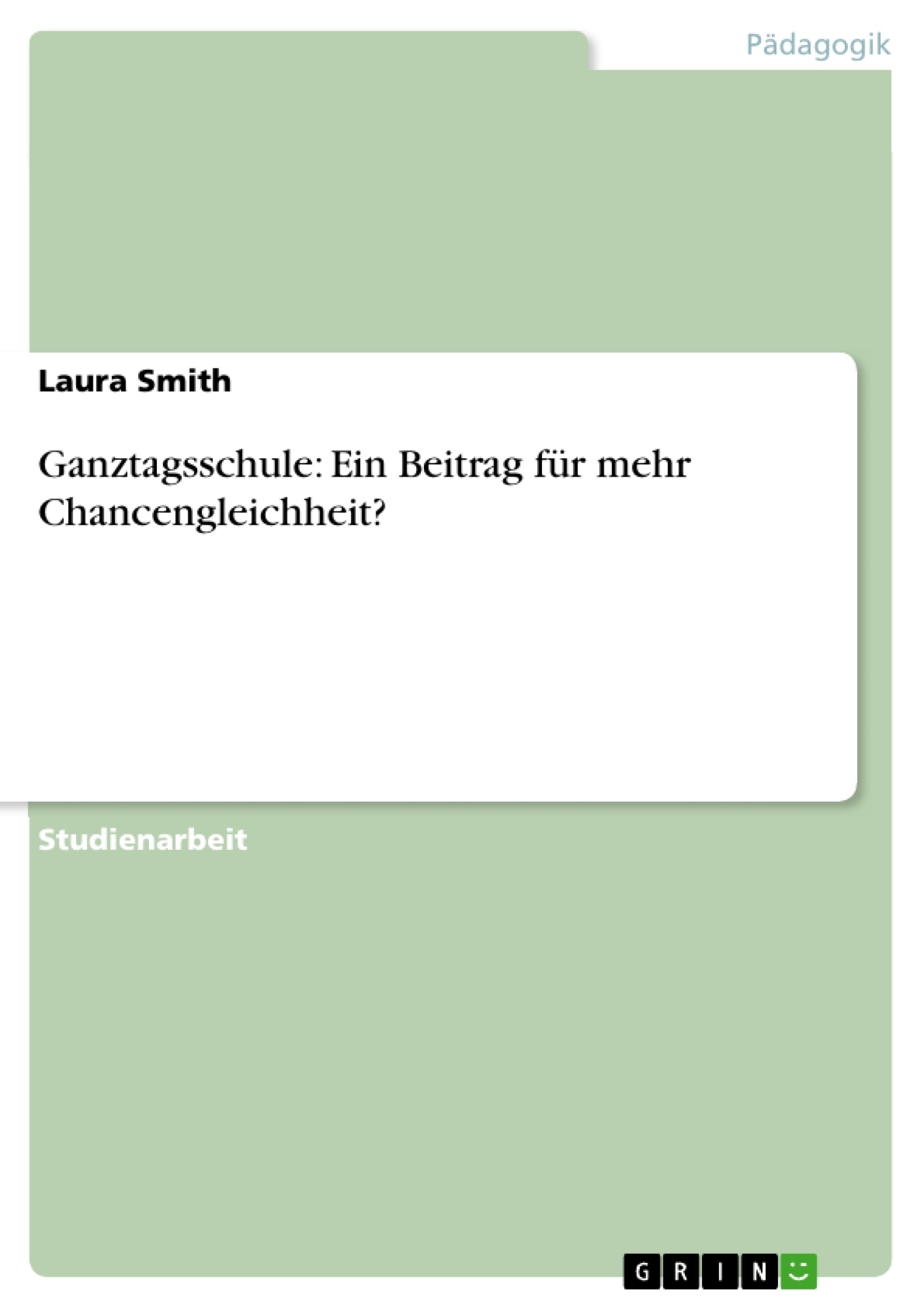Vor dem Hintergrund der verheerenden deutschen PISA-Ergebnisse wurde das deutsche Bildungssystem zunehmend Gegenstand politischer Debatten. Kritiker führten den Misserfolg der Schüler auf die überwiegend vorherrschende Halbtagsschule zurück, denn führend in den PISA-Studien waren vor allem die europäischen und außereuropäischen Ländern, in denen die Ganztagsschule bereits zahlreich etabliert ist. Somit wurde der Ruf nach Reformen immer lauter, wobei die Ganztagsschule in den Fokus der Diskussionen geriet. Einen erheblichen Beitrag zur Initiierung und Implementierung der Ganztagsschule leistete das Investitionsprogramm ‚Zukunft Bildung und Betreuung‘ (IZBB) von 2003. Im Rahmen dieser Planung flossen finanzielle Mittel in Höhe von 4 Milliarden in den Auf- bzw. Ausbau von Ganztagsschulen. Diese beträchtliche Summe an Ausgaben ist im Gegenzug mit einer Reihe an Erwartungen verbunden: So hofft man „[a]ngesichts bestehender sozialer Ungleichheiten im Zugang zu unserem Bildungseinrichtungen, im Bildungserfolg und regionaler Disparitäten im Bildungsangebot […] mehr soziale[r] Gerechtigkeit […] [zu verwirkliche[n]- das heißt schulisch gesprochen: die bestmögliche Förderung des Einzelnen bei der Realisierung von mehr Chancengerechtigkeit für alle, um durch Bildung mehr Lebens-, Berufs- und Sozialchancen zu vermitteln.“ Fraglich ist allerdings, inwieweit diese Zielorientierung im Ganztagsschulbereich in der Praxis tatsächlich realisierbar ist. In meiner Arbeit verfolge ich speziell diese Fragestellung, ob mehr Chancengerechtigkeit durch Ganztagsschulen gegeben wird. Zunächst greife ich die PISA- Studie von 2000 auf, da diese Ausgangspunkt der bildungspolitischen Diskussionen war und diese die Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem aufdeckte. Außerdem ist es wichtig in Erfahrung zu bringen, wie Kinder, die von Armut betroffen sind, aufwachsen und welche Auswirkungen dies auf den schulischen Alltag der Kinder hat. Der Schwerpunkt der Seminararbeit liegt auf die kompensatorischen Merkmale von Ganztagsschule und ihren Beitrag zu der Sicherung von mehr Chancengerechtigkeit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Chancenungerechtigkeit im deutschen Bildungssystem
3. Kinderarmut in Deutschland
4. Ganztagsschule als Hoffnungsträger für die Zukunft
5. Entlastung der Eltern?
6. Verbesserung der individuellen Förderung?
6.1 In den Unterricht integrierte Förderung
6.2 Gezielte ergänzende Fördermaßnahmen
6.3 Förderung im Rahmen des Zusatz- und Neigungsprogramms
6.4 Rahmenbedingungen der Individuellen Förderung
6.5 Erste Ergebnisse der Individuellen Förderung.. 15
7. Zusammenschau
8. Schluss
9. Literatur