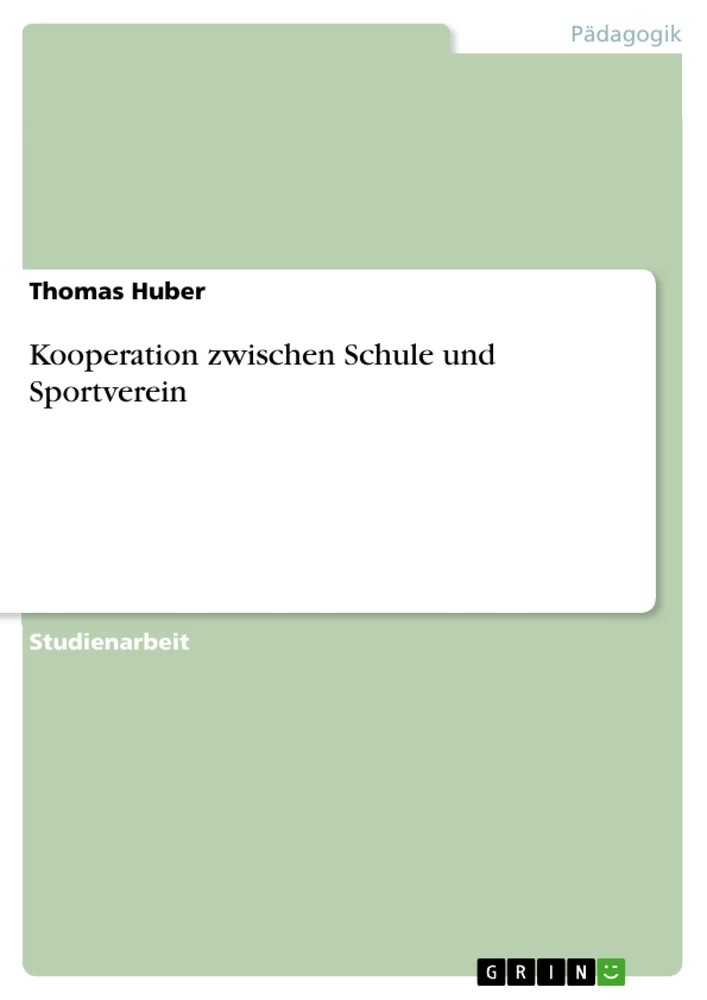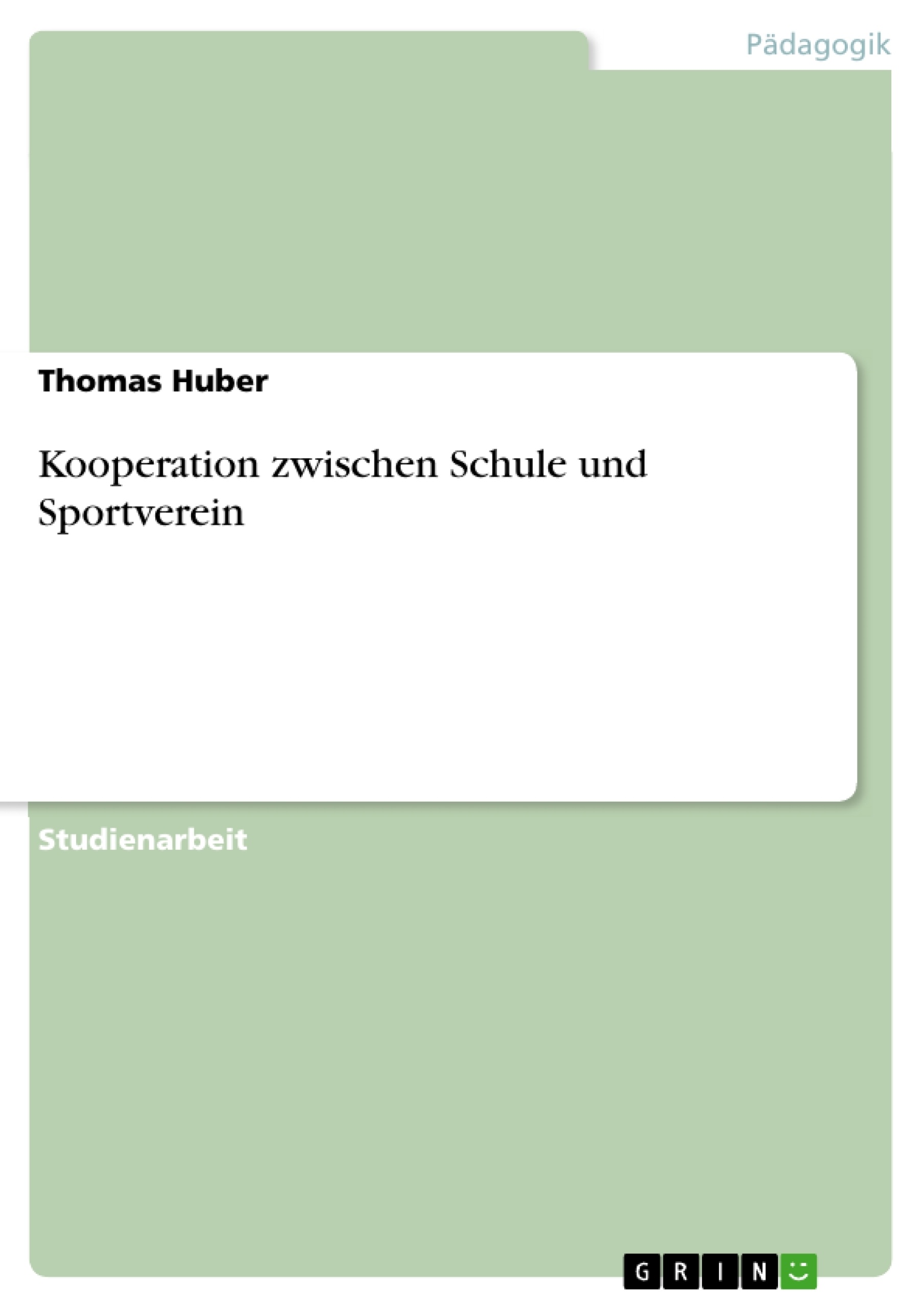Bei uns nimmt derzeit der Medienkonsum unserer Kinder und Jugendlichen ein so hohes Maß an, dass der Sport darunter leidet. Immer mehr Jugendliche treten aus Sportvereinen aus oder werden erst gar nicht mehr Mitglied. Der Grund liegt nicht darin, dass Kindern der Sport keinen Spaß mehr bereitet, es fehlt schlicht und einfach die Zeit dazu. Die Medien fesseln unsere Kinder an die Bildschirme oder der Freundeskreis zieht sie in Discos und Clubs. Ich möchte hier nicht andere Freizeitaktivitäten neben dem Sport diskreditieren, doch es muss sich bewusst gemacht werden, dass der Sport in der Schule einen erheblichen Beitrag dazu leisten kann, dem Sporttreiben wieder ein besseres Image zu verleihen.
Als optimale Unterstützung dieses Zieles ist mit Sicherheit die Kooperation zwischen Schule und Sportverein zu sehen.
In meiner Hausarbeit werde ich mich genauer mit dieser Thematik beschäftigen.
Zu Beginn gehe ich auf die jüngsten Entwicklungen der Kooperation von Schule und Sportverein und neben der finanziellen Förderung auch auf die Möglichkeiten der Kooperation in diesem Bereich ein. Hierbei geht es mir auch darum, das Thema auf das neue Konzept der Ganztagsschulen zu beziehen. Dabei geht es um den Baustein der „Kooperation Schule – Sportverein“ im Betreuungsangebot der Ganztagsschulen.
Danach werde ich die Motive der Zusammenarbeit und die Ziele der beiden Kooperationspartner sowie der Schülerinnen und Schüler aufzeigen. Nicht zu vergessen ist dabei der Bezug zum neuen Bildungsplan, indem ich die Ziele darstelle und danach aufzeige, inwieweit diese Ziele durch eine Kooperation zu erreichen sind.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Entwicklungen der Kooperation zwischen Schule und Sportverein
1.1 Möglichkeiten der Kooperation
1.2 Finanzielle Förderung der Kooperationsangebote
2 Motive und Ziele für eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein
2.1 Kooperationsziele aus Sicht der Schule
2.2 Kooperationsziele aus Sicht des Vereins
2.3 Kooperationsziele der Schülerinnen und Schüler
2.4 Motiv des Bewegungsmangels in unserer Gesellschaft
3 Eine didaktische Begründung aus Sicht der Schule
3.1 Ziele und Aufgaben des Schulsports und des neuen Bildungsplans
von 2004
3.2 Untersuchung der schulischen Ziele hinsichtlich einer Kooperation zwischen Schule und Sportverein (Ziele kursiv)
4 Schlussbetrachtung
5 Bezug zu den weiteren besuchten Lehrveranstaltungen
5.1 Lehrveranstaltung – Schulentwicklung in der Grundschule
5.2 Lehrveranstaltung – Erziehung und Schule im Spiegel der Rechtsprechung
Literaturverzeichnis