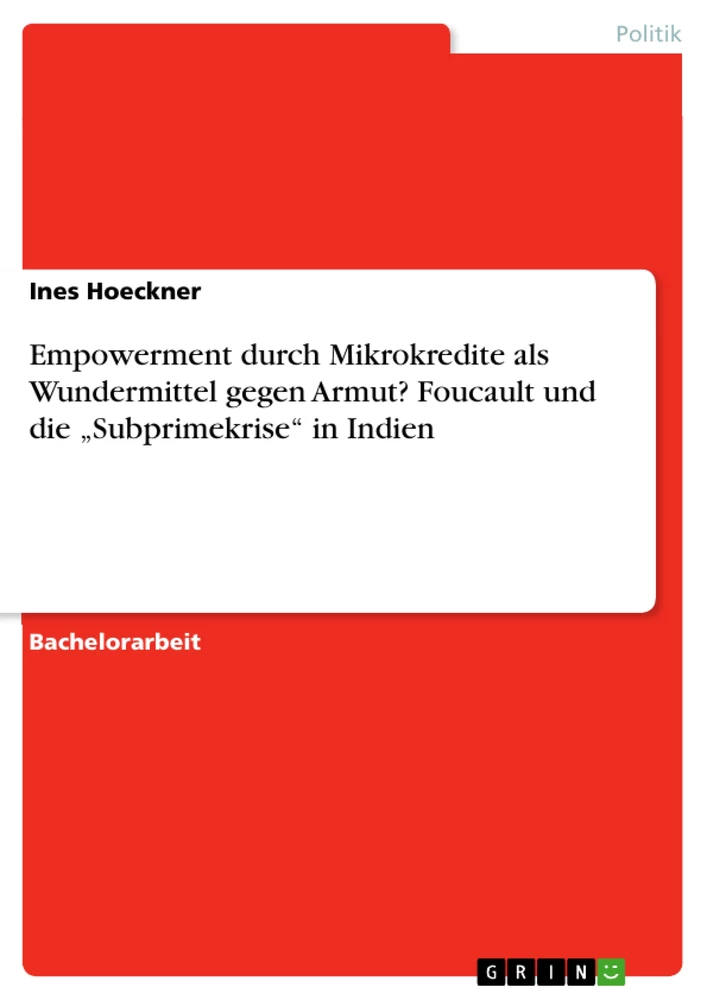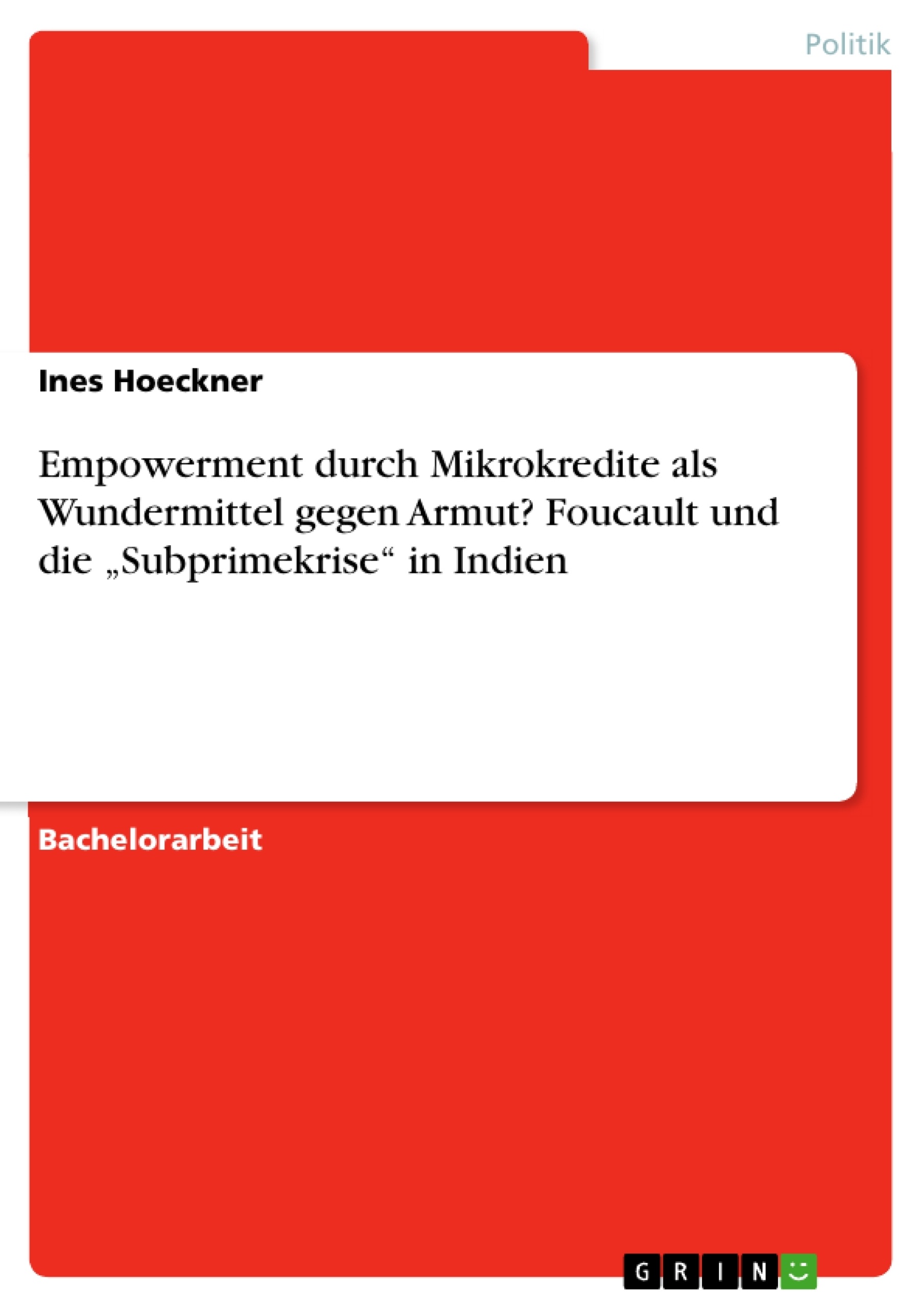In dieser Arbeit wird zuerst eine vertiefende Einführung in Foucaults spätere Konzepte von Macht (wie Bio-Macht, Panoptismus, Gouvernmentalität u.a.) gegeben, welche als Analyserahmen dienen, um das Modell der Mikrokredite zu untersuchen, mit dem Fallbeispiel Indien.
Es soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern ein ökonomisches Modell, wie das der Mikrofinanzierung, eine Strategie für das komplexe Konzept von Frauen-Empowerment darstellt und ob es als solches über eine wirtschaftliche Besserstellung hinausgehen und längerfristig Machtbeziehungen umformen kann.
Die Sekundärfragen der Arbeit lauten: Kam es zu einer „Finanzialisierung des Alltags“ und zu einer „Feminisierung der Armut “ statt zu Empowerment und Armutsreduktion? Werden die erklärten Ziele der Armutsreduktion und des Empowerment durch marktstrategische Interessen in den Schatten gestellt? Unterliegen Mikrokredite also grundlegenden Funktionen kapitalistischer Verwertungslogik und können sie herrschende Verhältnisse, Ursachen von Armut und Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstands hinterfragen und ändern? Mein Ziel ist nicht, Mikrofinanzierung per se als gut oder schlecht zu befinden, sondern ihrem Potential für Empowerment und ihren Implikationen im Bezug auf Armutsreduktion nachzugehen.
In erster Linie sollen jene Machtbeziehungen freigelegt werden, die in diesem Kontext Wissen und Wahrheiten produzieren um so herauszufinden, welche Mechanismen hemmend oder fördernd wirken, wie sie funktionieren, zwischen wem, wie und wo sie wirken und zu welchem Zweck sie ablaufen, sowie welche Subjekte und Wirklichkeiten sie produzieren. Zentral dafür ist ein Verständnis von Macht an sich. Darum scheint Foucaults Machtbegriff, wie er ihn in seiner genealogischen Phase entwickelte, als wertvoller theoretischer Bezugsrahmen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Begriffsbestimmungen
Armut
Entwicklung: Entwicklungstheorien im Wandel
1 Einleitung
1.1 Fragestellung und Ziel der Arbeit
2 Foucaults Konzept von Macht
2.1 Disziplinarmacht
2.2 Panoptismus
2.3 Disziplinargesellschaft
2.4 Bio-Macht und Sexualitätsdispositiv
2.4.1 Bio-Macht
2.4.2 Sexualitätsdispositiv
2.5 Gouvernmentalität
2.6 Zusammenfassung Macht
3 Frauen Empowerment durch Mikrokredite
3.1 Die Geschichte des (Mikro)-Kredits
3.2 Die „Entdeckung der Frauen“
3.3 Polarisierung im Entwicklungskontext
3.4 Entwicklungspolitischer und ökonomischer Wandel im historischen Kontext
3.4.1 Bedeutungsgewinn der NGOs als Entwicklungsagenten
3.5 Veränderungen im Entwicklungsdispositiv
3.6 Empowerment: Die Problematik des Empowerment-Konzepts
3.6.1 Verschiedene Machtansätze
3.6.2 Was also ist Empowerment?
3.6.3 Bedeutungsverschiebung im Entwicklungsdiskurs
3.7 Das Konzept der Mikrokredite
3.7.1 Das Grameen Modell
3.7.2 Disziplinierung durch Kredite – eine panoptische Machttechnologie
3.7.3 Empowerment durch Mikrokredite: Konzeptueller Rahmen
4 Der Mikrofinanz-Boom: Ein Makrophänomen mit Auswirkungen auf die Mikroebene Fallbeispiel Indien
5 Zusammenfassung der kritischen Gesichtspunkte
6 Fazit
Bibliographie