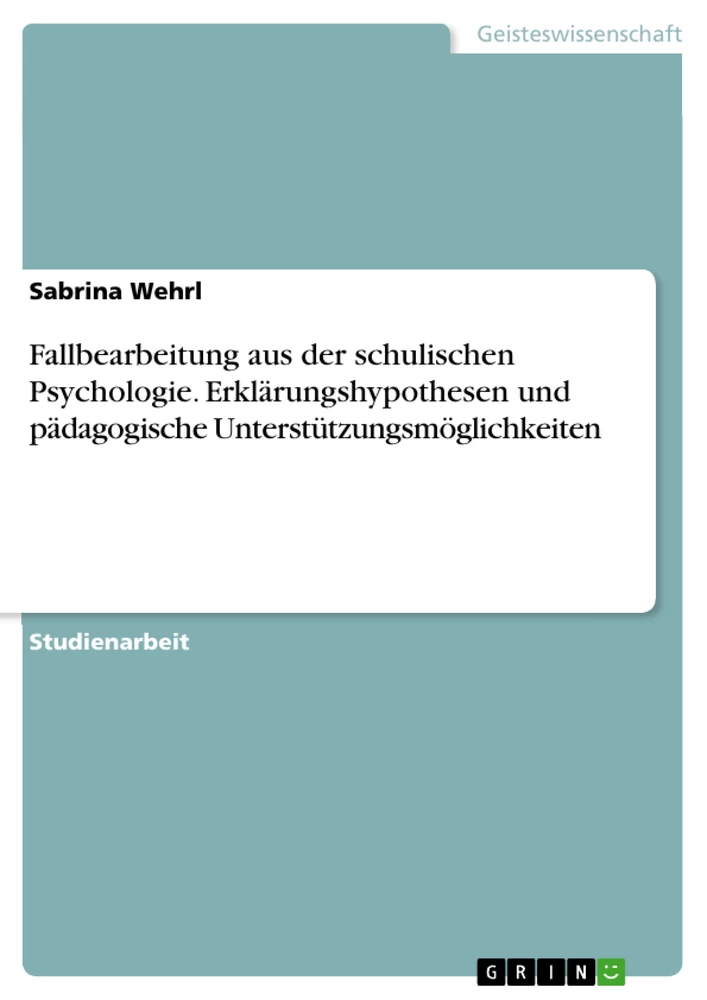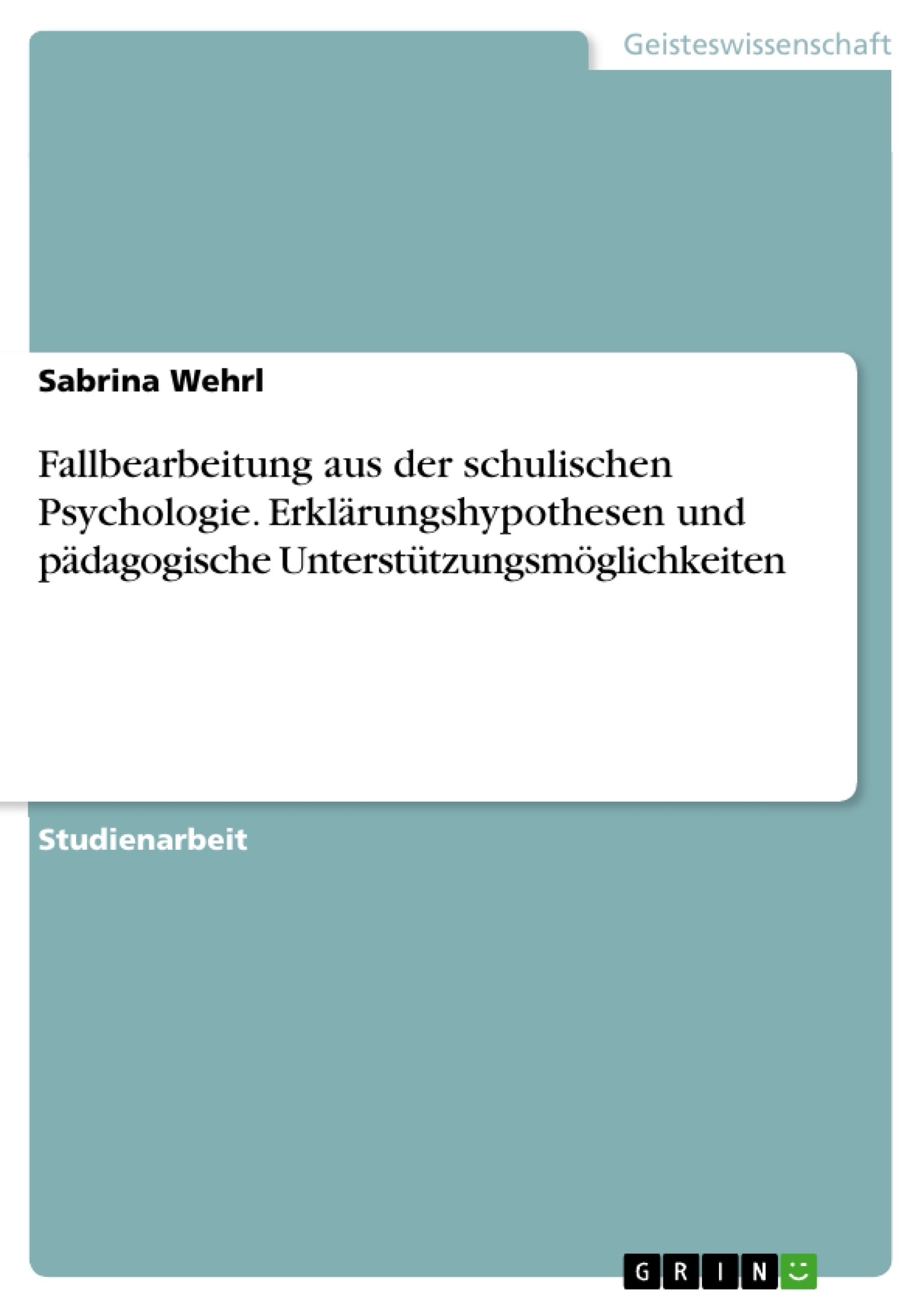Nach den Informationen der Falldarstellung leidet die Schülerin an einem starken inneren Druck. Diese Art der Anspannung ist vermutlich sehr komplex und wird sowohl durch äußere, als auch innere Faktoren verursacht. Wie sich in vielen Studien herauskristallisiert hat, gibt es keine einheitlichen Faktoren, auf welche man Schulversagen zurückführen könnte. Stattdessen kommen viele „unterschiedliche Bedingungen infrage, die den Schulerfolg gefährden können".
Eine Möglichkeit, schulische Leistungsentwicklung von Kindern zu erklären, ist die Analyse von internen und externen Bedingungen. Während zu den internen Faktoren beispielsweise die Intelligenz, die Motivation und das Lernverhalten zählen, spielen bei den externen Faktoren unter anderem die Schichtzugehörigkeit, die Familienstruktur und das elterliches Engagement eine große Rolle. Im Folgenden wird versucht, einige Erklärungshypothesen für J.s schulische Situation aufzustellen, um anschließend anhand pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie in J.s Fall zukünftig vorgegangen werden könnte.
2.1 Erklärungshypothese 1: Familiäre Situation
2.2 Erklärungshypothese 2: Vorkenntnisdefizite
2.3 Erklärungshypothese 3: Geringes Fähigkeitsselbstkonzept
2.4 Erklärungshypothese 4: Außenseiterrolle in der Klasse
3. Aufzeigen pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten, um Jessicas häusliche sowie schulische Situation zu verbessern
Inhaltsverzeichnis
1. Falldarstellung
1.1 Beratungsanlass
1.2 Gespräche
1.2.1 Gespräch mit der Schülerin
1.2.2 Gespräche mit Schülern
1.2.3 Gespräche mit den Eltern
1.3 Informationen von Lehrkräften
1.4 Schulische Dokumente
2. Mögliche Erklärungshypothesen für die schulische Situation
2.1 Erklärungshypothese 1: Familiäre Situation
2.2 Erklärungshypothese 2: Vorkenntnisdefizite
2.3 Erklärungshypothese 3: Geringes Fähigkeitsselbstkonzept
2.4 Erklärungshypothese 4: Außenseiterrolle in der Klasse..
3. Aufzeigen pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten, um häusliche sowie schulische Situation der Schülerin zu verbessern
3.1 Erziehungs-/Familienberatung
3.2 Professioneller Nachhilfeunterricht
3.3 Maßnahmen auf Schul- und Klassenebene: Anti-Mobbing-Arbeit auf Basis des
Gegen Gewalt-Konzepts
3.3.1 Kontaktaufnahme und Erstgespräch
3.3.2 Gespräch mit den Tätern
3.3.3 Beratungsstunde
3.3.4 Nachbesprechung und Abschlussrunde
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis