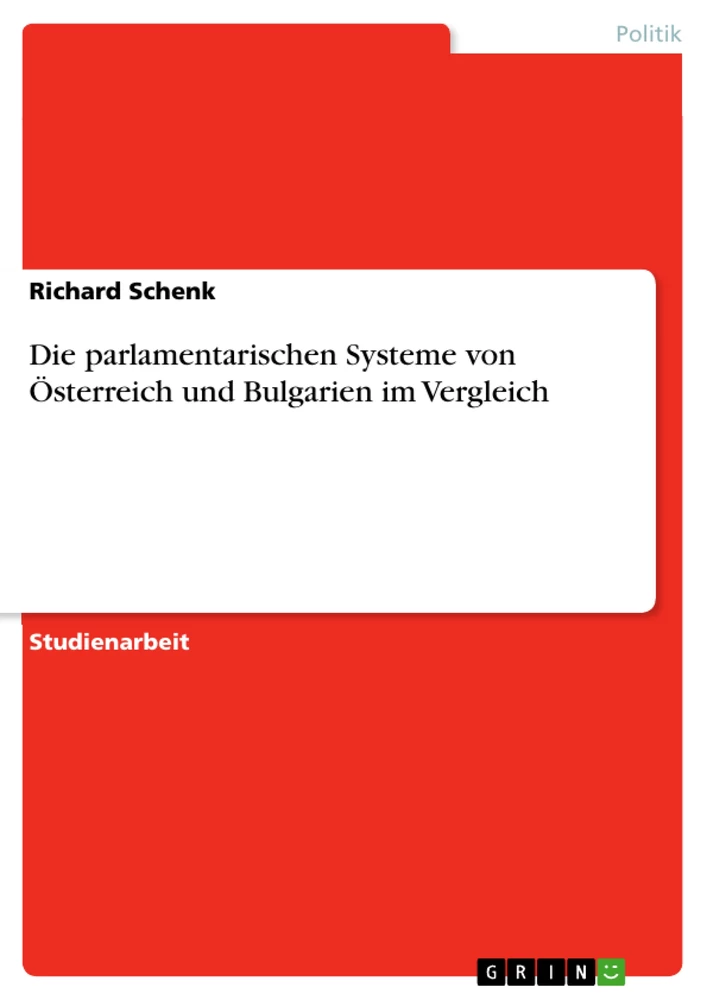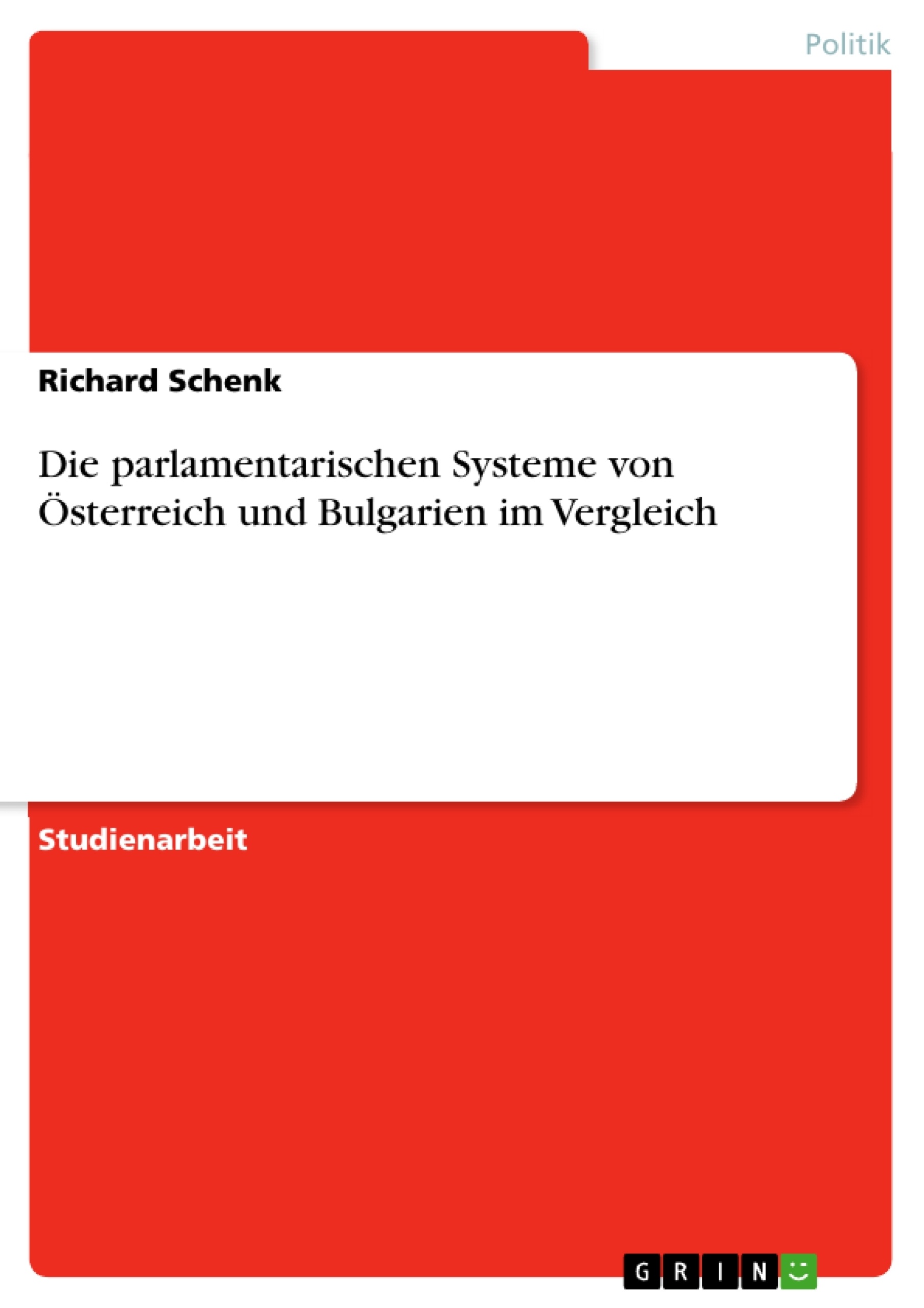Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich der parlamentarischen Systeme von Österreich und Bulgarien, um durch die Schließung dieser Forschungslücke einen Erkenntnisgewinn herbeizuführen. Dabei werden auch die aktuellsten Entwicklungen des Jahres 2013 berücksichtigt. Bei der Auswahl des Forschungsdesigns handelt es sich naturgemäß um ein most similar cases design (MSSD), dessen Stärke die fallorientierte Herausarbeitung der wesentlichen Unterschiede parlamentarischen Systeme der beiden Länder ausgehend von deren Gemeinsamkeiten ist, auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte.5 Dazu sollen zuerst die Kernelemente der politischen Systeme beider Länder direkt verglichen werden. Der zeitliche Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Zeit nach 1990, da Bulgarien vorher als Volksrepublik kein parlamentarisches System aufwies. Zum Schluss ist der Versuch, aus den gewonnenen Erkenntnissen eine abstraktere Theorie gemäß den Prinzipien der Induktion zu folgern und eine kurze Prognose der wahrscheinlichen zukünftigen Entwicklung.
Gliederung
1. Einleitung
2. Die Elemente der parlamentarischen Systeme von Bulgarien und 4 Österreichs
2.1. Historischer Überblick für Bulgarien seit 1945
2.2. Historischer Überblick für Österreich seit 1945
2.3. Gewaltenteilung
2.4. Parlamentarismus und Wahlsystem
2.5. Parteien und Verbände
2.6. Politische Kultur
3. Schlussfolgerungen aus dem Vergleich
4. Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis