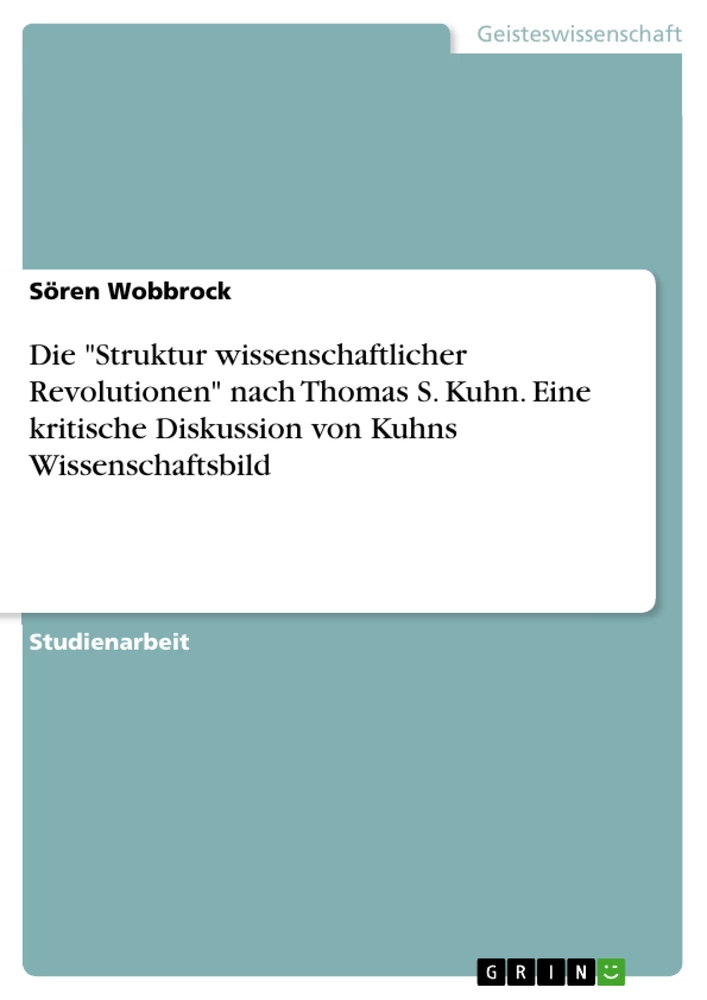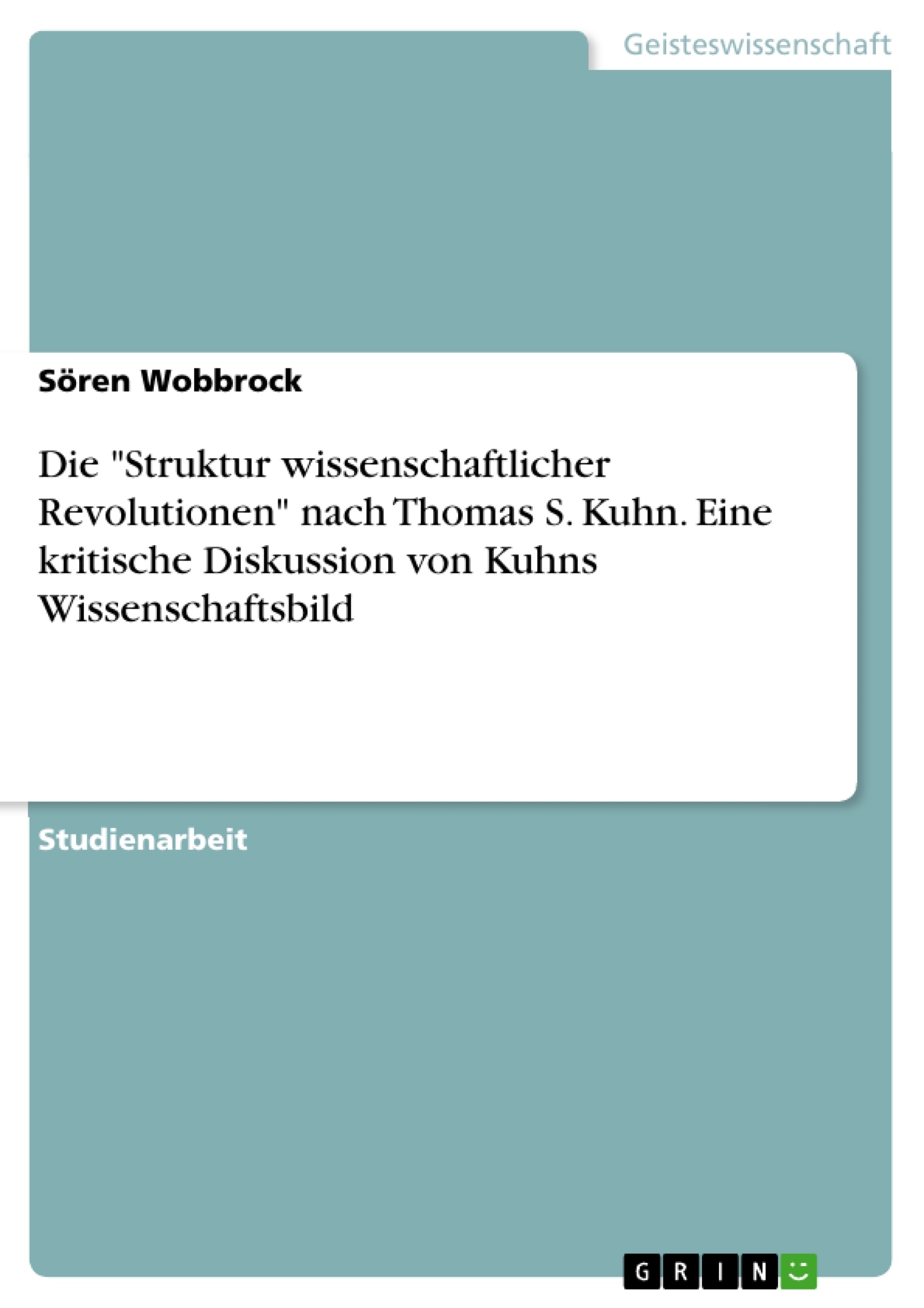Kern dieser Seminararbeit bildet das Essay "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" von Thomas S. Kuhn, dessen theoretischer Ansatz hier vorgestellt und nachfolgend kritisch diskutiert werden soll. Ziel ist es, Kuhns Idee vom wissenschaftlichen Fortschritt als evidentes Erklärungsmodell darzulegen.
Allerdings soll zunächst einmal komprimiert auf jene Vorstellung von Wissenschaftsentwicklung eingegangen werden, der sich Kuhn mit seinem Ansatz explizit widersetzt. Zum einen beanstandet er die Vorstellung der kumulativen Wissenschaftsentwicklung infolge einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Anpassung von bestehenden Theorien (vgl. Kuhn 1974a: 1). Kuhn bestreitet keinesfalls den Fortschritt von Wissenschaft, jedoch vollzieht sie sich für ihn nicht konstant im Rahmen einer Theorie (vgl. Kuhn 1974a: 1). Vielmehr ist der Fortschritt durch Brüche, Verwerfungen und Neuanfänge geprägt (vgl. Kuhn 1974a: 2–3). Zum anderen kritisiert Kuhn die Vorstellung, dass die Wissenschaft die Wirklichkeit zu beschreiben und zu erfassen versuche, um sich der faktischen Wahrheit anzunähern (vgl. Kuhn 1974a: 1). Kuhn hingegen ist der Meinung, dass Wahrheit nicht objektiv sein kann und sich stets relativ an den wechselnden historischen Weltanschauungen bemisst (vgl. Kuhn 1976: 21–22).
In der Konsequenz aus der Auseinandersetzung mit dem knapp umrissenen Modell erarbeite Kuhn seine Ideen von Wissenschaft und wissenschaftlichem Fortschritt sowie Wissenschaft und Wahrheit. Im Folgenden werden die verwendeten Begriffe von Kuhn näher vorgestellt und anschließend diskutiert.
Gliederung
1. Einleitung
2. Paradigma und Normalwissenschaft
2.1. Vorparadigmatische Zeit und wissenschaftliche Gemeinschaft
2.2. Paradigmen
2.3. Normatwissenschaftliche Forschung
2.4. Anomalie und Krise
3. Wissenschaftliche Revolutionen
3.1. Voraussetzungen. Genese und Merkmale wissenschaftlicher Revolutionen
3.2. Theoriewahl und Inkommensurabilitätsthese
4. Wissenschaftlicher Fortschritt und Relativismus
4.1. Normatwissenschaftlicher und revolutionärer Fortschritt
4.2. Historischer Relativismus
5. Kritische Diskussion des kuhn'schen Konzepts
5.1. Kritische Betrachtung der Normalwissenschaft
5.2. Kritische Betrachtung der wissenschaftlichen Revolutionen
6. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis