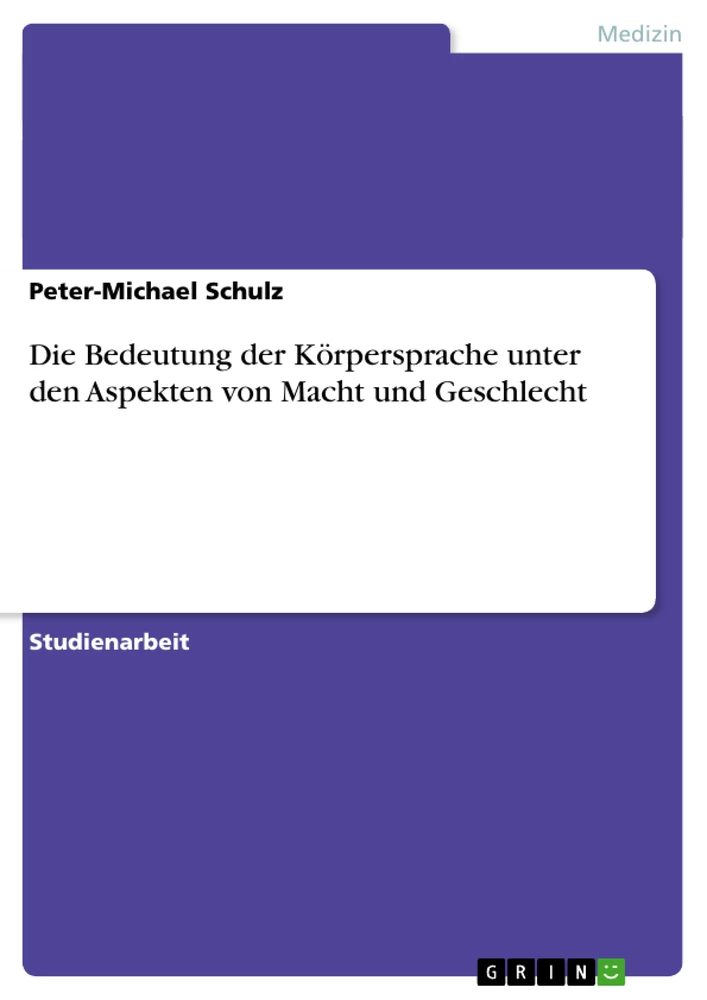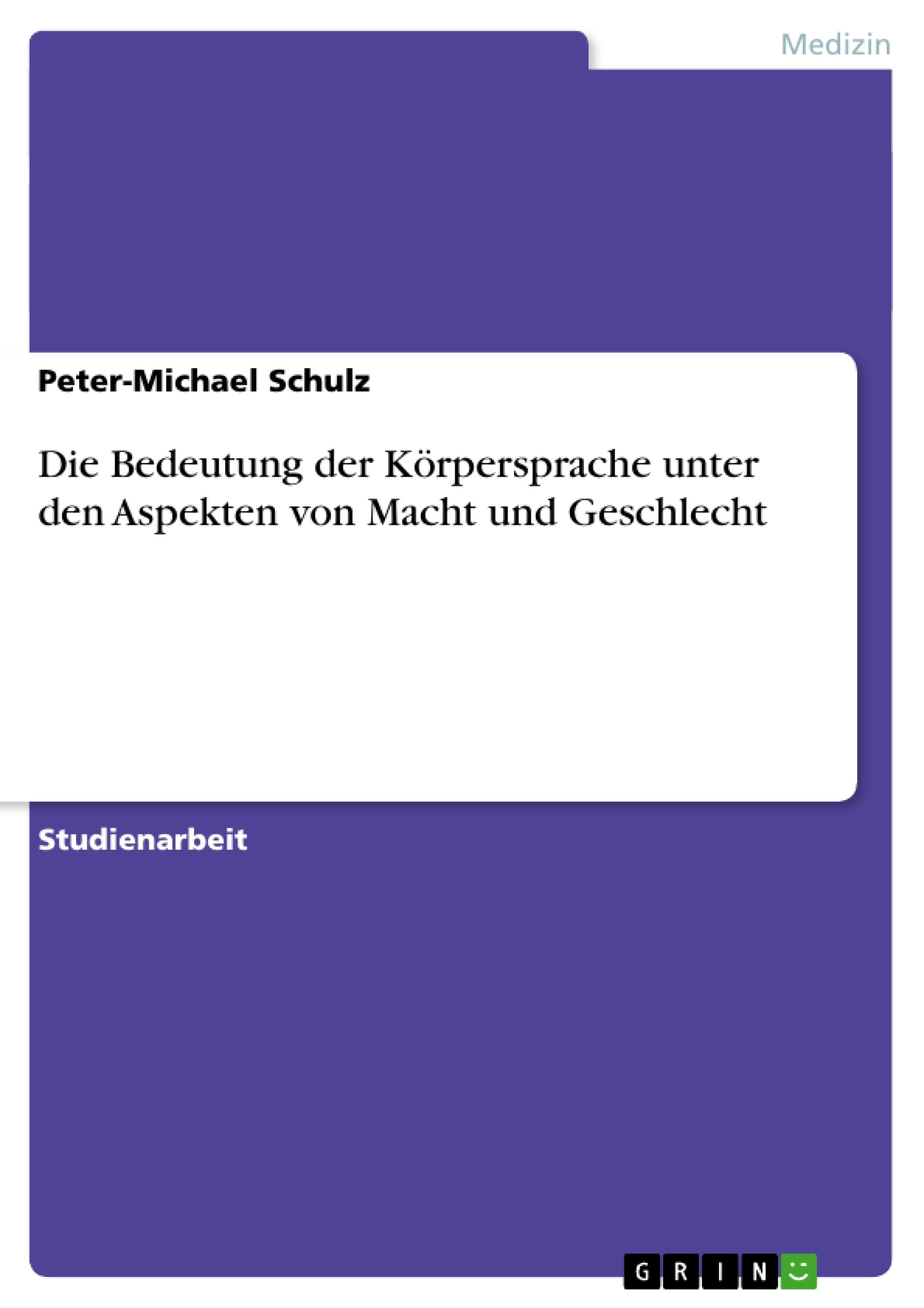Einleitung
„Body politics: Power, sex and nonverbal communication.“ lautet der Titel, den die Autorin Nancy M. Henley für ihr Buch gewählt hat. Es erschien 1977 in der USA, wurde aus dem Amerikanischen von Helga Herborth übersetzt und 1988 erstmalig auch in Deutschland gleichnamig unter: „Körperstrategien. Geschlecht, Macht und nonverbale Kommunikation“ verlegt. Henley analysiert Gesten der nonverbalen Kommunikation im alltäglichen Handeln und deren Beziehung zur Macht und dem Geschlecht. Sie untersucht die unbewussten Interaktionen insbesondere zwischen Mann und Frau und entlarvt jene Körperstrategien, die eine Dominanz oder Unterwerfung im patriachalen System kennzeichnen. Die Autorin bündelt ihre Thesen und Erkenntnisse in einem zusammenfassenden Kapitel in Form von achtzehn Aussagen (H., S. 258 – S. 287). Diese Aussagen möchte ich nun vorstellen und erläutern (in den Abschnitten 3 und 4 dieser Hausarbeit). Zuvor werde ich noch etwas zu der Person Nancy M. Henley und ihrem Anliegen sagen (Abschnitt 2). Vor der abschließenden Zusammenfassung (Abschnitt 6) werde ich aktuelle Daten, Überlegungen und Fragen zum heutigen Geschlechterverhältnis zur Diskussion stellen (Abschnitt 5). Sämtliche in der Hausarbeit folgenden Zitate stammen, wenn nicht anders gekennzeichnet, aus diesem Text und werden von mir, zwecks besserer Übersicht, nur noch mit der Abkürzung „H.“ und der Seitenzahl angegeben. Personen werden in dieser Arbeit von mir meistens in der männlichen Ausdrucksweise genannt. Dies soll lediglich einer besseren Lesbarkeit dienen und nicht diskriminierend wirken.
Die Autorin Nancy M. Henley und ihr Anliegen
Nancy M. Henley ist Professorin für Psychologie an der „University of California“ in Los Angeles. Sie ist dort Leiterin der Abteilung für Frauenstudien. Ihren akademischen Grad erlangte sie 1968 an der John Hopkins University. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Kommunikation, Geschlechterforschung, nonverbales Verhalten. Sie bietet zu folgenden Themen Seminare an (http://henley.socialpsychology.org):
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Autorin Nancy M. Henley und ihr Anliegen
3. Henley’s Thesen und Erkenntnisse
4. Geschlecht, Macht und nonverbale Kommunikation – Erläuterungen zu Henley’s Aussagen
5. Diskussion zum heutigen Geschlechterverhältnis und den Aussagen Henley’s
6. Zusammenfassung
7. Literaturangaben
1. Einleitung
„Body politics: Power, sex and nonverbal communication.“ lautet der Titel, den die Autorin Nancy M. Henley für ihr Buch gewählt hat. Es erschien 1977 in der USA, wurde aus dem Amerikanischen von Helga Herborth übersetzt und 1988 erstmalig auch in Deutschland gleichnamig unter: „Körperstrategien. Geschlecht, Macht und nonverbale Kommunikation“ verlegt. Henley analysiert Gesten der nonverbalen Kommunikation im alltäglichen Handeln und deren Beziehung zur Macht und dem Geschlecht. Sie untersucht die unbewussten Interaktionen insbesondere zwischen Mann und Frau und entlarvt jene Körperstrategien, die eine Dominanz oder Unterwerfung im patriachalen System kennzeichnen.
Die Autorin bündelt ihre Thesen und Erkenntnisse in einem zusammenfassenden Kapitel in Form von achtzehn Aussagen (H., S. 258 – S. 287). Diese Aussagen möchte ich nun vorstellen und erläutern (in den Abschnitten 3 und 4 dieser Hausarbeit). Zuvor werde ich noch etwas zu der Person Nancy M. Henley und ihrem Anliegen sagen (Abschnitt 2). Vor der abschließenden Zusammenfassung (Abschnitt 6) werde ich aktuelle Daten, Überlegungen und Fragen zum heutigen Geschlechterverhältnis zur Diskussion stellen (Abschnitt 5).
Sämtliche in der Hausarbeit folgenden Zitate stammen, wenn nicht anders gekennzeichnet, aus diesem Text und werden von mir, zwecks besserer Übersicht, nur noch mit der Abkürzung „H.“ und der Seitenzahl angegeben.
Personen werden in dieser Arbeit von mir meistens in der männlichen Ausdrucksweise genannt. Dies soll lediglich einer besseren Lesbarkeit dienen und nicht diskriminierend wirken.
2. Die Autorin Nancy M. Henley und ihr Anliegen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nancy M. Henley ist Professorin für Psychologie an der „University of California“ in Los Angeles. Sie ist dort Leiterin der Abteilung für Frauenstudien. Ihren akademischen Grad erlangte sie 1968 an der John Hopkins University. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Kommunikation, Geschlechterforschung, nonverbales Verhalten. Sie bietet zu folgenden Themen Seminare an (http://henley.socialpsychology.org):
- Introduktion to Women´Studis
- Psychology of Language and Communikation
- Psychology of Language and Gender
- Psychology of Nonverbal Behavior
- Seminar on Language, Power and Oppression
- Women´s Studies Senior Seminar.
Henley möchte mit dem Buch „Körperstrategien. Geschlecht, Macht und nonverbale Kommunikation“ ein Nachdenken über nonverbales Verhalten anregen und über
Zusammenhänge scheinbar harmloser Gesten, als Ausdrucksmittel hierarchischer Strukturen in unserer patriachalen Gesellschaft, aufklären. Sie wendet sich mit ihrem Text, nach eigener Bekundung, vorwiegend an folgende Personenkreise:
- „Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts unterdrückt werden“ (H., S. 7)
- „Menschen, die fühlen, dass sie unterdrückt werden, aber oft nicht wissen, welches die Mechanismen sind“ (H., S. 7)
- Personen, „die gegen offene und krude Machtausübung über ihr Leben protestieren und sich dagegen wehren, die aber gleichzeitig die Bedeutung vieler ihrer Interaktionen, an denen Macht beteiligt ist, ignorieren.“ (H., S. 7)
- Menschen, „die sich (...) über Ungerechtigkeiten und die Ungleichheit um sie herum empören“, auch „wenn sie nicht unmittelbar betroffen sind.“ (H., S. 7-8)
- Menschen, „die sich von der Flut von Buch- und Medienpublikationen beeinflussen ließen“ in denen verbreitet wird, die „Körpersprache sei trivial oder hauptsächlich ein Medium, Gefühle auszudrücken“ und Geschlechtsspezifisches Handeln rein genetisch begründen (H., S. 7-8)
- „alle, die mehr über nonverbale Kommunikation wissen möchten und etwas darüber erfahren wollen, was zwischen ihnen und anderen auf Ebenen geschieht, die ihnen nicht bewusst sind.“ (H., S. 8) Henley denkt hier u.a. an „Studenten und Forscher“ und hofft, dass sie „die Ideen, (..), weiterentwickeln werden.“ (H., S. 8)
Viele ihrer im Buch aufgestellten Thesen und Erkenntnisse entstanden aufgrund ihrer Forschungstätigkeit an der Harvard Universität, während ihres postdoktoralen Jahres und während ihrer Lehrtätigkeit an den Universitäten von Maryland (Baltimore County) und Lowell. Unterstützt wurde sie, in ihrer Forschung von der Special Research Fellowchip des National Institute of Mental Health. (H., S. 10)
Die geistigen Vorbilder der Autorin, auf deren Erkenntnisse und Lehre sie sich beruft und aufbaut, sind nach eigener Aussage u.a.: Erving Goffman, Roger Brown, Ray Birdwhistell und insbesondere Lynn O´Connor und Nicole Anthony. (H., S. 10-11)
Henley betont, dass ihr Buch keine Einführung in nonverbales Verhalten sein kann, keine „radikal-politische Analyse“ und letztlich auch keine „objektive“ Sozialwissenschaft bietet, denn „so etwas gibt es nicht“. (H., S. 8) Sie möchte die Körpersprache auch nicht unter den Aspekten der Sexualität betrachten, denn es geht ihr um die Bedeutung von Macht in nonverbalen Botschaften. (H., S.13) Sie steht zu der politischen Überzeugung, dass „unsere Sozialorganisation einer radikalen Umstrukturierung bedarf, damit jene zu ihrem Recht kommen, die deren Reichtum erarbeiten“ (H., S. 8) und bringt dies im Text auch zum Ausdruck. Deutlich ist ihr „Engagement für Frauenfragen“, wobei sie betont: „dass für Frauen zu sein und gegen Männerherrschaft nicht unbedingt heißt, dass man ein Männerfeind ist.“ (H., S.8-9) Schließlich bemerkt sie: „Dieses Buch richtet sich an Leser beiderlei Geschlechts und jeden Hintergrunds.“ (H., S. 9).
3. N. M. Henley’s Thesen und Erkenntnisse:
In dem zu besprechenden elften Kapitel (H., S. 258-293) bringt die Autorin ihre Erkenntnisse, Thesen und Schlussfolgerungen gebündelt zum Ausdruck. Zunächst möchte ich diese hier, in diesem Abschnitt kommentarlos abbilden. Aus Gründen des korrekten Bezuges, werde ich ihre Gliederung übernehmen, wenngleich hier beim Druck des Buches ein Fehler unterlaufen ist und der vierte Punkt ausgelassen wurde.
Henley kommt hier zu folgenden Aussagen:
1. „In unserem Alltag ist nonverbales Verhalten ein wichtiges Kommunikationsmedium“ (H., S. 258)
2. „Macht (Status, Dominanz) ist ein Hauptaspekt nonverbaler Kommunikation: Sowohl auf der großen Skala sozialer Herrschaft als auch auf der kleinen Skala interpersonaler Dominanz ist nonverbales Verhalten einer der Hauptkanäle des ‚Machtflusses’“. (H., S. 258)
3. „Weil unsere Kultur nonverbales Verhalten als bedeutungslos abtut (...), konstituiert es eine vage Stimulussituation. Die Interpretation solcher Situationen ist sehr anfällig für soziale Vorurteile (...), die dazu dienen, den Status quo aufrechtzuerhalten.“ (H., S. 258)
4. (fehlt)
5. „Nonverbale Machtbotschaften sind für Frauen von besonderer Bedeutung“ (H., S. 258)
Frauen: - reagieren empfindlicher auf solche Botschaften (Kontrollen)
- sind häufiger deren Objekte
6. „Viele nonverbale Verhaltensweisen haben eine Doppelsymbolik: Davon abhängig, ob sie von Partnern in einer asymmetrischen oder symmetrischen Beziehung benutzt werden, können sie entweder Dominanz oder Intimität ausdrücken.“ (H., S. 258-259)
7. „Die Verhaltensweisen, die Dominanz und Unterordnung zwischen Ungleichen ausdrücken, laufen parallel zu jenen, die in der ungleichen Beziehung zwischen den Geschlechtern von Männern und Frauen gezeigt werden.“ (H., S. 259)
8. „Der überwältigend größte Anteil an geschlechtsdifferenziertem Verhalten ist also erlernt: Es entwickelte sich, um ansonsten kaum wahrnehmbare Unterschiede hervorzuheben.“ (H., S. 264)
9. „Wie bereits (...) betont, sind viele nonverbale Verhaltensweisen, die bedeutungslos zu sein scheinen und vermeintlich nichts mit Macht zu tun haben, in Wirklichkeit Ausdruck von Geschlechtsprivilegien; oder sie reflektieren gesellschaftliche Vorurteile, die ihren Ursprung in Machtunterschieden haben.“ (H., S. 268)
10. „Macht ist die Fähigkeit, andere zu beeinflussen und zu beherrschen. Diese Fähigkeit gründet sich auf die Kontrolle begehrter Ressourcen. (Macht, Status und Dominanz sind nicht dasselbe, auch wenn sie miteinander verknüpft sind und oft verwechselt werden.) “ (H., S. 269)
11. „Das stärkste Machtfundament ist Gewalt. Die Ressourcen, auf deren Kontrolle Macht sich gründet, sind die begehrtesten, und jene, die sie kontrollieren, müssen sie vor den Ansprüchen anderer verteidigen. Gewaltanwendung lauert im hintersten Schützengraben der Verteidigungslinie, an der Front zeigt sie sich selten.“ (H., S. 269)
12. „Macht wird entlang eines Kontinuums ausgeübt, das mit den mildesten Formen von Kontrolle beginnt und mit offener Gewaltanwendung endet.“ (H., S. 269)
13. „Allgemein kann man sagen, dass jeweils die mildeste Sanktionsform, die für wirkungsvoll gehalten wird, zum Tragen kommt.“ (H., S. 271)
14. „Nonverbales Verhalten nimmt eine Schlüsselstellung in diesem Kontinuum ein – zwischen verdeckter und offener Gewalt (und zwischen verdeckter und offener Rebellion).“ (H., S. 272)
15. „Sexuelle Attraktion erklärt nicht hinreichend, warum Männer häufiger jene Gesten benutzen, die sowohl Intimität als auch Dominanz ausdrücken.“ (H., S. 278)
16. „ Wenn Frauen (und andere machtlose Menschen) sich nonverbale Machtsymbole zu eigen machen, dann wird dies von anderen –statt akzeptiert- zumeist ignoriert, verleugnet oder bestraft.“ (H., S. 278)
17. „Die Verleugnung nonverbaler Machtbotschaften, die von Frauen ausgehen, sieht oft so aus, dass diese Signale nicht als Dominanz-, sondern als sexueller Annäherungsversuch interpretiert werden.“ (H., S. 278)
18. „Sehr viele der weiblichen Verhaltensweisen, die auf innere Kontrollmechanismen zurückgeführt werden, muss man viel eher als das letzte Glied einer Kette realer Erfahrungen betrachten, in denen Selbstbehauptung versucht und dann - auf nonverbaler Ebene - unterdrückt wurde.“ (H., S. 283)
Im folgenden Abschnitt möchte ich diese Aussagen etwas näher beleuchten und auf einige Punkte auch ausführlicher eingehen.
4. Geschlecht, Macht und nonverbale Kommunikation
- Erläuterungen zu Henley’s Aussagen -
1. „In unserem Alltag ist nonverbales Verhalten ein wichtiges Kommunikationsmedium“ (H., S. 258)
2. „Macht (Status, Dominanz) ist ein Hauptaspekt nonverbaler Kommunikation: Sowohl auf der großen Skala sozialer Herrschaft als auch auf der kleinen Skala interpersonaler Dominanz ist nonverbales Verhalten einer der Hauptkanäle des ‚Machtflusses’“. (H., S. 258)
Nonverbales Verhalten ist ein wichtiges Kommunikationsmedium und hat eine wichtige Funktion im menschlichen Zusammenleben. Nach Henley hat Körpersprache die Funktion eines Maßstabes, an dem Worte und Absichten gemessen werden können. (H., S. 20)
Je nach Gestik oder Mimik können verbale Botschaften unterschiedlichste Bedeutungen bekommen. Henley verweist hier auf einen Test von Michael Argyle, in dem 120 Versuchspersonen achtzehn Videobänder auf den verbalen und nonverbalen Informationsgehalt einschätzen sollten. Die Wirkung der verbalen und nonverbalen Komponenten wurden hier unabhängig voneinander gemessen. Ein Ergebnis war hier u.a., dass der Wirkungsumfang der nonverbalen Variablen viel größer war als bei der verbalen Variable. (H., S.20-21)
Der Mensch verfügt über die Fähigkeit, nonverbales Verhalten unmittelbar und unbewusst richtig einzuordnen und zu deuten. Die Autorin verweist auf Edward Sapir, der 1927 feststellte, dass „wir mit einer außerordentlichen Wachsamkeit auf Gesten reagieren; es scheint fast so, als verfügten wir über einen hochentwickelten Geheimcode, der zwar nirgends geschrieben steht, den aber jeder kennt und versteht.“ (Sapir, E., 1927, S. 544).
Der Psychologe Robert Rosenthal konnte dies anhand eines weiteren Experimentes belegen und ein Empfänglichkeitsmaß gegenüber nonverbaler Botschaften entwickeln:
„In einem Film mit 200 Segmenten zeigt eine Schauspielerin verschiedene Emotionen in bestimmten Zusammenhängen. Die Versuchspersonen schätzten die porträtierten Szenen und Emotionen so genau ein, dass die Forscher die Dauer der Filmausschnitte immer weiter verkürzten, um zu sehen, an welchem Punkt die Genauigkeit abnahm. Aber selbst noch bei einer Ausschnittsdauer von einer vierundzwanzigstel Sekunde waren die Einschätzungen in über zwei Drittel der Fälle korrekt.“ (H., S. 21).
Nonverbale Kommunikation hat viele Ausdrucksformen. Sie artikuliert Dinge durch Körperhaltungen, Bewegungen, Gesichtsausdruck, Gesten, Berührungen, Augenkontakt, räumliches Verhalten, etc.. Henley geht davon aus, dass dies den meisten Lesern bereits bekannt ist und geht nicht näher darauf ein (H., S. 13). Des weiteren stellt sie fest, dass oft scheinbar selbstverständlich davon ausgegangen wird, „dass nonverbale Kommunikation vor allem mit folgendem zu tun hat: Nähe, Zuneigung und Abneigung, Intimität, Sexualität, Ausdrucksformen von Gefühlen oder Signalen, die geeignet sind, positive oder negative Haltungen zu übermitteln oder auch zu verdecken“ (H., S. 13). Laut Henley geht es bei der nonverbalen Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen aber auch um noch einen anderen Faktor. Es geht um Macht und somit auch um Status, Dominanz und Überlegenheit. Die Autorin spricht hier von zwei Dimensionen, die eine Beziehungen charakterisieren können:
1. horizontale Dimension: z.B. Freundschaftsbeziehungen. Hier geht es bei der nonverbalen Kommunikation (als räumliche Metapher ausgedrückt) u.a. um „sich nahe sein - sich fern sein“
2. vertikale Dimension: - Machtbeziehungen. Hier geht es in der nonverbalen Kommunikation (als räumliche Metapher ausgedrückt) um „die Oberen“, „die Unteren“, „Über jemanden stehen“ und „zu jemanden aufblicken“. (H., S. 14)
Henley stellt hier fest, dass dieser vertikalen Dimension von den Forschern nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde und möchte diese deshalb auch näher untersuchen.
Während alltägliche Gesten, wie: andere berühren, näher heran- oder weiter wegrücken, den Blick senken, lächeln, jemanden unterbrechen, meist als Hilfsmittel sozialer Kommunikation betrachtet werden, weist Henley auf die mikropolitische Bedeutung des nonverbalen Handelns hin. Laut Henley wird die politisch-ökonomischen Struktur, welche unser Leben bestimmt, durch die mikropolitische Struktur aufgebaut. Sie steht dieser gegenüber und sie ist mit ihr eng verwoben. Henley weist darauf hin, dass die mikropolitischen Gesten die Substanz der Alltagserfahrung sind und letztlich die Funktion haben, als ständige soziale Kontrolle zu dienen. Sie sollen den Status quo des Staates, der Reichen, der Autoritäten, all jener, deren Macht in Frage gestellt werden könnte, aufrecht erhalten. (vgl. H., S. 14) So wird beispielsweise Erniedrigung am schärfsten und am schmerzlichsten empfunden, „wenn man beim Sprechen ignoriert oder unterbrochen wird oder jemand durch seine körperliche Präsenz so dominiert, dass man unwillkürlich den Blick senkt, Kopf und Schultern hängen lässt.“ (H., S.14) Dies geschieht aber auch umgekehrt, bei denjenigen, „die die Macht haben, das Leben anderer zu manipulieren, Bestechungsgelder entgegenzunehmen, (...) oder die Bombardierung von Bauern am anderen Ende der Welt zu planen, (diese) vermitteln diese Macht zum Teil durch ihre Art, wie sie Aufmerksamkeit anderer erzwingen. Sie vermitteln sie durch ihre Art zu lächeln, durch ihre Angst vor Berührung und Nähe oder dadurch, wie sie sich an einen hängen, um eine Information zu ergattern oder um einen Gefallen zu bitten.“ (H., S. 14-15) Ebenso recht bildlich fasst Henley die Bedeutung nonverbaler Gesten auf Mikro- und Makroebene zusammen: „All diese kleinen Dinge bilden den Teig für jenen großen, mehrschichtigen Kuchen, den wir unsere Gesellschaft nennen.“ (H., S. 15)
[...]