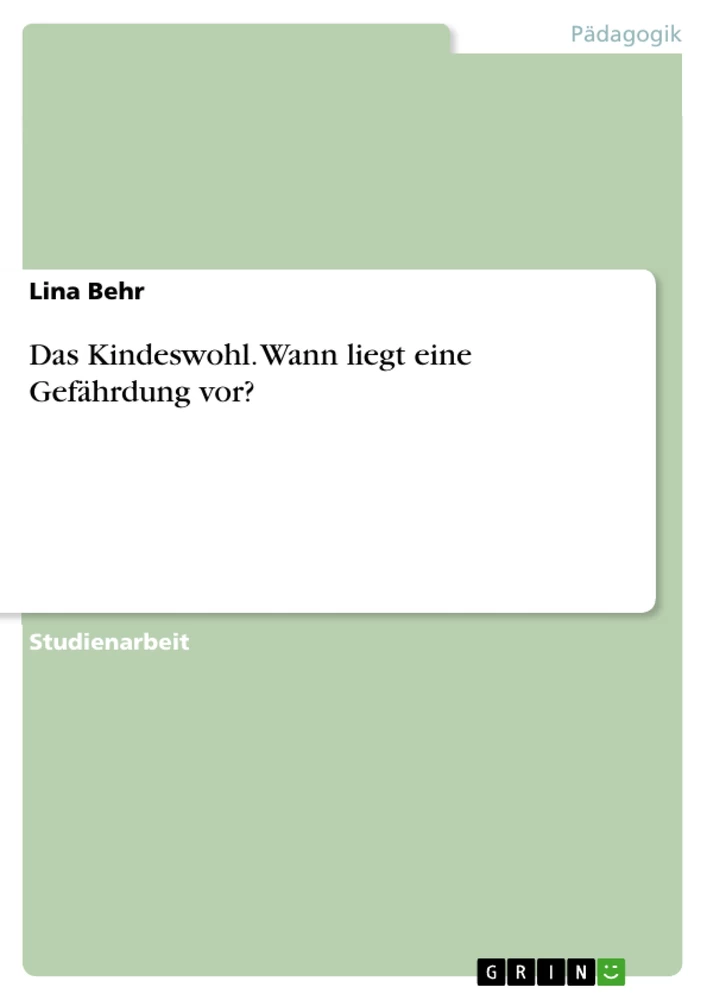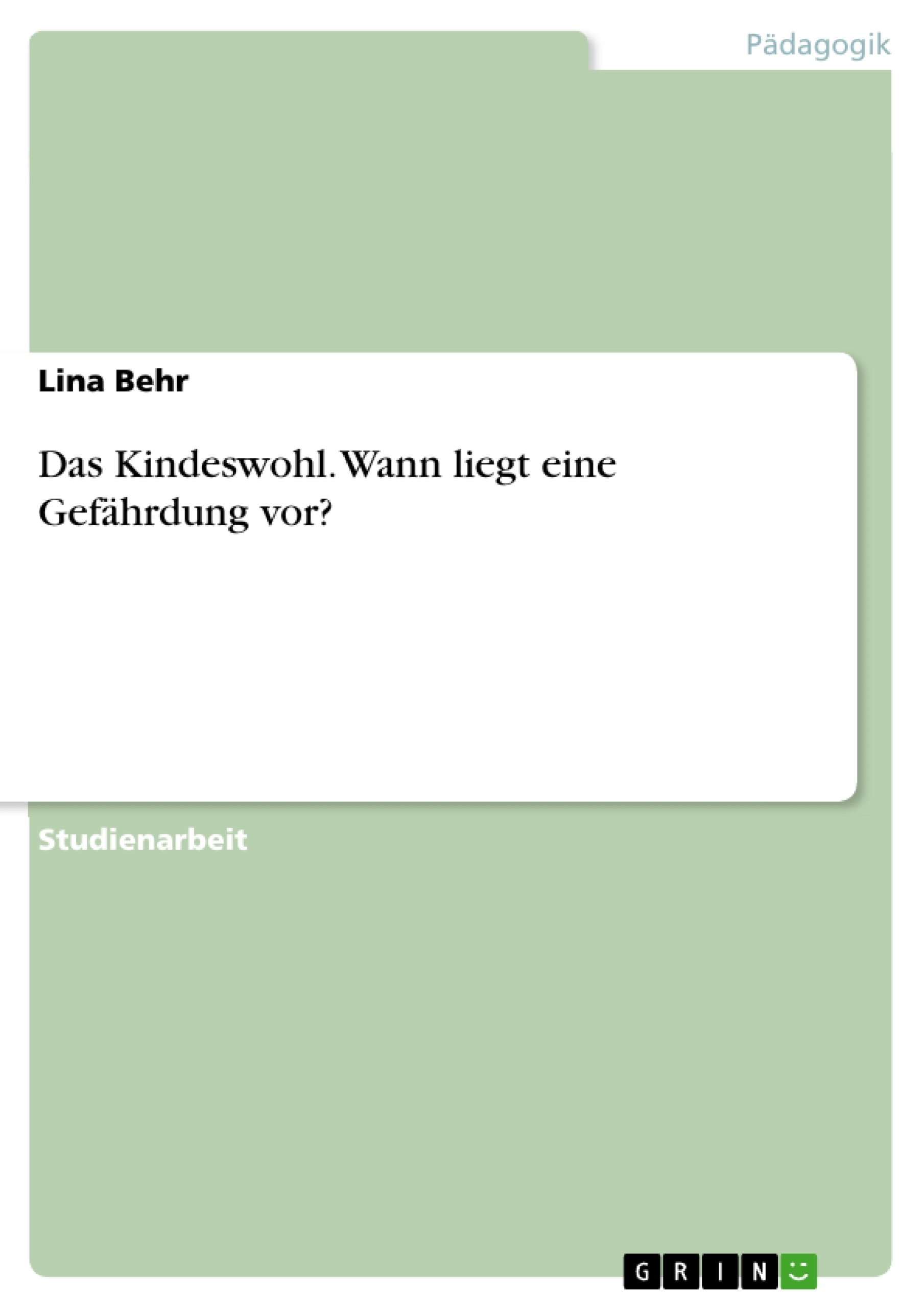20. Mai 2011 13.44 Uhr, B.Z. „Eigentlich sollte er nur einen Kühlschrank liefern. Doch was ein Speditionsmitarbeiter am Donnerstag in einer Wohnung in Lichtenberg vorfand, veranlasste ihn zum Anruf bei der Polizei. Und die Beamten kamen nicht umsonst. Die Vier-Zimmer- Wohnung machte einen verwahrlosten Eindruck: Verklebte und stark verschmutzte Fußböden, Wäscheberge überall. Die wenigen Lebensmittel, die gefunden wurden, waren verdorben und lagen teilweise auf dem Boden. (...) Die Kinder, ein Junge (7) und seine Schwestern (2 und 3) hatten kaum Spielzeug, das meiste davon war auch noch kaputt.“ (vgl. http://www.bz-berlin.de/bezirk/lichtenberg/kinder-aus-dreck-wohnung-geholt- article1187031.html)
Es sind Meldungen wie diese, die die Öffentlichkeit erschüttern. Die vermehrten Berichte über vernachlässigte und misshandelte Kinder wecken die öffentliche Aufmerksamkeit. Es ist ein Gemisch aus Abscheu und Unverständnis welches den Eltern von vernachlässigten Kindern entgegengebracht wird. Doch auch immer wieder rücken die Jugendhilfe selbst und insbesondere die Jugendämter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In den Medien wurde die Arbeit der Jugendämter meistens auf das Wächteramt reduziert. Als Wächtern des Kindeswohls werden ihnen aber gerade erhebliche Versäumnisse vorgeworfen. So werde stets zu spät eingegriffen oder auf Meldungen von besorgten Nachbarn überhaupt nicht reagiert. Doch wo liegen die Lücken im System? Wie kommt es dazu, dass eine Kindeswohlgefährdung zu Stande kommt, welche Möglichkeiten haben verschiedene Institutionen interventionistisch und/oder präventiv einzugreifen?
In diesem schriftlichen Referat soll zunächst der Begriff des Kindeswohls geklärt und Formen der Gefährdung aufgeführt werden. Weiterhin soll kritisch reflektiert werden wie eine Gefährdung des Kindeswohls zu erkennen ist und welche Möglichkeiten es für verschiedene Institutionen gibt helfend einzuschreiten.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Der Begriff des Kindeswohls
3. Formen der Kindeswohlgefährdung und ihre Auswirkungen
4. Erkennen einer Kindeswohlgefährdung
5. Möglichkeiten zur Hilfe und relevante Institutionen bei einer Kindeswohlgefährdung
6. Literaturverzeichnis