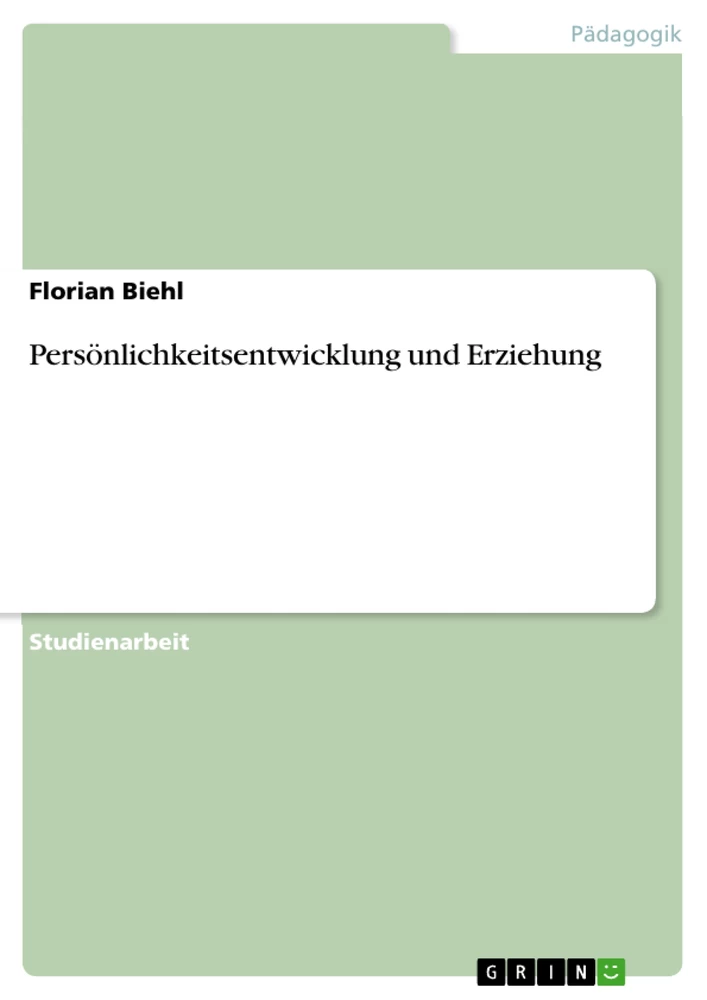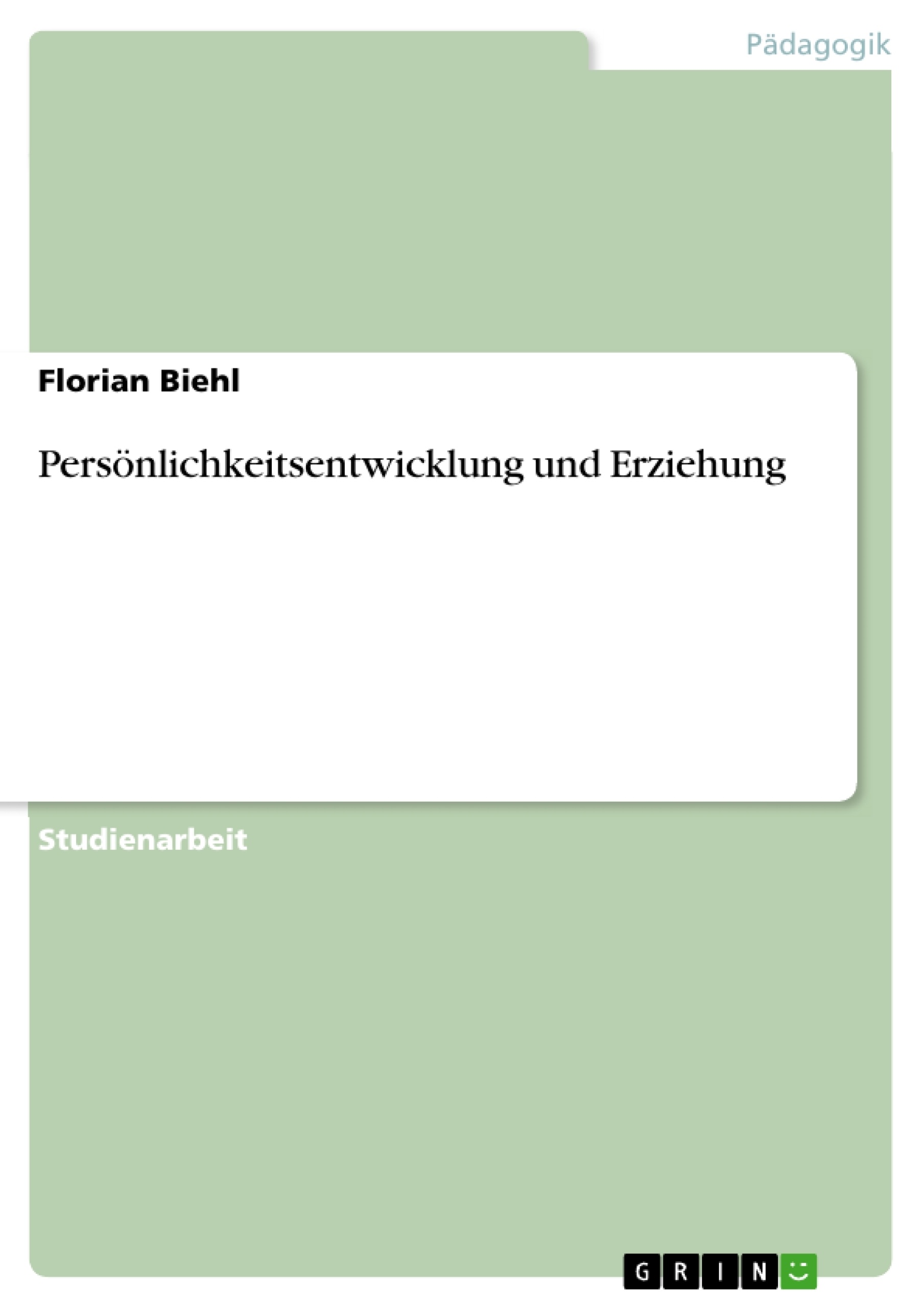Die Schulzeit ist für junge Menschen wohl eine der prägensten und nachhaltigsten Erfahrungen ihres bisherigen Lebens. Mit Grundschule und Abschluss am Gymnasium verbringen sie im Regelfall dreizehn Jahre im schulischen Umfeld und das auch noch zum Großteil in einer Lebensphase, die sowieso von großen Veränderungen geprägt ist: der Pubertät.
Welche Faktoren es nun genau sind, die einen jungen Menschen in der Entwicklung seiner Persönlichkeit beeinflussen, wie diese dabei in Wechselwirkung zueinander stehen und welche Konsequenzen das für den Lehrenden hat, soll im hier folgenden Text beschrieben werden.
Ausserdem wird noch unter dem Punkt „Schulklasseneffekte“ speziell der Einfluss von verschiedenen Schulklassenformen und deren Gestaltung auf das Verhalten von Schülern und Schülergruppen beschrieben sowie mit der Studie zur „Schulischen Selektion und Selbstkonzeptentwicklung“ ein praktisches Beispiel für verschiedene Schülerentwicklungen und deren Ursachen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist Persönlichkeit?
3. Was beeinflusst Persönlichkeitsentwicklung?
3.1. Eltern
3.2. Peers
3.3. Schule
4. Schulklasseneffekte
4.1. Klassengröße
4.2. Raumgestaltung
4.3. Sitzordnung
4.4. Geschlechterverteilung
5. Schulische Selektion und Selbstkonzeptentwicklung
5.1. Die Gruppen
5.2. Die Beobachtungsphasen
5.3. Ergebnisse
6. Zusammenfassung / Konsequenzen für Lehrende 14 Literaturverzeichnis