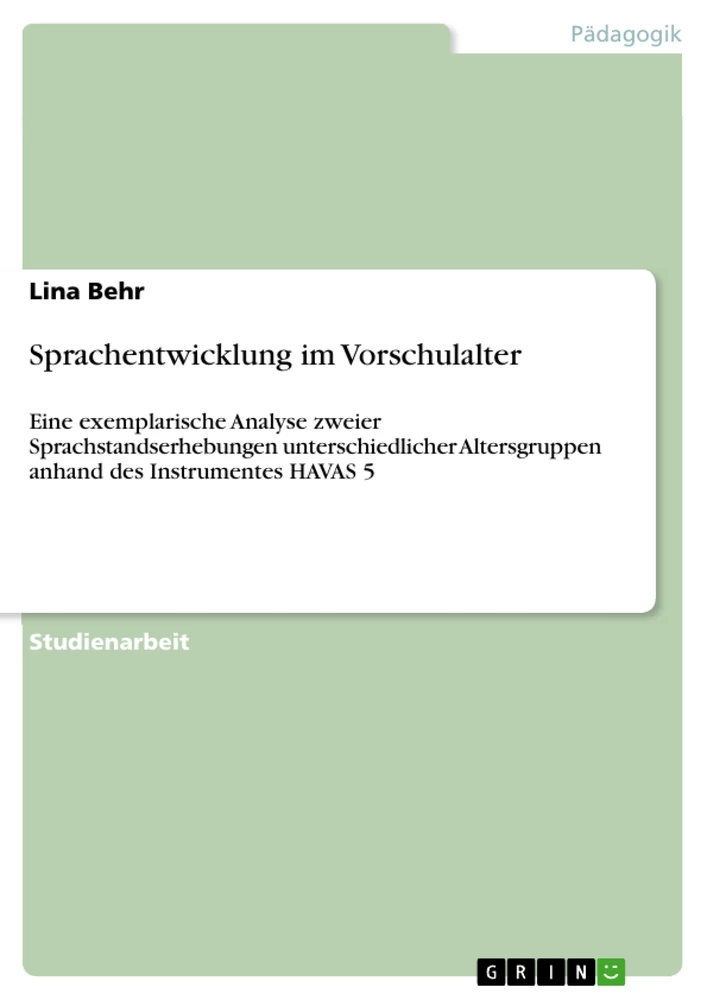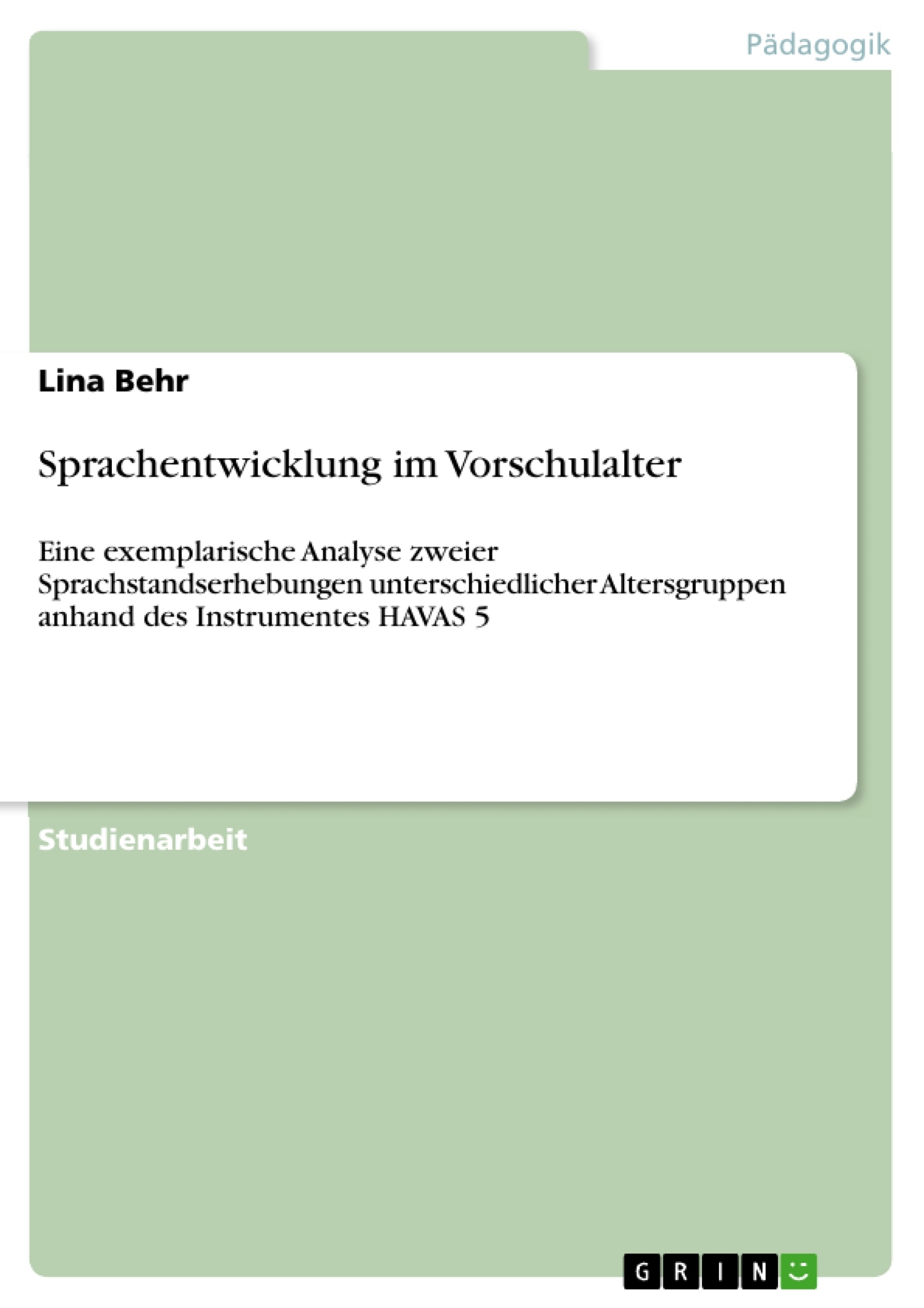Aus der Sicht eines Erwachsenen mag der kindliche Spracherwerb im Vorschulalter im Nachhinein als ein einfacher, sich quasi wie von selbst vollziehender Prozess erscheinen. Diese Sicht würde jedoch jene Tatsache verkennen, dass es sich beim kindlichen Spracherwerb um die komplexeste Aufgabe handelt, die ein Kind in seiner Entwicklung bewältigt (vgl. Dittmann 2010: 9).
Die Frage nach einer „normalen“, störungsfreien Sprachaneignung eines Kindes interessiert neben den Eltern auch diejenigen Institutionen und ihre Vertreter, die die Kinder in diesem Verlauf unterstützen. Die Verantwortung den Prozess der Sprachaneignung zu überwachen und bei Bedarf zu fördern, liegt letztlich in der Verantwortung des Staates (vgl. Ehlich, 2009: 16). Die Umsetzung dieser Verantwortung wird zunehmend in Form von institutionalisierten Verfahren umgesetzt, die den individuellen Sprachstand eines Kindes zum Zwecke des Vergleichens, sowie dem Fördern messen sollen. Diese Messungen werden zunehmend nicht nur für die Schulzeit, sondern auch für frühere Lebensalter heran gezogen (vgl. ebd.). „Die Befassung mit der kindlichen Sprachaneignung hat unterschiedliche Konjunkturen“ (ebd.: 17), gegenwärtig scheint das Interesse stetig anzusteigen, so dass gerade zu von einer Inflation unterschiedlicher Verfahren zur Sprachstandsmessung gesprochen werden kann (vgl. ebd.).
„Der Trend in den Bundesländern geht zur früheren Einschulung“ (11.09.2009, WELT ONLINE) berichtet WELT ONLINE. Die Idee der früheren Einschulung ist umstritten, da zahlreiche Fakten dagegen sprechen. Der PISA-2000-Bericht des Deutschen PISA-Konsortiums wird vielfach dahingehend interpretiert, dass Früheinschulungen vorteilhaft seien (siehe Baumert u. a. 2001, Tabelle 9.17, Seite 474).
Diese Interpretation ist jedoch fraglich. So beginnen Kinder im Pisa-Siegerland Finnland erst ab dem siebten Geburtstag ihre Schullaufbahn. Dennoch, die Tendenz zur früheren Einschulung scheint zu existieren und bedarf der Reaktionen entsprechender Institutionen. So plädiert mancher für eine Veränderung der Einschulungspraxis. „Wenn die Einschulungstests früher, also schon bei viereinhalb jährigen Kindern, gemacht würden, könnten im letzten Kindergartenjahr diejenigen gefördert werden, die spezifische Defizite in Verarbeitungskompetenzen haben (…)“sagt der Psychologe M. Hasselborn der WELT ONLINE (11.09.2009, WELT ONLINE).
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Sprachentwicklung beim Kind
2.1.1 Vorrausetzungen
2.1.2 Basisqualifikationen
2.1.3 Entwicklungsschritte
2.2 Sprachstand und Sprachaneignung
2.3 Normalitätserwartungen und Normalität
3. HAVAS
Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands bei Fünfjährigen
3.1 Entstehung
3.2.1 Konzeption
3.2.1 Die Indikatoren
3.2 Erhebung und Auswertung
3.2.1 Erhebung
3.2.2 Auswertung
3.3 Kritik an HAVAS
4 Die Sprachprobenerhebung
4.2 Sampling
4.3 Exemplarische Auswertung und Analysen
4.3.1 Aufgabenbewältigung
4.3.2 Bewältigung der Gesprächssituation
4.3.3 (Verbaler) Wortschatz
4.3.4 Formen und Stellungen des Verbs
4.3.5 Verbindung von Sätzen
4.4 Ergebnisse
4.5 Kritische Reflexion
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang:
Sprachprobe 1
Sprachprobe 2