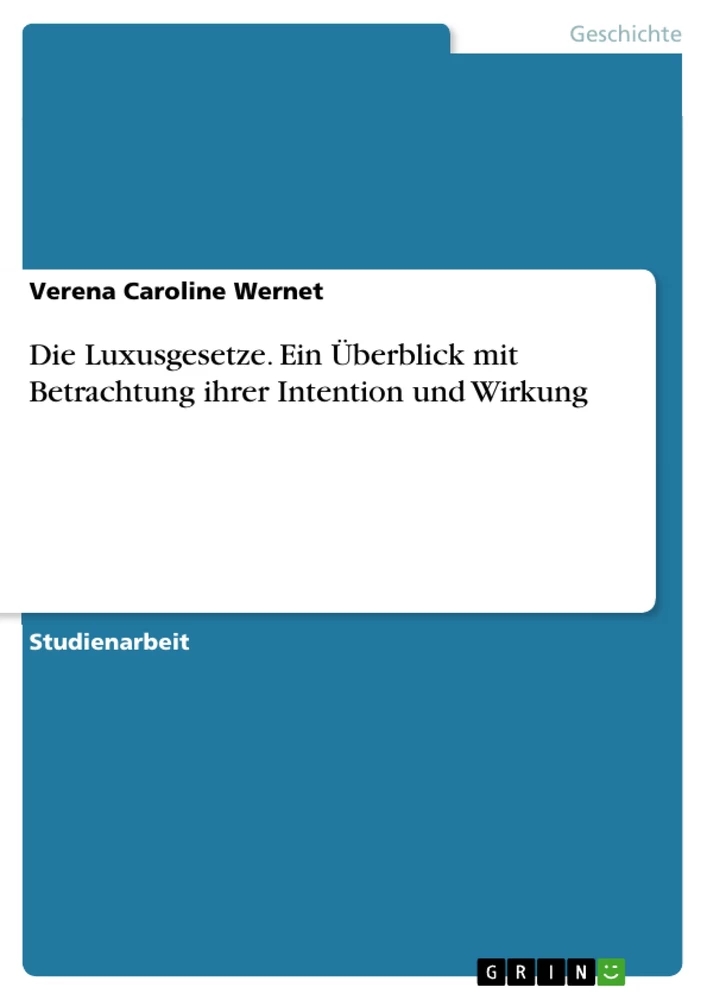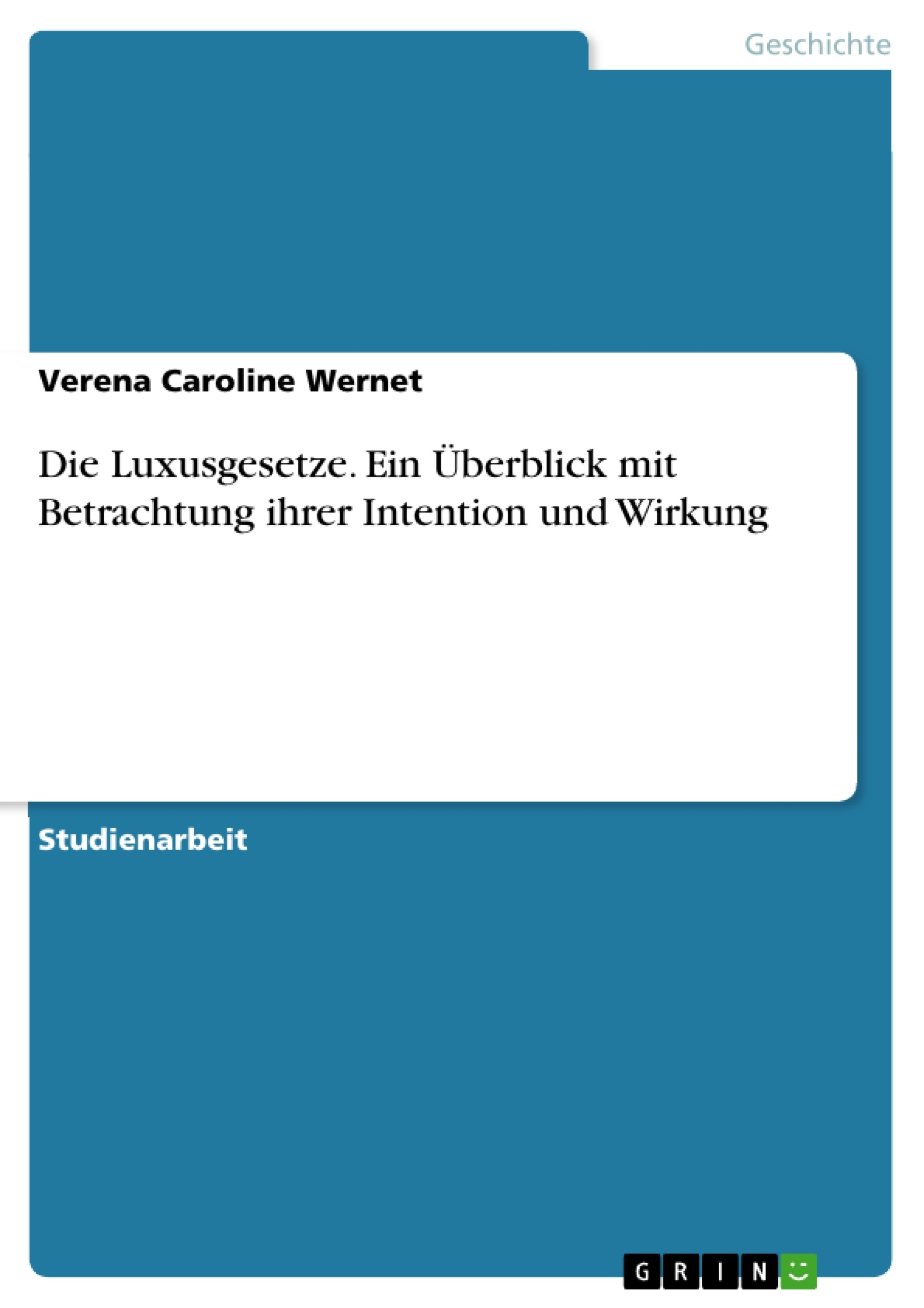Eine Hausarbeit, welche erläutert, was sich hinter dem Terminus "Luxusgesetze" in Bezug auf das antike Rom verbrigt und aufzeigt, in welchen Bereichen es Luxusgesetze gab. Zudem wird auf die hinter den Gesetzen stehende Intention eingegangen ud analysiert, inwieweit diese ihre Funktion erfüllten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsklärungen
2.1 Der Begriff lex in Abgrenzung zu dem mos maiorum
2.2 Die römische Nobilität und ihr Selbstverständnis
2.3 Der Tatbestand des ambitus
2.4 Die lex Villia Annalis
3. Die leges sumptuariae im Überblick
3.1 Der Grabluxus
3.2 Der Kleider- und Schmuckluxus
3.3 Die Schenkungsgesetze
3.4 Die Erbrechtsgesetze
3.5 Der Tafelluxus
3.6 Das Würfelspiel
3.7 Der Bauluxus
3.8 Der Luxus bei Spielveranstaltungen
4. Das Für und Wider der Luxusgesetze
4.1 Phasen der Luxusgesetzgebung
4.2 Deutungen der Luxusgesetze
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis