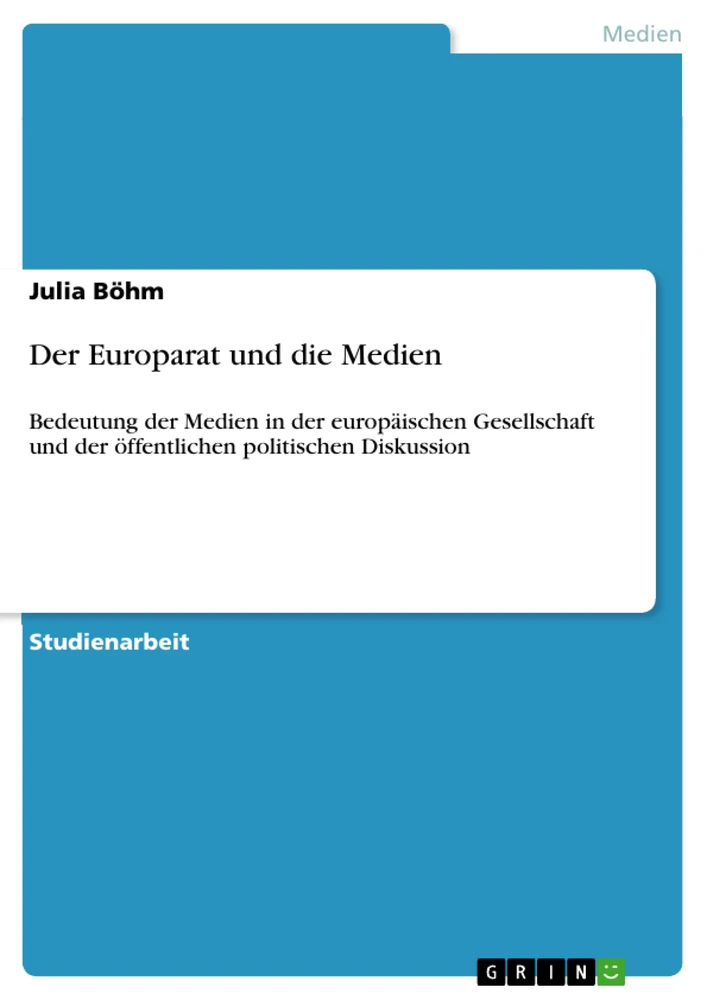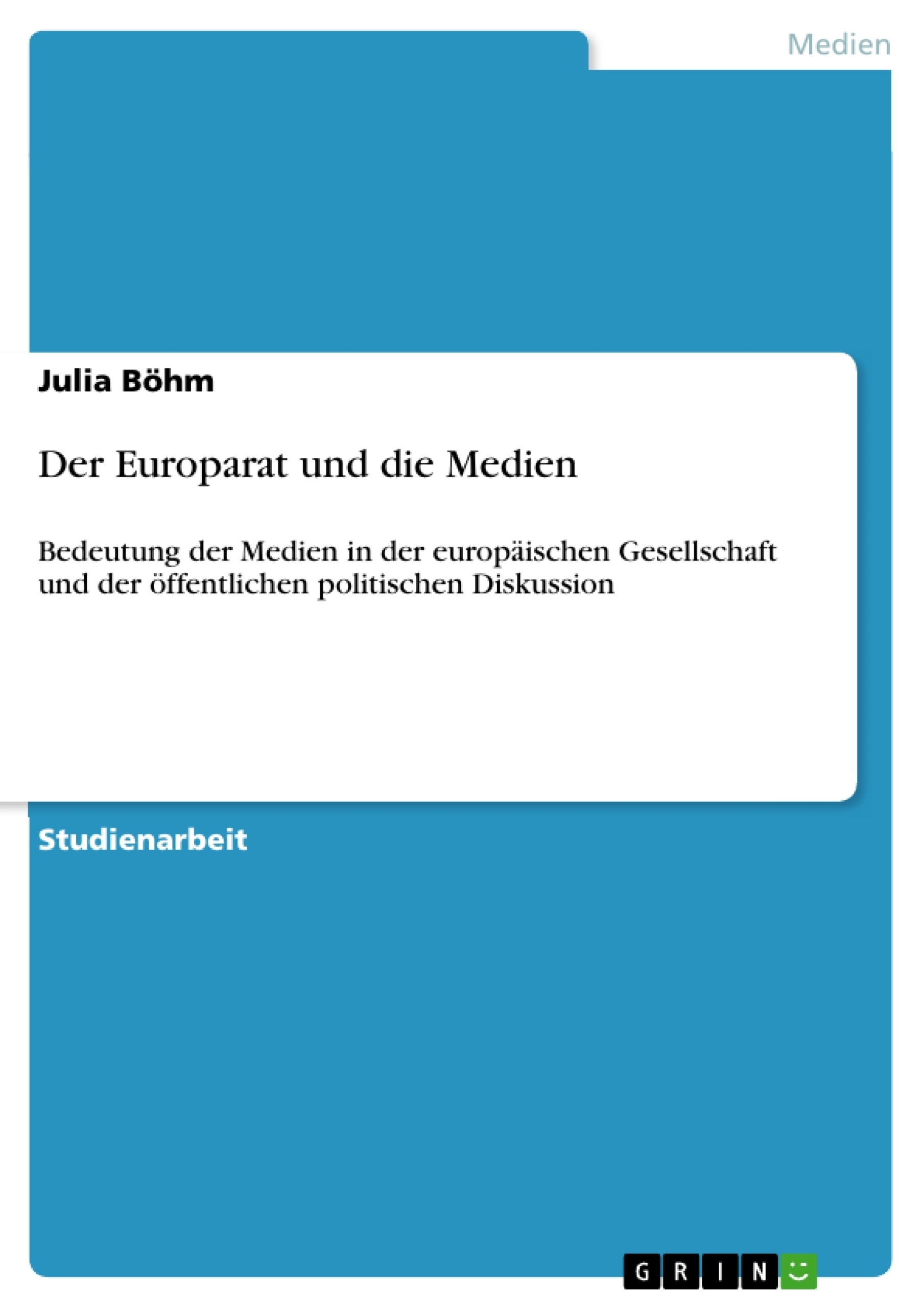Der Begriff Medien dient uns umgangssprachlich als Sammelbegriff für alles, was uns informiert, unterhält, infotaint oder edutaint. Das Ganze funktioniert über ein Medium, wie zum Beispiel Radio, Fernseher oder Zeitung. In den letzten Jahrzehnten sind immer neue Begriffe im Bereich der Medien entstanden, als erstes die Massenmedien, dann die Neuen Medien und Telekommunikationsmedien. Vor den neuen Begriffen gab es technische und politische Entwicklungen und jetzt wo es die neuen Bezeichnungen gibt, ist es also auch möglich, auf dem Handy E-Mails zu empfangen, polnisches Radio zu hören oder englischsprachige Fernsehprogramme zu schauen. Mit den Begriffen ändern sich auch die Bedingungen oder besser durch Entwicklungen in bestimmten Bereichen verlieren alte Begriffe ihre Bedeutung und Reglungen ihre Bestimmungen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den medienpolitischen Aktivitäten des Europarates. Diese internationale politische Organisation setzt sich mit den wandelnden technischen und politischen Gegebenheiten innerhalb des Mediensektors auseinander. Die Betrachtung widmet sich speziell der Rolle der freien Medien in einer demokratischen Gesellschaft. Im zweiten Kapitel der Arbeit wende ich mich zunächst der grenzüberschreitenden Dimension der Medien zu. Ich verdeutliche anhand technischer Entwicklungen der Medien die daraus resultierenden Schwierigkeiten für medienpolitisches Handeln in Europa. Auf Grund der grenzüberschreitenden Reglungsbedürftigkeit für Medien haben sich europäische Organisationen der medienpolitischen Arbeit gewidmet. Der Europarat......
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Medienpolitik von der nationalen in die internationale Dimension
2.1 Die grenzüberschreitdene Dimension der Medien
2.2 Medienpolitik als europäische Herausforderung
2.3 Medienpolitik für Europa
3 Der Europarat und die Medien
3.1 Der Europarat – Eine supranationale Organisation
3.1.1 Aufbau und Organe des Europarates
3.1.2 Die Arbeitsweise des Europartes
3.2 Die Akteure der Medienpolitik
3.3 Die Europäische Menschenrechtskonvention
4 Public Watchdog – Medien im Dienst öffnetlicher politischer Diskussion
4.1 Gesellschaftliche Bedeutung von Medien und Kommunikation
4.2 Die Rolle der Medien in der Demokratie
4.2.1 Medienpolitische Anfänge – von 1960 bis
4.2.2 Die neunziger Jahre – Neue Mitglieder
4.2.3 Das 21. Jahrhundert
5 Fazit
Literaturverzeichnis
Selbstständigkeitserklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Der Begriff Medien dient uns umgangssprachlich als Sammelbegriff für alles, was uns informiert, unterhält, infotaint oder edutaint. Das Ganze funktioniert über ein Medium, wie zum Beispiel Radio, Fernseher oder Zeitung. In den letzten Jahrzehnten sind immer neue Begriffe im Bereich der Medien entstanden, als erstes die Massenmedien, dann die Neuen Medien und Telekommunikationsmedien. Vor den neuen Begriffen gab es technische und politische Entwicklungen und jetzt wo es die neuen Bezeichnungen gibt, ist es also auch möglich, auf dem Handy E-Mails zu empfangen, polnisches Radio zu hören oder englischsprachige Fernsehprogramme zu schauen. Mit den Begriffen ändern sich auch die Bedingungen oder besser durch Entwicklungen in bestimmten Bereichen verlieren alte Begriffe ihre Bedeutung und Reglungen ihre Bestimmungen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den medienpolitischen Aktivitäten des Europarates. Diese internationale politische Organisation setzt sich mit den wandelnden technischen und politischen Gegebenheiten innerhalb des Mediensektors auseinander. Die Betrachtung widmet sich speziell der Rolle der freien Medien in einer demokratischen Gesellschaft. Im zweiten Kapitel der Arbeit wende ich mich zunächst der grenzüberschreitenden Dimension der Medien zu. Ich verdeutliche anhand technischer Entwicklungen der Medien die daraus resultierenden Schwierigkeiten für medienpolitisches Handeln in Europa. Auf Grund der grenzüberschreitenden Reglungsbedürftigkeit für Medien haben sich europäische Organisationen der medienpolitischen Arbeit gewidmet. Der Europarat, dessen Aktivitäten im Mediensektor Zentrum dieser Arbeit sind, beschäftigt sich seit den sechziger Jahren mit internationalen Reglungen im Medienbereich. Im dritten Kapitel meiner Arbeit stelle ich den Europarat als supranationale Organisation vor und lege seinen Aufbau und seine Arbeitsweisen kurz dar. Weiterhin betrachte ich die Akteure der Medienpolitik innerhalb des Europarates und wende mich der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) zu, welche enorme Bedeutung für die Medienpolitik des Europarates hat. Der Hauptanteil der Arbeit spiegelt sich im vierten Kapitel wieder. In diesem betrachte ich die Rolle der Medien in der Demokratie und zeige die gesellschaftliche Bedeutung von Medien auf. Dabei liegt das Interesse auf internationalen medienpolitischen Aktivitäten des Europarates. Ich stelle die Rolle der Medien, die der Europarat ihnen zuerkennt, anhand von ausgewählten Empfehlungen und Berichten dar. Dabei gehe ich besonders auf die Problematik der mittel- und osteuropäischen Staaten ein.
Abschließend fasse ich Thesen zur medienpolitischen Arbeit des Europarates und der Rolle, die er den Medien zuerkennt, zusammen. Auf dieser Grundlage diskutiere ich kurz die Bedeutung der europäischen Medienpolitik des Europarates.
Auf Grund der Schwerpunktsetzung und des Umfangs der Arbeit betrachte ich einzelne Konventionen nicht mehr, die ich bereits zum Schwerpunkt meines Referates gemacht hatte.
2. Medienpolitik von der nationalen in die internationale Dimension
Die stetig wachsenden grenzüberschreitenden Dimensionen von Medien bedürfen Regelungen über einzelne Staatsgrenzen hinaus. Denn ebenso wenig wie elektromagnetische Wellen vor Ländergrenzen Halt machen, verfallen die Gründe für medienpolitische Reglungen mit der Überwindung staatlicher Grenzen. Medienpolitik ist nicht ausschließlich eine nationale Angelegenheit, sondern wird in Zeiten der technischen Konvergenz und der Digitalisierung auch in internationalen Dimensionen immer bedeutender.
2.1 Die technischen Möglichkeiten der Medien und Ihre Reglungsbedürftigkeit
Das ASTRA-Satellitensystem erreicht momentan 400 Millionen Menschen. Mit 13 ASTRA-Satelliten und zwei SIRIUS-Satelliten in verschieden Orbitalpositionen erreicht das System Haushalte in ganz Europa und versorgt die Menschen mit über 350 Fernsehprogrammen und mehr als 200 Radioprogrammen.[1] Die stetige Weiterentwicklung der Satellitentechnik und die daraus resultierenden Möglichkeiten, unterstreichen die bereits im Jahr 1960 vom Bundesverfassungsgericht (BVerG) getroffene Aussage: „Funkwellen halten sich nicht an Ländergrenzen“.[2] Eine globale Dimension erhält dieser Umstand durch die Entwicklung der Satellitentechnik. Die Erreichbarkeit von 400 Millionen Menschen innerhalb Europas mittels sogenannter Power-Satelliten, ist jedoch nur ein Beispiel für die enormen technischen Möglichkeiten innerhalb der Medienlandschaft.
Mit dem Phänomen der Konvergenz der Medien, unter welchem die fortschreitende Annäherung von Einzelmedien und das Zusammenwachsen von Informations- und Kommunikationstechnologien verstanden werden,[3] verschwimmen „die Grenzen zwischen verschiedenen Medien- und Kommunikationsformen“.[4] Die Digitalisierung schafft die Voraussetzung, um etwaigen Inhalt über jeden möglichen Kanal zu verbreiten: Fernsehen auf dem Laptop sehen oder E-Mails über das Handy verschicken. Eine Unterscheidung zwischen Rundfunk, Telekommunikation und Computern aufgrund unterschiedlicher Distributionstechnologien ist wegen fortschreitender Digitalisierung kaum noch möglich.[5] Neben der technischen Konvergenz kommt es auch zur Konvergenz von Medieninhalten, Mediensystemen und Mediennutzung. Durch technologische Veränderungen und Erweiterungen können Inhalte auf verschiedenen Wegen transportiert werden, Unternehmen ihre Inhalte weitreichender plazieren und Rezipienten Medien vielseitiger nutzen.
Doch mit den Möglichkeiten kommen auch die Herausforderungen. Ermöglicht ein Power-Satellitensystem die Übertragung von Rundfunk in 20 oder 30 verschiedene Länder, ist das nicht nur ein Gewinn für die länderübergreifende Massenkommunikation, sondern eine schwierige Aufgabe für die internationale Medienpolitik.
2.2 Medienpolitik als europäische Herausforderung
Die grenzüberschreitende Dimension von Medien hat eine Medienpolitik für Europa zur Herausforderung werden lassen.[6] Medien und insbesondere Massenmedien erfüllen Funktionen, die von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft sind und bedürfen daher Reglungen, die sie ermöglichen und schützen. Mit der Überschreitung von Staatsgrenzen werden auch länderübergreifende Reglungen notwendig.
Auf Grund der hohen Bedeutung, die den Medien angedacht wird, erhalten sie besondere Gewährleistung durch rechtliche Regelungen. „[Jenes] Handeln, das auf die Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regeln und Entscheidungen über Medien-Organisationen und die massenmediale öffentliche Kommunikation abzielt“[7] nennt man Medienpolitik. In den letzten Jahrzehnten hat das Politikfeld einen hohen Stellenwert erreicht, denn „ohne freie Medien ist keine ungehinderte Meinungsbildung des Bürgers und damit keine Demokratie möglich“.[8] Medien generieren Information, Kommunikation, Meinungs- und Willensbildung und sind für einen demokratischen Staat von hoher Wichtigkeit.
2.3 Medienpolitik für Europa
Eine internationale Dimension der Medien gibt es, bis auf den physischen Transport von Zeitschriften und Zeitungen der schon früher möglich war, erst seit dem 19. Jahrhundert. Mit Entdeckung elektromagnetischer Wellen und der Entwicklung der Telegrafie wurde internationale Kommunikation vorstellbar und damit internationale Kommunikationspolitik nötig.[9] Jedoch blieb die Verbreitung von Massenmedien bis in die Hälfte des 20. Jahrhunderts auf nationale Wege beschränkt. Denn erst die neuen Technologien der Satellitenübertragung und die staatenübergreifende Vernetzung (zunächst über schmalbandige Telefonkabel) machten internationale Kommunikation im heutigen Verständnis möglich.[10] Im Rahmen der Entwicklungen und Veränderungen im Medienbereich spricht Jan Tonnemacher von drei Determinanten von Medienentwicklung: Politik, Technik und Ökonomie.[11] Alle drei bedingen einander, d.h. auf jeweilige Änderungen in dem einen Feld reagieren die anderen beiden Determinanten. Auf die Entwicklung der Telegrafie reagierte beispielsweise die Politik, indem sie das Fernmeldewesen einer staatlichen Kontrolle unterstellte. Frühe Anzeichen einer internationalen Medienpolitik zeigten sich in vereinzelten Reglungen, zum Beispiel in der Frequenzvergabe.[12] Für eine wirklich praktizierte staatenübergreifende Medienpolitik fehlten in Europa jedoch internationale Organisationen mit bestimmten Zuständigkeiten. Als sich nach dem zweiten Weltkrieg die beiden überstaatlichen Organisationen, die Europäische Union (EU) und der Europarat (Council of Europe, CoE), konstituierten, gab es bald auch Schritte zu Reglung internationaler medienpolitischer Angelegenheiten. Aber auch hier ist die Verbindung der drei genannten Determinanten zu beachten. Die Entwicklung einer europäischen Medienpolitik war und ist von politischen, ökonomischen und technischen Prozessen gezeichnet. Seit Anfang der sechziger Jahre vom Europarat und seit Anfang der achtziger Jahre[13] von der Europäischen Gemeinschaft (EG) ausgehend, gibt es europäische medienpolitische Aktivitäten. Auch die 1992 gegründete Europäische Union[14] betätigt sich im medienpolitischen Feld Europas. Obwohl die Meinungen in der Literatur auseinander gehen, ob im Rahmen der EU-Aktivitäten von Medienpolitik zu sprechen ist. So wird in einschlägigen Werken wie dem Europa-Handbuch von Werner Weidenfeld oder in Einführung in Geschichte, Institutionen und Prozesse der Europäischen Union von Frank R. Pfetsch Medienpolitik nicht als Betätigungsfeld der EU aufgeführt.[15] Seit 2004 besteht innerhalb der Europäischen Kommission eine Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien. Diese Entwicklung weist auf das Bedürfnis der EU hin, sich dem Arbeitsfeld Medienpolitik anzunehmen. Ungeachtet dessen sagt der Vertrag über die Arbeitsweisen der Europäischen Union (AEU-Vertrag) eindeutig aus, dass die Mitgliedsstaaten ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik nach Maßgaben regeln, welche die EU festlegen.[16] Die EU ist jedoch für Wirtschaftspolitik zuständig und richtet seine Aufgaben auf die Verwirklichung eines gemeinsamen Binnenmarktes aus. Die Union kann sich nur dann mit den Medien befassen, wenn die Rechtfertigung aus diesem Ziel und der damit „verbundenen Durchsetzung der vier Grundfreiheiten (freier Verkehr von waren und Dienstleistungen, von Personen und von Kapital)“[17] geschieht. Die EU legt die Medien aufgrund dieser satzungsmäßigen Bestimmungen als Dienstleistung bzw. als Wirtschaftsgüter aus. Nur so kann die EU als primäres Wirtschaftsbündnis medienpolitisch aktiv werden. Der Europarat kann eine Kompetenz für medienpolitische Arbeit direkt aus seiner Satzung ableiten, in der unter anderem die Beschäftigung mit den Medien festgelegt ist. Weiterhin stützt der Europarat seine medienpolitischen Aktivitäten auf Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Der Artikel garantiert die Meinungsäußerungs-freiheit und ist damit Grundlage etwaiger Begründungen des Europarates zu Übereinkommen, Empfehlungen oder Konventionen welche die Medien betreffen. Ein Pendant zu Art. 10 EMRK gibt es bei der Europäischen Union nicht. Obwohl beachtet werden muss, dass alle Mitgliedsstaaten der EU, Mitglieder im Europarat sind und diese die EMRK anerkannt haben. Ein Beitritt der EU zur EMRK war bis 2010 nicht möglich, da die EMRK die Mitgliedschaft von Organisationen nicht vor sah. Mit dem 14. Zusatzprotokoll zur EMRK wird dieses nun ermöglicht.[18] Nach Inkrafttreten des Zusatzprotokolls haben die beiden Organisationen begonnen, über den Beitritt der EU zur EMRK zu verhandeln. Die spezielle Bedeutung der EMRK sowie die medienpolitischen Arbeitsweisen des Europarates werden im Verlauf dieser Arbeit noch ausführlicher behandelt.
[...]
[1] Vgl. Astra-Satellitensystem.
[2] 1. Rundfunk-Urteil 1961.
[3] Vgl. Puppis 2010, S. 66.
[4] Ebd. S. 65.
[5] Vgl. Puppis 2010, S. 65.
[6] Dörr 2007.
[7] Puppis 2010, S.35.
[8] Kleinsteuber 1996, S.33.
[9] Vgl. Tonnemacher 2003, S.267.
[10] Vgl. Ebd.
[11] Vgl. Ebd. S. 268.
[12] Vgl. Ebd.
[13] Vgl. Holtz-Bacha 2006, S. 303.
[14] Anm. In Maastricht wurde am 07. Februar 1992 der Vertrag über die Europäische Union geschlossen. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gründeten damit die EU, die nun auch Zuständigkeiten in nicht wirtschaftlichen Politikbereichen besaß.
[15] Vgl. Holtz-Bacha 2006, S. 311.
[16] Vgl. AEU-Vertrag Art.2.
[17] Vgl. Holtz-Bacha 2011, S. 15.
[18] Vgl. Ebd. S. 50.