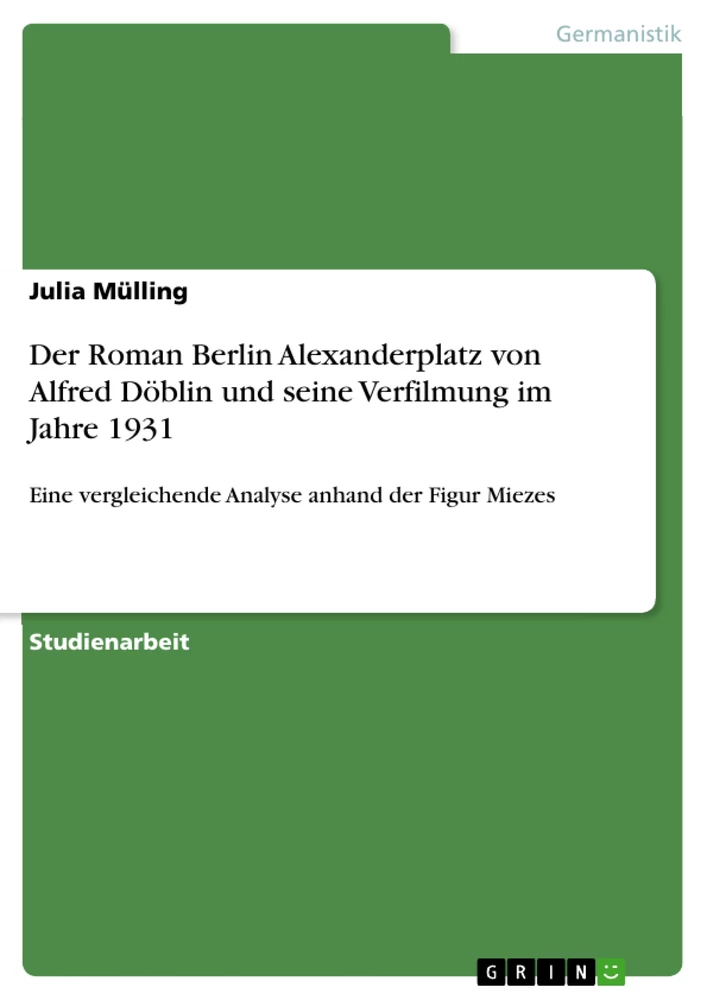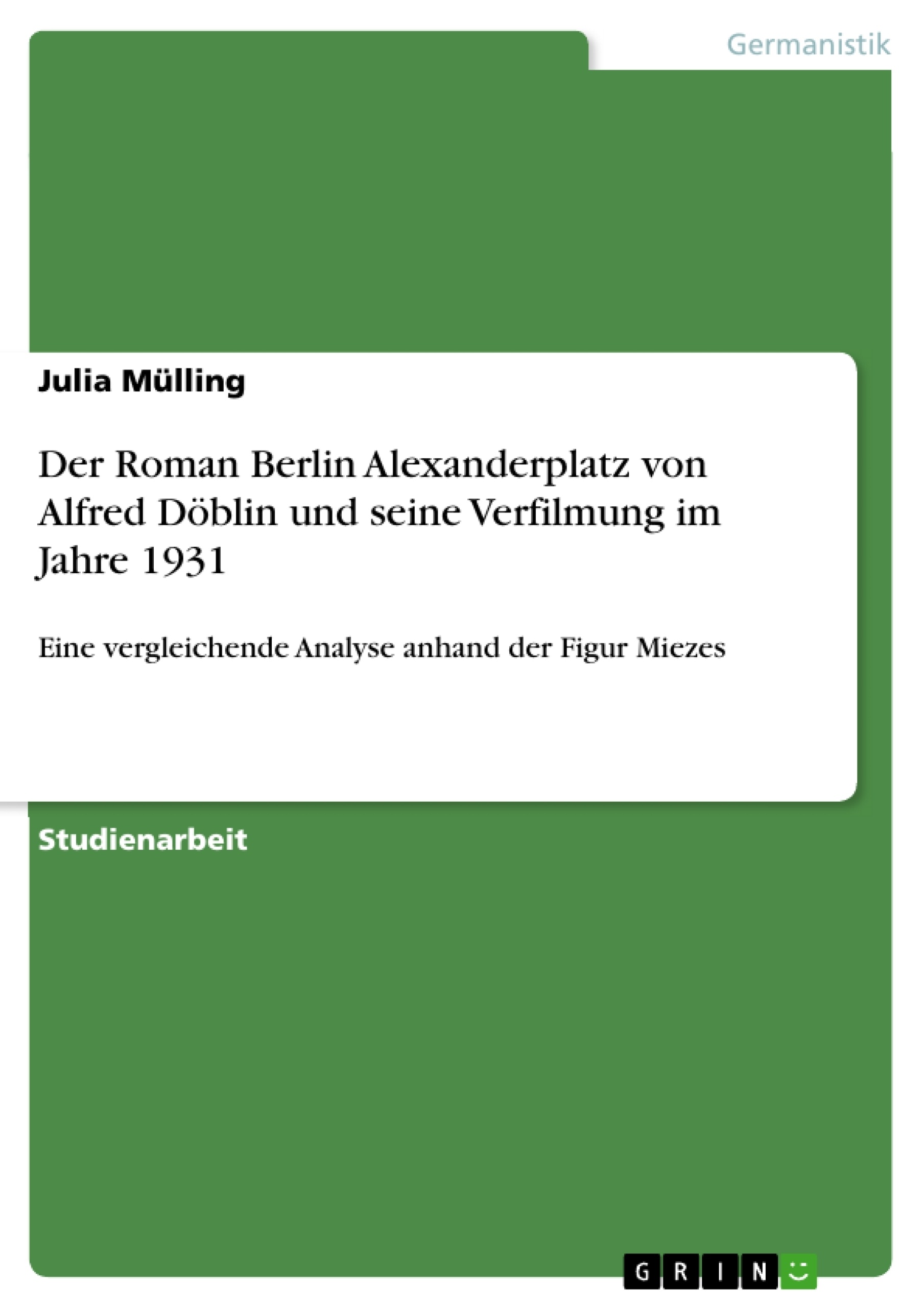Literaturverfilmungen rufen bereits seit der frühen Zeit des Films stets heftige Reaktionen, Kritik und Skepsis hervor. Literatursprache und Bildsprache werden in ihren Wirkungen gegeneinander abgewogen und die Übersetzbarkeit literarischer Werke im Film wird bestritten oder befürwortet. Alfred Döblins Haltung gegenüber der neuen Erscheinung des Kinos war durchaus zwiespältig, doch reizte ihn die Möglichkeit, über das neue Medium die breite Volksmasse zu erreichen. Sein 1929 verfasster Roman Berlin Alexanderplatz drängte sich daher mit seiner „filmischen Schreibweise“ geradezu auf, Vorlage für eine, im Stile des im Jahre 1927 entstandenen Films Sinfonie der Großstadt gehaltene, Literaturverfilmung zu werden. Doch die drastische Vereinfachung und die Transformation des Romans in die konventionelle Form des Films veranlassten zeitgenössische Kritiker bei Erscheinung des Films Berlin Alexanderplatz von Phil Jutzi im Jahre 1931 zu teils heftigen Bemängelungen und genereller Ablehnung.
Angesichts dieser Problematik stellen sich demnach die Fragen, welche Elemente der Transformation diese Simplifikation bedingen und welche Folgen diese für die Handlung der Geschichte nach sich ziehen. Die vorliegende Arbeit soll sich daher mit der Darstellung Miezes und ihrer Beziehungen zu Franz Biberkopf und Reinhold in dem Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin und seiner filmischen Adaption von Phil Jutzi beschäftigen. So soll exemplarisch für die durch die Verfilmung entstandenen Veränderungen anhand einer vergleichenden Analyse ermittelt werden, inwiefern die Figur in der filmischen Adaption von der literarischen Darstellung abweicht und wie sich dies auf das Geschehen und den Inhalt auswirkt.
Dem Erkenntnisinteresse gemäß ist die Arbeit in drei Hauptkapitel gegliedert. Nach einer Darstellung der Haltung Alfred Döblins gegenüber den Massenmedien Hörspiel und Film, soll genauer auf den Roman Berlin Alexanderplatz mit seiner Montagetechnik und der filmischen Realisierung des Stoffes eingegangen werden. Exemplarisch an einer Analyse der Darstellung Miezes sollen in einem weiteren Schritt diese Veränderungen nachvollzogen werden. Schließlich werden in einem Fazit die Ergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Alfred Döblin und die Massenmedien Hörspiel und Film
2.1. Von der filmischen Schreibweise zu der Verwandlung des Textes und Phil Jutzis Literaturverfilmung Berlin Alexanderplatz
4.1 Liebe und Verlangen - Die Ambivalenz in der Figur der Mieze in dem Roman Berlin Alexanderplatz
4.2 Die idealisierte Gestalt Miezes - Eine „Niveausenkung“ in dem Film Berlin Alexanderplatz?
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis