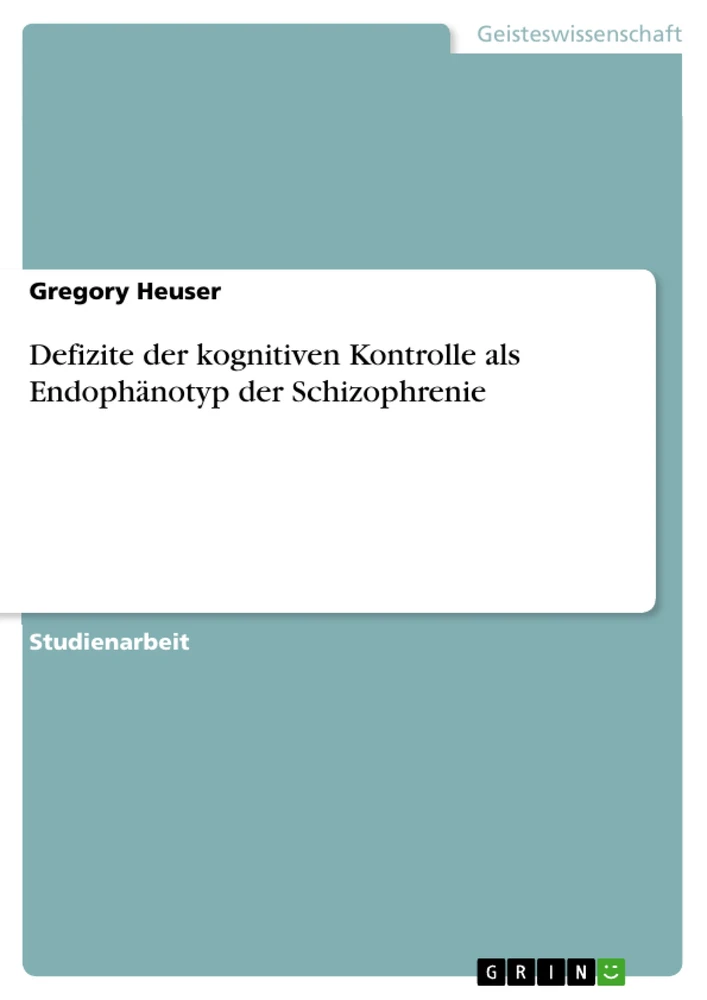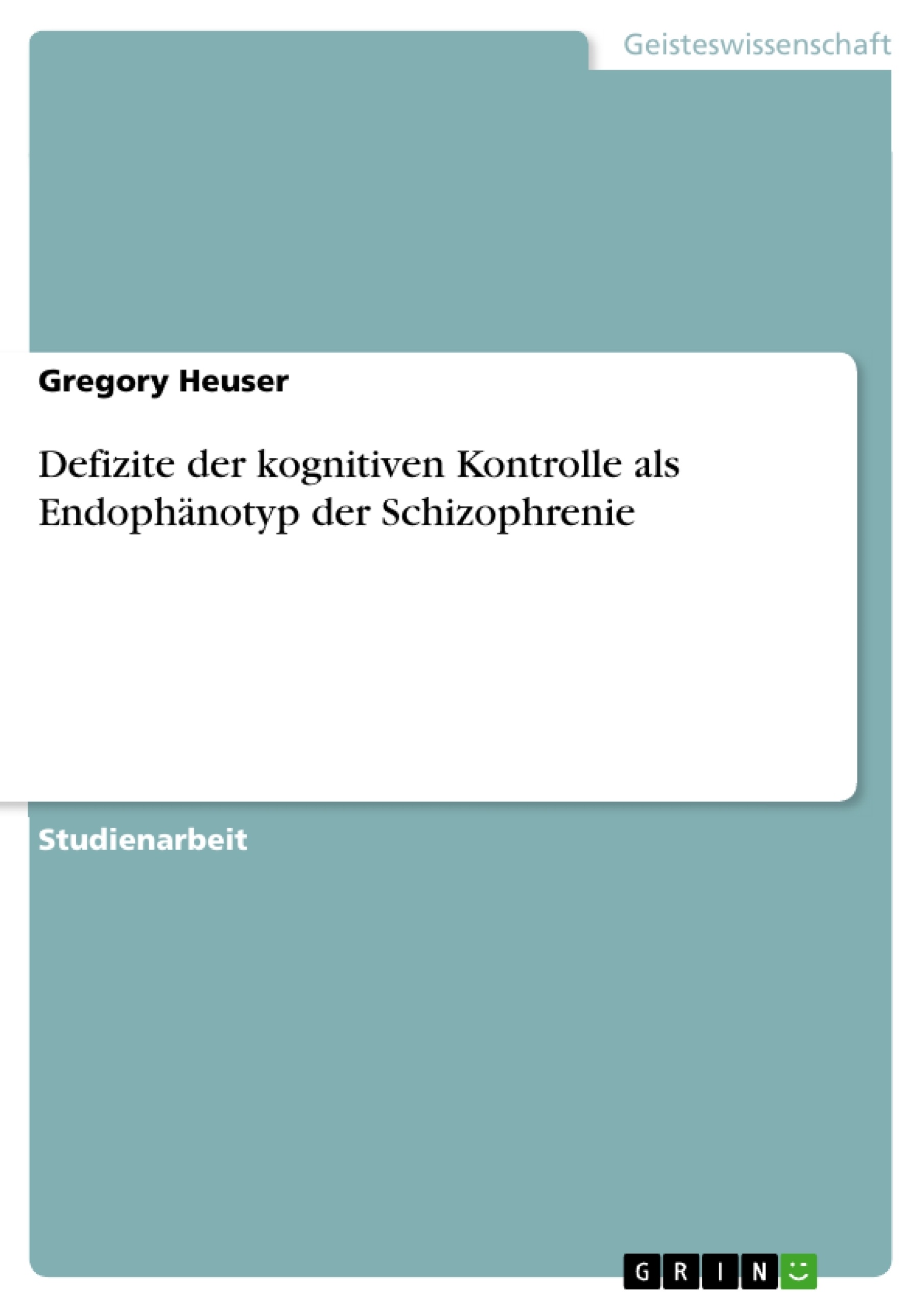Diese Abhandlung beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob gewisse Defizite im Rahmen kognitiver Kontrollprozesse als Endophänotyp für das heterogen und ätiologisch komplexe psychiatrische Störungsbild der Schizophrenie, dienen können. Die gesichteten Endophänotypen (genetisch mit der Störung assoziierte Normvarianten) sollen idealerweise eine Brücke zwischen Phänotypen und Genotypen Schlagen und dementsprechend können sie weitere Erklärungsansätze zur Ätiologie und zur molekulargenetischen Aufklärung bieten. Nach der Sichtung von diversen Quellen, kommen primär exekutive Funktionsstörungen innerhalb des Aufgabenwechsel, der Inhibition, der Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnis, als mögliche neuropsychologische Endophänotypen der Schizophrenie in Betracht.
Schlüsselwörter: Endophänotyp, Gene, Schizophrenie, kognitive Kontrolle
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1. Einleitung
2. Psychische Störungen
2.1 Definition und Epidemiologie psychischer Störungen
2.2 Klassifikationsmerkmale von psychischen Störungen
3. Endophänotyp
3.1 Endophänotyp im Rahmen von Phänotyp und Genotyp
3.2 Annahmen, Vorteile und Bedingungen für das Endophänotypkonzept
4. Schizophrenie
4.1 Definition und Epidemiologie der Schizophrenie
4.2 Symptomatik und Defizite der Schizophrenie.
4.3. Heritabilität innerhalb der Schizophrenie
4.4 Allgemeine Endophänotypen innerhalb der Schizophrenie
5. Kognitive Kontrolle
5.1 Kognitive Kontrolle im Rahmen der Volition und Motivation
5.2 Allgemeine Exekutivfunktion
5.2.1 Aufgaben und Messmethoden - Shifting
5.2.2 Aufgaben und Messmethoden - Updating
5.2.3 Aufgaben und Messmethoden - Inhibition
5.3 Beteiligte kortikale und subkortikale Strukturen bei Planung und Ausführung von Handlung
6. Defizite der kognitiven Kontrolle als Endophänotyp der Schizophrenie.
6.1 Innerhalb des Aufgabenwechsels
6.2 Innerhalb der Inhibition
6.3 Innerhalb der Aufmerksamkeit
6.4 Innerhalb des Arbeitsgedächtnis
7. Ausblick und Limitierung
8. References
Tabellenverzeichnis und Abbildungsverzeichnis
Abbildung. 1 Alternative Theorie für die Phänoty-Genotyp-Beziehung (Zobel & Maier, 2004 p. 208)
Tabelle. 1 Mögliche Testverfahren zur Erfassung neurokognitiver Defizite bei schizophrenen Patienten (mod. Kircher & Gauggel, 2008 p. 59)
Abbildung. 2 Grundkonzepte der Endophänotypen im Rahmen eines schizophrenen Störungsbild (mod. nach Kircher & Gauggel, 2008 p. 56)
Abbildung. 3 Interaktion von Shifting, Updating und auf die Leistung von einzelne Exekutive
Aufgaben bzw. auf die Gesamtleistung aller Aufgaben (Miyake et al., 2000 p. 60)
Abbildung. 4 Reziproke Verbindungen des präfontalen Kortex (PFC) mit dem Neokortex und diversen subkortikalen Feldern (links) und input bzw. output Wege des PFC (rechts) (Goschke, 2012p. 27)
Abbildung. 5 Bedeutende Hirnstrukturen die für das menschliche Handeln zuständig sind (Hommel & Nattkemper, 2011p. 16)
Abstract
Diese Abhandlung beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob gewisse Defizite im Rahmen kognitiver Kontrollprozesse als Endophänotyp für das heterogen und ätiologisch komplexe psychiatrische Störungsbild der Schizophrenie, dienen können. Die gesichteten Endophänotypen (genetisch mit der Störung assoziierte Normvarianten) sollen idealerweise eine Brücke zwischen Phänotypen und Genotypen Schlagen und dementsprechend können sie weitere Erklärungsansätze zur Ätiologie und zur molekulargenetischen Aufklärung bieten. Nach der Sichtung von diversen Quellen, kommen primär exekutive Funktionsstörungen innerhalb des Aufgabenwechsel, der Inhibition, der Aufmerksamkeit und des Arbeitsgedächtnis, als mögliche neuropsychologische Endophänotypen der Schizophrenie in Betracht.
Schlüsselwörter: Endoph ä notyp, Gene, Schizophrenie, kognitive Kontrolle
1. Einleitung
Da kognitive Defizite die Kernsymptome der Schizophrenie ausmachen und weil diese Beeinträchtigungen primär durch Gene bedingt sind, eigenen sie sich potentiell sehr gut als Kandidaten für die Suche nach endophänotypischen Markern (Braff & Light, 2005). Im Weiteren können Verhaltensneurophysiologisch definierte Endophänotypen einen wichtigen Beitrag sowohl zur Aufklärung pathophysiologischer Grundlagen, als auch zur Entwicklung einer neurowissenschaftlich basierten Klassifikation psychiatrischer Erkrankungen, leisten (Gruber, Gruber, & Falkai, 2005a).
In der breiten Forschungslandschaft wurden sowohl bei Patienten mit einer Schizophrenie, als auch bei ihren gesunden Verwandten, insbesondere bei diskordanten Zwillingen, dieselben Defizite der kognitiven Kontrolle bzw. allgemeine kognitive Beeinträchtigungen beobachtet (Kaiser, Mundt, & Weisbrod, 2005; Schulze- Rauschenbach, 2007; Sitskoorn, Aleman, Ebisch, Sjoerd J. H., Appels, Melanie C. M., & Kahn, 2004). Da die meisten untersuchten Endophänotypen auch einer Heritabilität (Erblichkeit von Merkmalen) unterliegen (Greenwood et al., 2007; Schulze-
Rauschenbach, 2007; Zobel & Maier, 2004), kann dieses Syndrom mit relativer Sicherheit als ein Endophänotyp der Schizophrenie definiert werden (Kaiser et al., 2005). Auf den folgenden Seiten werden die jüngsten Fortschritte, Herausforderungen und Auswirkungen dieses neuen genetischen Forschungsansatzes, illustriert.
Dieser Artikel lässt sich demnach grob in sechs Bereichen einteilen, zuerst werden psychische Störungen mit ihren Definitionen und ihren Klassifikationsmerkmalen vorgestellt. Daraufhin folgt eine Begriffsbestimmung des neuen genetischen Konzepts der Endophänotypen und es werden kurz dessen Voraussetzungen und Vorteile beschrieben. Im weiteren Verlauf wird das Störungsbild der Schizophrenie definiert und es wird auf dessen Epidemiologie und seine Vererbbarkeit eingegangen und zu guter Letzt werden einige schon erforschte Endophänotypen innerhalb dieses Störungsbild exemplarisch dargelegt. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Beschreibung exekutiver Funktionen/ kognitiver Kontrolle. Dabei wird der Fokus unteranderem auf die Prozesse des Shifting, des Updating und der Inhibtion, gelegt. Auf die Beteiligungen einzelner Gehirnregionen, innerhalb der Planung und Ausführung von Handlungen, sowie deren Defizite im Rahmen einer schizophrenen Störung, wird kurz eingegangen. Nach dieser Bestandsaufnahme der aktuellen Forschungslandschaft, wird sich der Frage gewidmet ob Einbußen innerhalb einzelner exekutiver Kontrollprozesse (Aufgabenwechsel, Inhibition, Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis) als adäquate Endophänotypen für das schizophrene Krankheitsbild gelten können. Final werden Vorschläge für weitere unbehandelte Fragestellungen geben und mögliche Limitierungen bezüglicher der vorherigen Kapiteln, werden diskutiert.
2. Psychische Störungen
2.1 Definition und Epidemiologie psychischer Störungen
Eine genaue einheitliche Definition von psychischen Störungen als eine eindeutig feststehende Entität, die auf Grundlagenforschung basiert, ist hier eigentlich nicht möglich. Die psychische Störung kann vielmehr als ein Konstrukt angesehen werden, dass vom Stand der Forschung und deren Experten für einen gewissen Zeitraum immer wieder neu definiert und überarbeitet werden muss (Wittchen & Hoyer, 2011). Dies bedeutet, dass sich ein Störungsbild oder sogar ganze Abschnitte eines Klassifikationssystems ändern können. Bis dato gibt es keine Definition bzw. Klassifikation, die alle Aspekte einer Störung beinhaltet und die nicht auf irgendeine Art und Weise fehlerhaft wäre (Maddux & Winstead, 2005).
Insgesamt beträgt das Lebenszeitrisiko, mindestens einmal im Leben temporär an einer psychischen Störung zu erkranken bzw. die Kriterien einer psychischen Störung zu erfüllen, über 50 % (Kessler et al., 2005). In Deutschland wurde die Anzahl der psychischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung anhand einer repräsentativen Stichprobe innerhalb des Bundesgesundheitssurveys 19/89 gemessen. Zu diesem Zeitpunkt litten ca. ein Drittel (31,1%) der erhobenen Teilnehmer an einer psychischen Störung (Jacobi et al., 2004; Wittchen & Jacobi, 2005). Eine Nachfolgestudie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland, belegte im Jahre 2012 das sich diese Werte nicht wesentlich verändert haben (Jacobi & Kessler-Scheil, 2013). In Deutschland lag die Zahl der Betroffen, im Jahre 2005, bei ca. 15 Millionen (Wittchen & Jacobi, 2005).
Insgesamt schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass in den Industrienationen 20 % aller Erkrankungen psychiatrische Störungen sind und das dieser Anteil weiterhin stark steigen wird (Haden & Campanini, 2001). Dem gegenüber stehen Jacobi und Kessler-Scheil (2013), sie wiedersprechen den allgemeinen getätigten Aussagen, dass psychische Störungen und Verhaltensstörungen die „Epidemie des 21. Jahrhunderts“ wäre oder einem sog. „age of depression“. Sie sagen weiterhin, dass psychischen Störungen vielmehr an Bedeutung gewonnen haben, jedoch entsprich diese nicht notwendigerweise einer realen allgemeinen Zunahme.
2.2 Klassifikationsmerkmale von psychischen Störungen
Die diagnostischen Definitionen stützen sich hierbei primär auf klinische Erfahrungen und Konventionen. Dementsprechend werden Psychische Störungen und deren Symptome bzw. Syndrome heutzutage hauptsächlich nach dem „International Classification of Deseases“ (ICD-10) (Dilling, 2012) und in ähnlicher Weise nach dem „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-IV) (Saß, 2003) klassifiziert. An dieser Stelle wird explizit darauf hingewiesen, dass dieser Artikel sich nicht auf das im Mai 2013 neu erschiene DSM 5 bezieht, da alle relevanten Studien innerhalb dieser Abhandlungen, sich nur auf das DSM-IV (bzw. älter DSM Versionen), stützen. Yoon et al. (2012) schlagen an dieser Stelle vor, dass bezogen auf das schizophrenen Störungsbild, die Klassifikation sich vor allem nach den Fehleistungen innerhalb der kognitiven Kontrolle richten soll (gemessen durch sog. kontinuierliche Leistungsaufgaben), da diese eine besser Subtypisierung erlauben.
Um Erkrankungen weiter spezifischer zu kategorisieren, bediente man sich Ende des 20. Jahrhunderts, im Rahmen der biologischen korrelaten, dem Konzept der sog. Markern (Bondy, Ackenheil, Müller-Spahn, & Hippius, 1988). Die Marker sollten Hinweise auf die Spezifit ä t (Gibt die Wahrscheinlichkeit an tatsächlich Gesunde als gesund zu identifizieren) und die Sensitivit ä t (Gibt die Wahrscheinlichkeit an tatsächlich Kranke als krank zu identifizieren) einer Erkrankung angeben. Zwar ist diese Konzept relativ populistisch/ populär, allerdings weist es nur einen losen Zusammenhang mit der Pathophysiologie der Erkrankung auf und daher hat auch dieser Ansatz keinen anhaltende Akzeptanz innerhalb der Forschungsgemeinde gefunden (Zobel & Maier, 2004).
Das Nachfolge Modell ist hingegen ist um einiges valider und erreicht auch einen höheren Zuspruch innerhalb der Ätiologieforschung, es basiert auf sog. Endophänotypen. Dieses Konzept hat im Gegensatz zu den Markern den Vorteil, dass sie von der Grundannahme ausgehen, dass psychische Störungen nicht allein neurobiologische Korrelate aufweisen, vielmehr werden sie neurobiologisch verursacht bzw. bedingt. Im weiteren lasen sich durch das neue Konzept spezifischere Krankheitskonzepte und genauere Krankheitsprozess Definieren (Gould & Gottesman, II, 2006).
3. Endophänotyp
3.1 Endophänotyp im Rahmen von Phänotyp und Genotyp
Am besten kann man Endophänotypen beschreiben wenn man sich zuerst die reine Wortbedeutung getrennt betrachtet, „Endo“ (innen) und „Phänotyp“ (Erscheinungsbild). Ursprünglich stammt der Begriff „Phänotyp“ aus dem Jahre 1909 vom dänischen Botaniker Wilhelm Johansen, der sie im Kontext der „Genotypen“ gebrauchte, er prägt in diesem Sinne auch unter anderem das Wort „Gene“
(Gottesman & Gould, 2003). Innerhalb seiner Forschung fand er heraus, dass der Phänotyp oft ein unvollkommener Indikator eines Genotyp ist. Hierbei kann der gleiche Genotyp zu einer Vielzahl von verschiedenen Phänotypen führen und umgekehrt kann jedoch der gleiche Phänotyp von unterschiedliche Genotypen bedingt sein. Der moderierende Faktor der zu verschiedenen Ausprägungen dieser beiden Variablen führt, sind hierbei die Umwelt und andere diverse epigenetische Faktoren (Gottesman & Gould, 2003; Petronis et al., 2000). Im klinischen Kontext kann nun ein Genotyp ein guter prognostischer Indikator für Krankheiten sein. Im Gegenzug dazu stellt ein Phänotyp ein beobachtbare Eigenschaft (Verhaltensmerkmal oder psychologische, morphologische oder psychologische Ausprägung) eines Organismus dar, diese ist jedoch ein gemeinsames Produkt aus Genotypen und Umwelt (Gottesman & Gould, 2003). Bei Krankheiten mit klassischen und mendelschen Erbgängen kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass das ein Genotyp auch einen Indikator des Phänotyp ist (monogenetische Erkrankung), jedoch bei Erkrankungen wie z.B. der Schizophrenie, die eine komplexe genetische Vererbung hat, existiert nicht eine solche kausale Sicherheit (Glazier, 2002; Gottesman & Gould, 2003; Province, Shannon, & Rao, 2001). Vielmehr sind die Modelle der komplexen genetischen Krankheiten, bedingt von zahlreichen Interaktionen innerhalb von Genotypen, von epigenetischen Faktoren und der Umwelt, die dadurch final zudem Phänotyp (Symptom bzw. Krankheit) führen (Glazier, 2002).
Mögliche Einflussfaktoren für das Auftreten eines Merkmals/ Störung, lassen sich vor allem sehr gut durch Zwillingstudien Untersuchen. Das bedeutet im Idealfall, dass man einen Vergleich von eineiigen (monozygot) und zweieiigen (dizygot) Zwillingen, die z.B. für das Störungsbild der Schizophrenie k onkordant (bei beiden Zwillinge tritt das zu untersuchende Merkmal auf) oder diskordant (das zu untersuchende Merkmal tritt nicht bei beiden auf) sind, anstrebt. Es wird nun vorausgesetzt, dass eineiige Zwillinge sich alle Gene in gleicherweise teilen, da sie von einer befruchteten Eizelle kommen und zweieiigen Zwillingen sich je nur die Hälfte der Elterlichen Gene teilen (wie alle Geschwister), da sie aus zwei verschiedene Eiern stammen. Wenn nun ein Endophänotyp eher genetischem Einfluss unterliegt, sollte der Defizite in einem Endophänotyp, bei dizygoten Zwillingen durchschnittlich 50% gleich sein und bei monozygoten sollte eine 100% Übereinstimmung (konkordant)
zwischen den Zwillingen herrschen. Wenn jedoch eher Umweltfaktoren für das Auftreten des zu untersuchenden Endophänotyp verantwortlich sind, sollten bei monozygoten Zwillingen nur einer der beiden das Merkmal aufweisen (diskordant) (Braff, Schork, & Gottesman, 2007a).
Trotz intensiver Forschung bei psychiatrischen Krankheiten mit komplexer genetischer Ätiologie existieren kaum gesicherte Erkenntnisse über Genregionen oder gar „schuldigen“ Genen sog. Suszeptibilit ä tsgenen (Cloninger, 2002). Der Hauptgrund für dieses Unvermögen liegt wohl in der ätiologische Heterogenität des klinischen, psychopathologisch definierten Krankheitsphänotyps (Gould & Gottesman, II, 2006; Zobel & Maier, 2004). Eine weitere Problematik ist, dass die hochkomplexen Wechselwirkung zwischen, Gene, Proteine, Zellen und der Verschaltung von Zellen, sich bei jeder Person, abhängig von Ihren erlebten Erfahrungen, unterscheidet (Kandel, 1998).
Anfang der 70er Jahre erkannte die psychiatrische Forschung, dass die Herangehensweise über den Phänotyp, zur Eingrenzung von Genotypen (Suszeptibilitätsgenen) bzw. ganzen Genregionen die für das Auftreten von psychische Störung zuständig sind, zu grob und ungenau war. Daher richtete man den Blick nun mehr nach innen d.h. komplexe Verhaltensweisen wurden auf bestimmte Komponenten (biochemische, endokrine, neuroanatomische oder neurophysiologische) reduziert (Gottesman & Gould, 2003). Dieser Ansatz wurde im Rahmen der Schizophrenie, von Gottesman und Shield (1973) als Endophänotyp (internales Phänotyp) oder als Annährung bezeichnet. In diesem Konzept wurden also diagnostisch definierte Phänotypen durch passende neurobiologische Krankheitskorrelate (Endophänotypen) ersetzt, da diese neurobiologische Krankheitskorrelate als sensitive Indikatoren der genetische Vulnerabilität angesehen wurden (ebd.). Der Vorteil des Endophänotyp im Gegenzug zum Phänotyp ist, dass er nicht so komplex und nicht so vielen verschiedenen Einflüssen unterliegt, er kann uns viel mehr einen direkten Hinweis auf die Pathophysiologie der psychiatrischen Erkrankungen liefern (Henseler & Gruber, 2007).
Wenn z.B. exekutive Defizite (das ein Symptom der Schizophrenie ist) auch bei nicht erkrankten Verwandten von schizophrenen Patienten (insbesondere bei den Eltern) bestehen würden, dann könnte dies als ein Endophänotyp dieses Störungsbild gelten. Bei der Identifizierung von möglichen Vulnerabilitäsmakern, bieten die Angehörigenstudien denn Vorteil, dass mögliche konfundierte Variablen von reinen Patientenstudien, wie z.B. pharmakologische Behandlungen, mögliche neurotoxische Effekte oder chronische Hospitalisierung ausgeschlossen werden können (SchulzeRauschenbach, 2007). Innerhalb von Angehörigenstudien, wären dann die Untersuchung von älteren Angehörigen vorzuziehen, da sie die Risikoperiode für die Entwicklung einer möglichen psychotischen Erkrankung schon weitgehend durchlaufen haben (das Ideal wären biologische Eltern schizophrener Patienten), jüngere Angehörige können hingegen eher im Laufe ihres Leben noch an einer Schizophrenie erkranken (allerdings muss berücksichtigt werden, dass mit erhöhtem Alter die alterskorrelierten Störvariablen zunehmen) (ebd.).
Die Endophänotypen Bezeichnung ist Angelehnt an Lewis (1966) eingeführter Unterscheidung zwischen Exophänotypen (externer Phänotyp) und Endophänotypen (interner Phänotyp), wobei letztere mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, nur mit Zuhilfenahme von biochemischer Test oder eine mikroskopische Untersuchung der Morphologie der Chromosome, können Unterschiede gemessen werden.
Um mögliche Verwechslungen vorzubeugen, wir darauf hingewiesen, dass die Begriffe „intermediärer Phänotyp“, „biologischer Marker“, „subklinisches Trait“ und „Vulnerabilitätsmarker“ als Synonym für „Endophänotyp“ dienen (Gottesman & Gould, 2003). Einen recht guten Unterschied zu dem klassischem diagnoseorientiertem Ansatz und der alternativen Endophänotypenstrategie, für die erfolgreiche Suche nach Kandidatengene (bezüglich bestimmter psychischer Störung) stellt das unteren Schaubild dar (Abbildung 1).
Abbildung. 1 Alternative Theorie für die Phänoty-Genotyp-Beziehung (Zobel & Maier, 2004 p. 208).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Annahmen, Vorteile und Bedingungen für das Endophänotypkonzept
Eine recht prägnant Defintion von Endophänotypen lautet wie folgt: „Endophenotypes are quantitative, heritable, traitrelated deficits typically assessed by laboratory-based methods rather than clinical observation“ (Braff, Freedman, Schork, & Gottesman, 2007 p. 21). Endophänotypen können innerhalb von neurophysiologischen, biochemischen, endokrinologischen, neuroanatomischen, kognitiven oder neuropsychologischen Prozessen auftreten und im Gegenzug zu klinisch Symptomen, werden sie eher als genetische Variation betrachtet und sind dementsprechend enger mit verbbaren Risikofaktoren verknüpft (Braff et al., 2007; Gould & Gottesman, II, 2006). Diese Einteilung schafft hierbei einen einfacheren Zusammenhang zwischen einem Krankheitssyndrom und ihrer genetischen Grundlage, es kann also dementsprechend auch Auskunft über mögliche ätiologische Modelle einer Störung geben. Dieses neurobiologisches Konzept zur Charakterisierung von psychischen Störungen, ermöglicht Diagnosen genauer zu unterteilen bzw. zu dekonstruieren, in Bezug auf die Störungen ergibt sich dadurch automatisch meist auch eine unkompliziertere und erfolgreichere genetische Analyse (Gottesman & Gould, 2003).
Im Vergleich zu klassischen Phänotypen, die durch bestimmte Krankheitsdiagnosen oder Verhaltensmerkmale definiert werden, repräsentieren die Endophänotypen krankheitsbedingte Veränderungen bzw. ihre zugrundeliegende Hirnfunktionen (Zobel & Maier, 2004). Wie schon an anderorts dargelegt sind also beide das Endprodukt von Genotypen (von polymorphen Genen), wobei der Vorteil vom Endophänotyp unteranderem darin liegt, dass er eine nähere Beziehung zum Genotyp besitzt und dieses trägt zur Lösung der kausalen Heterogenitätsproblematik von psychischen Störungen, bei (ebd.). Ein weiterer Vorzug im Vergleich zur klassischen Genortsuche ist, dass durch das neue Konzept besser falsch- positive Fälle/ Diagnose vermieden werden, weil die Heterogenität des klinischen Erkrankungsphänotyps, durch die reine Fokussierung auf die Erkrankungsfälle, die zugleich einen bestimmten Endophänotyp tragen, beschränkt wird. Weiterhin werden die falsch-negativ Fälle/ Diagnosen vermieden, da auch die klinischen gesunden Träger des Endophänotyps als „erkrankt gelten (ebd.).
Damit tatsächlich von einem Endophänotyp ausgegangen werden kann, sollten nach Gottesman und Gould (2003) folgende fünf Kriterien erfüllt sein.
1. Eine Assoziation mit dem Merkmal einer Erkrankung sollte bestehen.
2. Die Erblichkeit des Merkmals muss gegeben sein.
3. Eine überwiegende Unabhängigkeit vom Krankheitsstadium (z. B. auch in der Prodromalphase innerhalb der Schizophrenie oder bei Remission der Symptome nachweisbar) sollte vorhanden sein.
4. Der Endophänotyp und die Erkrankung kosegregieren (d.h. werden in Familien gemeinsam weitergegeben).
5. Der bei den Erkrankten gefundene Phänotyp tritt bei nicht erkrankten biologischen Familienangehörigen häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung.
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kann im Rahmen einer eines schizophrenen Störungsbildes, von einem hypothetischen Modellhaften Zusammenhang zwischen Suszeptibilitätsgenen/ Dispositionsgenen der Krankheit und den verschiedenen Phänotypebenen (darunter fallen Krankheitsphänotyp und Endophänotyp) ausgegangen werden. Dabei dient der Endophänotyp als Verbindung zwischen Genotyp und klinischem Phänotyp (Abbildung 1). Selbst nach einer erfolgreichen Bestimmung von Dispositionsgenen für klinisch benannten Ekrankungsphänotypen, kann man Endophänotypen zur Analyse von Genotyp- Phänotyp Zusammenhänge zurate ziehen (Gottesman & Gould, 2003). Als neuropsychologisches Endophänotyp im engeren Zusammenhang werden vor allem Beeinträchtigungen des deklarativen Gedächtnisses, Aufmerksamkeitsdefizite, und exekutive Funktionen einschließlich des Arbeitsgedächtnisses, angesehen (Kircher & Gauggel, 2008). Insbesondere auf den Aspekt der Exekutivfunktionen (EF), genauer gesagt auf Defizite innerhalb exekutiven/ kognitiven Kontrolle, im Rahmen der schizophrenen Störung, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit.
Diese Kapitel lässt sich recht gut mit den Worten der deutschen Gesellschaft für biologische Psychiatrie (DGBP) Abschließen: „Insgesamt hat sich durch den Einsatz von Endophänotypen eine bemerkenswerte Möglichkeit eröffnet, komplexe neuropsychiatrische Krankheiten zu untersuchen und wird in naher Zukunft voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle einnehmen“ (Deutsche Gesellschaft für Biologische Psychiatrie (DGBP) 05.11.2013)
4. Schizophrenie
4.1 Definition und Epidemiologie der Schizophrenie
Die Schizophrenie [gr. schizein spalten phren Seele, Gemüt, Zwerchfell] ist eine der kritischsten psychischen Erkrankungen, die hauptsächlich das Denken, das Verhalten und die Emotionen beeinträchtigt (Dorsch & Häcker, 2009). Zum ersten Mal geprägt wurde der Begriff Schizophrenie von den deutschen Psychiatern Emil Kraeplin und Eugen Bleuler Anfang des 20. Jahrhundert (Fusar-Poli & Politi, 2008). Bei dieser Störung sprach man früher meist von „Verrücktheit“ oder „Wahnsinn“, auch wurde primär von einer Spaltung der psychischen Funktionen und dem daraus resultierenden Verlust der einheitlichen Persönlichkeit ausgegangen (Stotz-Ingenlath, 2000). Heutzutage wird dieses klinische Bild meist als, Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störung definiert (Wittchen & Hoyer, 2011). Die Krankheit beeinflusst „die Handlungsplanung, die Handlungsausführung, das Denken, die Verarbeitung von Sinnesreizen, die soziale Interaktion, die Auffassung und die Aufmerksamkeit und ihr liegt sehr wahrscheinlich als Hauptursache eine biologische Veränderung im zentralen Nervensystem (ZNS) zugrunde (Förstl, Hautzinger, & Roth, 2006).
[...]