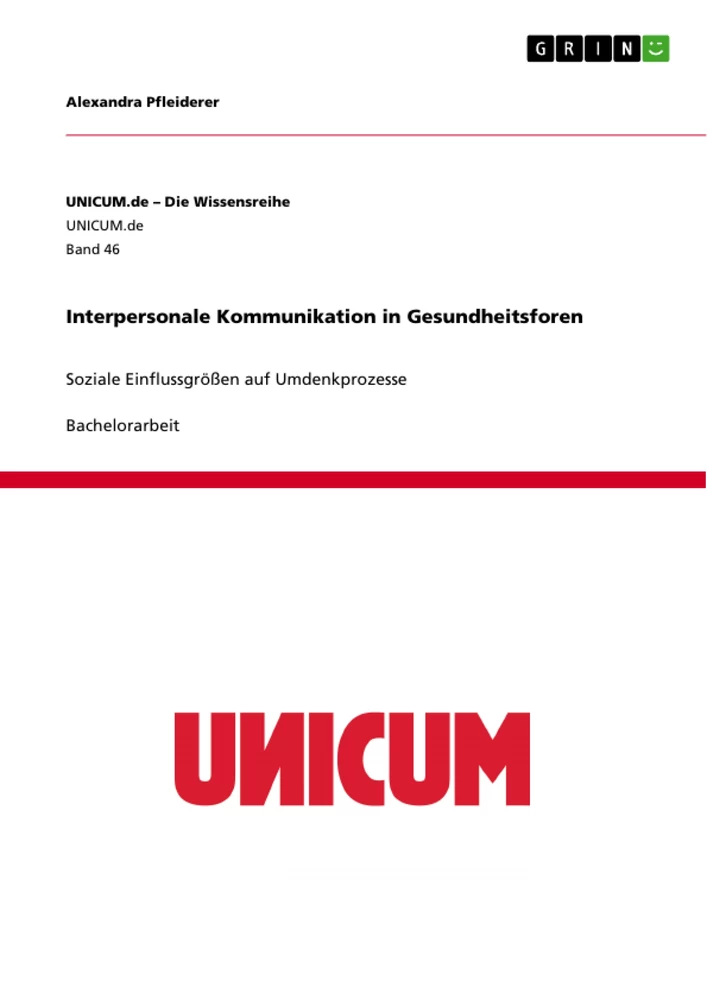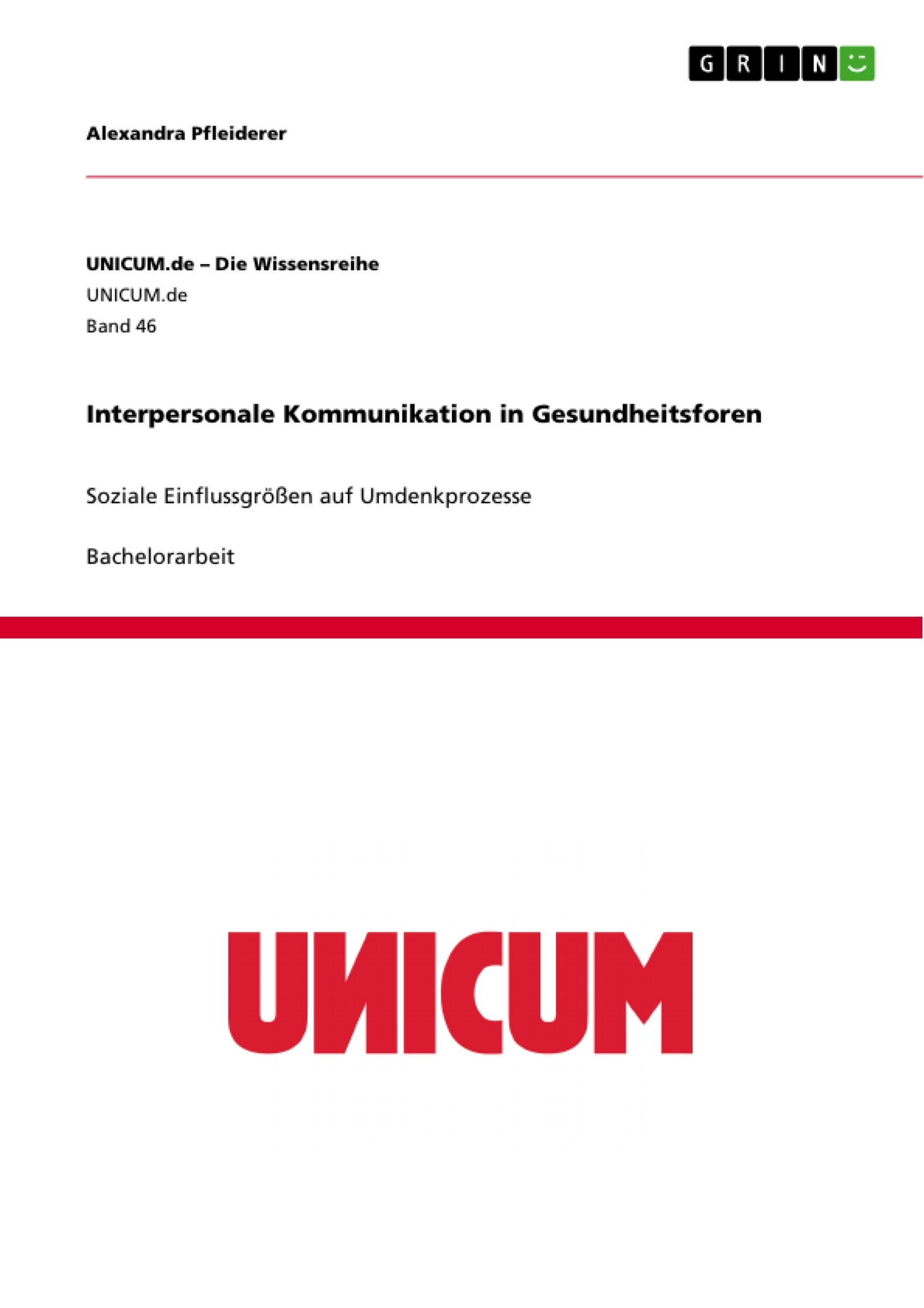Durch die vielen Möglichkeiten des Social Web hat sich die klassische Gesundheitskommunikation zu weiten Teilen ins Internet verlagert. Die Kommunikation online geht aber nicht wie in der massenmedialen Gesundheitskommunikation primär von Instituti-onen, Krankenkassen oder Unternehmen aus, die ein Interesse an der Kommunikation von Gesundheitsprävention und -förderung haben. Auf Ebene einer Laienkommunikation wenden sich Internetnutzer auf der Suche nach Unterstützung und Hilfe, zum Beispiel in einem Onlineforum, an andere Betroffene. Mit zunehmenden partizipativen Möglichkeiten tauschen sie Informationen, Erfahrungen und Empfehlungen untereinander aus. Das nahezu unbegrenzte Angebot sowie der zeit- und ortsunabhängige Zugriff auf Gesundheitsthemen subjektiven Interesses wurden erst durch das Internet ermöglicht.
Die Zahl der Personen, die regelmäßig im Internet nach Gesundheitsinformationen suchen und sich dort mit anderen austauschen, steigt (Lausen, 2008, o.S.). Damit nimmt auch die Bedeutung interaktiver Onlineumgebungen zu. Onlineforen bieten großes Potential für den Aufbau interpersonaler Beziehungen und damit auch für soziale Beeinflussung durch den interaktiven Austausch.
Mit der zunehmenden Bedeutung des Internets für die Gesundheitskommunikation kommen auch viele Fragen auf. Im Rahmen der empirischen Untersuchung dieser Arbeit stehen folgende Forschungsfragen im Zentrum: Wie funktioniert die interpersonale Kommunikation in Gesundheitsforen und welche Auswirkungen hat die Forenkommunikation auf die persönliche Gesundheitskompetenz und auf gesundheitliche Entscheidungen? Welche sozialen Einflussgrößen führen zu Umdenkprozessen, so dass Forenteilnehmer ihr Denken oder ihre Einstellungen zu Gesundheitsthemen ändern oder sogar ihr Verhalten umstellen? Die sozialen Faktoren, welche die individuellen Umdenkprozesse von Forenteilnehmern beeinflussen könnten, sind noch wenig erforscht.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Kommunikation in Gesundheitsforen, um soziale Einflussgrößen zu identifizieren, die in der interpersonalen Onlinekommunikation beeinflussend auf Umdenkprozesse im Gesundheitsverhalten wirken. Ziel ist es, das Phänomen des sozialen Einflusses mit seinen Bedingungen und Konsequenzen zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Traditionelle Gesundheitskommunikation
2.1.1 Protection Motivation Theory
2.1.2 Selbstwirksamkeit
2.2 Interpersonale Kommunikation
2.2.1 Begriffsspezifikation und Funktionen
2.2.2 Sozialer Einfluss und Umdenkprozesse
2.2.3 Elemente des Kommunikationsprozesses
2.2.4 Theorien computervermittelter Kommunikation
2.3 Online-Gesundheitskommunikation
2.3.1 Das Internet in der Gesundheitskommunikation
2.3.2 Onlineforen
3 Methodisches Vorgehen
3.1 Qualitatives Forschungsdesign
3.2 Untersuchungsgegenstand und Stichprobenauswahl
3.3 Datenerhebung
3.3.1 Leitfadeninterview
3.3.2 Entwicklung des Leitfadens
3.3.3 Durchführung der Interviews
3.4 Datenaufbereitung und -auswertung
4 Ergebnisse
4.1 Handlungsmuster und Strukturen
4.2 Umdenkprozesse
4.3 Soziale Einflussgrößen
4.3.1 Schlüsselkategorie
4.3.2 Weitere Einflussgrößen
4.4 Auswirkungen der Forenkommunikation
5 Methodendiskussion
6 Fazit
Literaturverzeichnis