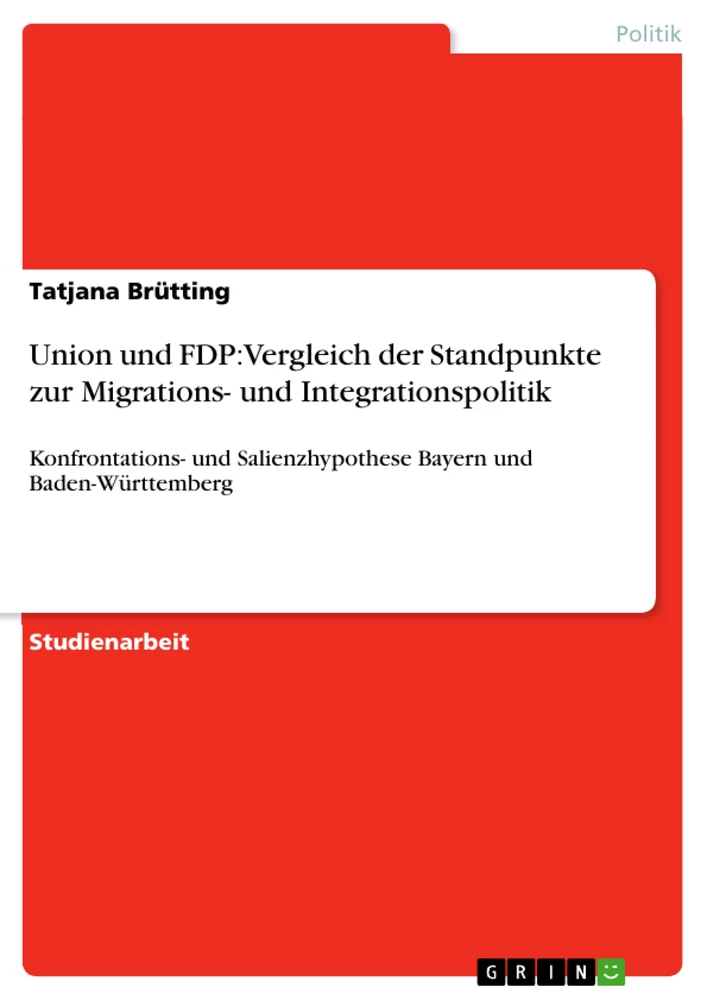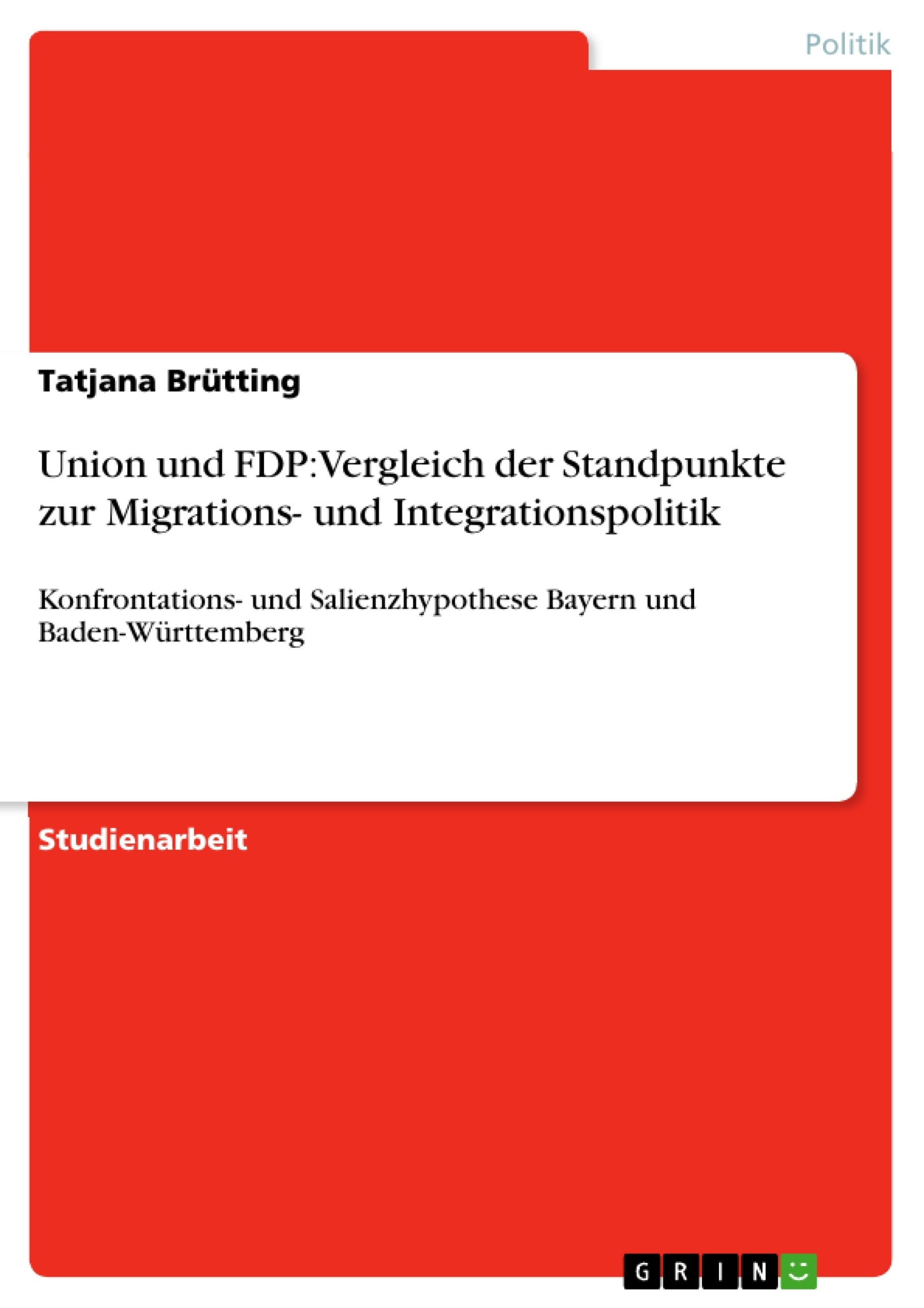Am 15.09.2013 wurde die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Bayern abgewählt und eine Woche später konnte sich auch auf Bundesebene das Bündnis zwischen Union und FDP nicht durchsetzen. In Bayern kann die CSU auf Grund ihrer absoluten Mehrheit alleine regieren doch auf Bundesebene beginnen nun die Koalitionsverhandlungen. Dies gibt einen Anlass zu untersuchen, welche Koalitionstheorien bei solchen Prozessen zum Zuge kommen. Im Rahmen meines migrations- und integrationspolitischen Forschungsinteresses werden hierbei die Union und FDP in den Fällen Bayern und Baden-Württemberg für die Zeitpunkte 2006 und 2008 untersucht und die konkurrierenden Konfrontations- und Salienzhypothesen getestet. Die unabhängige Variable sind hierbei die Parteien und die abhängige Variable die Parteipositionen. Diese Variable wird in der Operationalisierung in einen beobachtbaren Sachverhalt übersetzt. Dafür werden die Parteiprogramme beider Parteien auf migrations- und integrationspolitischen Inhalt untersucht und zudem analysiert, welche Partei welche Standpunkte in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen konnte. Anhand dieser Ergebnisse werden die beiden Hypothesen getestet und ausgewertet, ob eine (oder beide) den beobachteten Prozess ausreichend beschreiben kann. Anschließend gibt es eine Zusammenfassung der erforschten Ergebnisse.
Getestet werden die Konfrontations- und Salienzhypothese an der CDU/CSU und FDP in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung/ Untersuchungsrahmen
2 Fallauswahl
3 Theorie: Konfrontations- und Salienzhypothese
4 Operationalisierung
5 Messung
6 Auswertung und Darstellung
7 Zusammenfassung und Fazit
8 Quellenverzeichnis